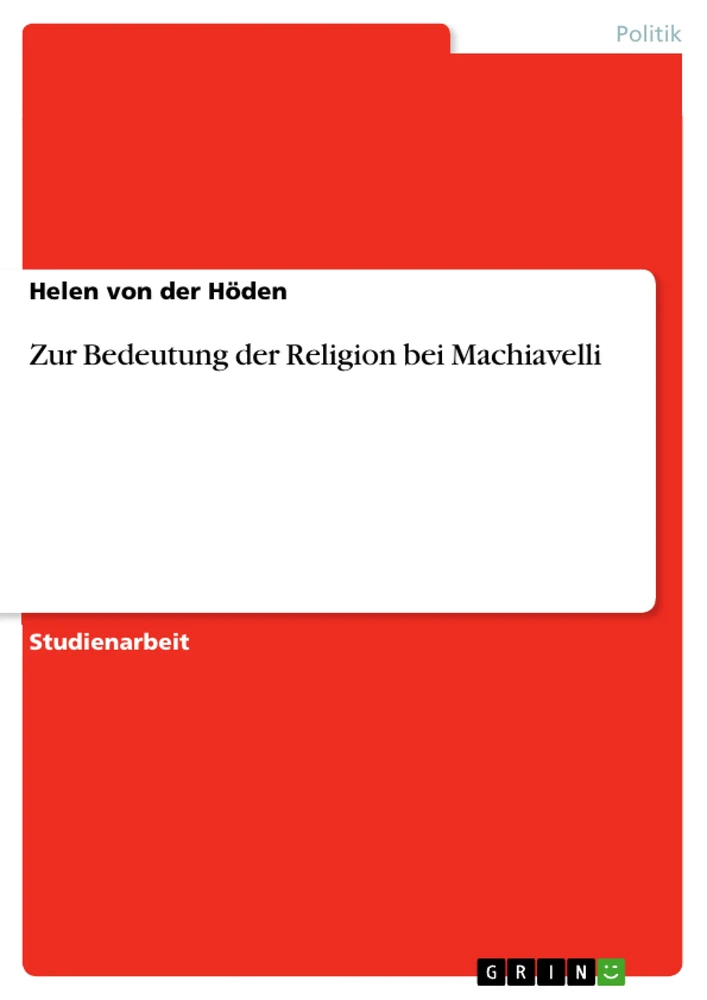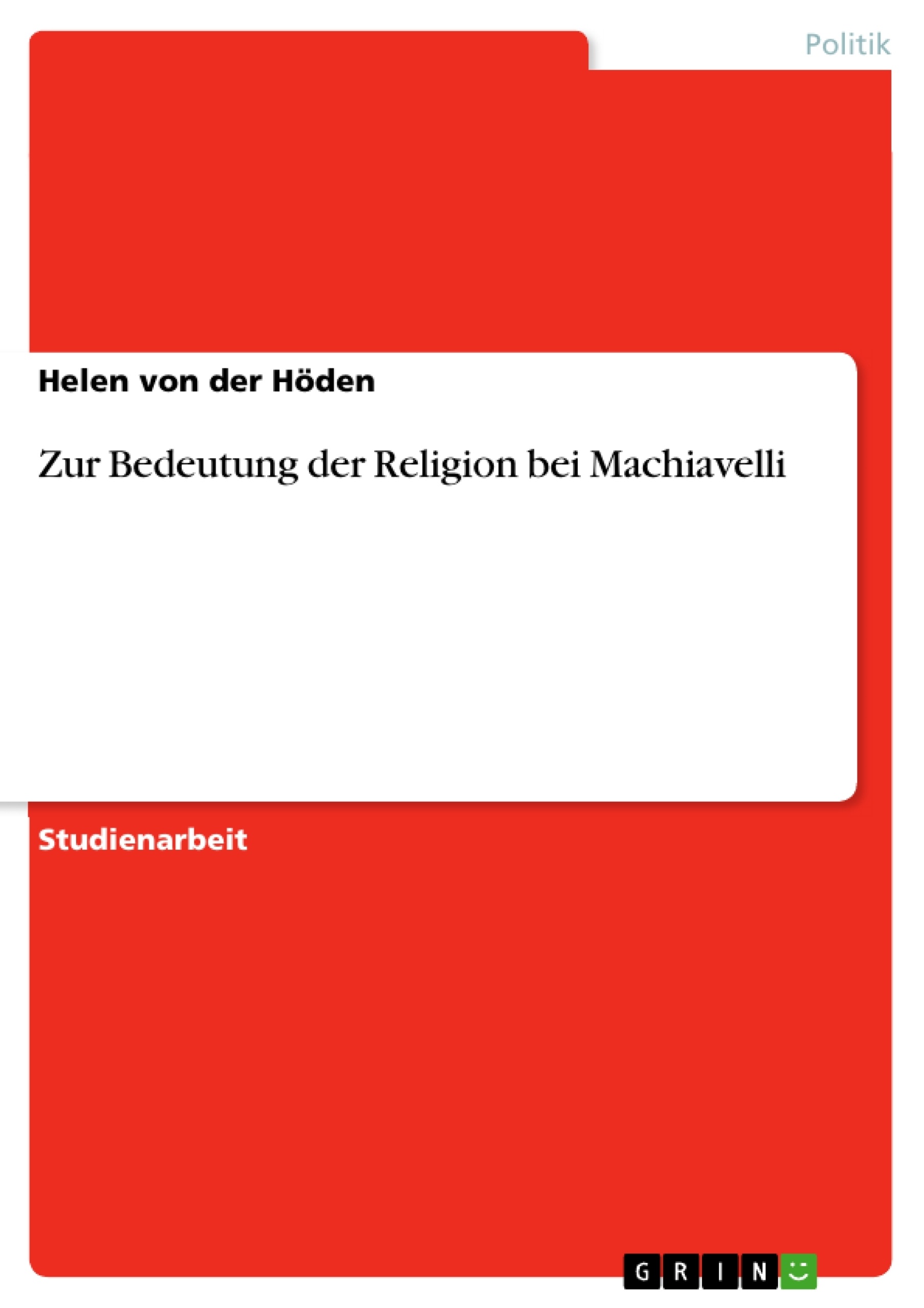Niccolò Machiavellis Werk gibt seit seinem Tod Anlass zu vielen Kontroversen. Die einen
sehen in ihm den skrupellosen Machtphilosophen, andere bewundern ihn für die Klarheit
seiner narrativen Schriften und die Vielschichtigkeit seines Werkes.Machiavellis Einstellung zum
Glauben durchzieht seine Schriften und soll an dieser Stelle einer genaueren Betrachtung
unterzogen werden. So soll untersucht werden, in welchen argumentativen Strängen
Machiavelli die Religion in seinem Werk berücksichtigt, und mithin, welche Funktion er
ihr zuweist. Dies wird anhand von Textstellen aus seinen Werken „Il Principe - Der Fürst“
(1986) und „Discorsi – Staat und Politik“ (2000) untersucht. Machiavelli spricht sich in
seinem Werk immer wieder für die Notwendigkeit der Religion aus, präsentiert sich
allerdings nicht als Freund der institutionellen christlichen Kirche.
Machiavelli widmet sich in seinen Schriften besonders der politischen Wirklichkeit seiner
Zeit und verarbeitet seine persönliche Erfahrung als Staatsvertreter in seinem Werk. Dies
gibt eine Anleitung zum richtigen Handeln eines Herrschenden; er veranschaulicht seine
Thesen am Beispiel von Staatsoberhäuptern sowohl aus seiner eigenen Zeit als auch aus
der Vergangenheit. Hierbei stützt er sich besonders auf das geschichtliche Werk des
Polybius und des Livius. Neben den Darstellungen aus der römischen Geschichte benutzt
Machiavelli auch Figuren aus dem Alten Testament und politische Persönlichkeiten seiner
Zeit als Beispiele des richtigen oder falschen Handelns eines Staatsmannes. Für
Machiavelli muss ein hervorragender Staatsmann sowohl Glück (fortuna) als auch
Leistungsfähigkeit, Cleverness und Klugheit (virtù) besitzen. Virtù ist die spezifsche
Leiteigenschaft des machiavellischen Denkens, die bei Römern eine wichtige Rolle
einnimmt. Machiavelli kontrastiert den Begriff der virtù mit dem meist bei ihm
vorherrschenden negativen Menschenbild. An dieser Stelle taucht das Glück bzw. fortuna auf, die dem Hervorragenden erst die Gelegenheit (occasione) bietet sich zu bewähren. Ist der Mensch also in seinem Schicksal festgelegt und
wird nur durch ebendiese Kraft bzw. der Fortuna gelenkt? Oder hat der Mensch einen
freien Willen und kann auch ohne die Unterstützung von Fortuna seine virtù beweisen?
Wie sieht Machiavelli die Religion und welchen Stellenwert räumt er ihr ein?
Setzt Machiavelli die Religion rein funktional ein, um das gewünschte Verhalten der
Untertanen zu gewährleisten?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vaterlandsliebe und Religion
- Die Religion als funktionales Instrument für gewünschtes politisches Verhalten
- Die Forderung nach Rückbesinnung der Religion auf ihren Ursprung
- Machiavelli und die Kirche
- Die göttlichen Kräfte
- Fortuna, Gott und der freie Wille
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Bedeutung der Religion im Werk von Niccolò Machiavelli. Sie untersucht die Rolle, die die Religion im politischen Denken Machiavellis spielt, und analysiert, wie er die Religion als Instrument für gewünschtes politisches Verhalten einsetzt.
- Machiavellis Verständnis von Vaterlandsliebe und Religion
- Die Funktion der Religion als Mittel zur Staatsführung
- Die Kritik Machiavellis an der institutionellen christlichen Kirche
- Der Einfluss von Fortuna und dem freien Willen auf die politische Handlungsfähigkeit
- Die Rolle der Religion im Kontext von militärischer Disziplin und zivilem Gehorsam
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Ausgangspunkt der Arbeit dar und führt in die Thematik der Religionsdeutung bei Machiavelli ein. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Sichtweisen auf sein Werk und stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor.
- Vaterlandsliebe und Religion: Dieses Kapitel erörtert die Bedeutung der Religion im politischen Denken Machiavellis. Es wird untersucht, wie Machiavelli die Religion als Mittel zur Staatsführung einsetzt und welche Rolle sie in seinen Schriften spielt.
- Die Religion als funktionales Instrument für gewünschtes politisches Verhalten: In diesem Kapitel wird die Rolle der Religion als Instrument zur Steuerung des politischen Verhaltens der Untertanen analysiert. Es wird untersucht, wie Machiavelli die Religion zur Sicherung von Ordnung und Stabilität im Staat nutzt.
- Die Forderung nach Rückbesinnung der Religion auf ihren Ursprung: Dieses Kapitel befasst sich mit Machiavellis Kritik an der institutionellen christlichen Kirche. Er plädiert für eine Rückbesinnung auf die Ursprünge des christlichen Glaubens, um die moralischen Grundlagen der Politik zu stärken.
- Machiavelli und die Kirche: Dieses Kapitel widmet sich dem Verhältnis Machiavellis zur Kirche und seiner Kritik an den Päpsten. Es wird untersucht, wie Machiavelli die Kirche als Machtfaktor im politischen System sieht und welche Bedeutung er ihr zuschreibt.
- Die göttlichen Kräfte: In diesem Kapitel werden die Konzepte von Fortuna und dem freien Willen in Bezug auf die politische Handlungsfähigkeit analysiert. Es wird untersucht, wie Machiavelli die Rolle des Schicksals und der göttlichen Intervention in der Politik bewertet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen dieser Arbeit sind: Religion, Politik, Machiavelli, Vaterlandsliebe, Staatsführung, Fortuna, Virtù, Kirche, Christentum, Macht, Disziplin, Gehorsam, Staatsmann, Fürstenlehre.
Häufig gestellte Fragen
Wie sieht Machiavelli das Verhältnis zwischen Religion und Politik?
Machiavelli betrachtet Religion primär als funktionales Instrument zur Sicherung von Ordnung, Gehorsam und militärischer Disziplin im Staat.
Was kritisiert Machiavelli an der christlichen Kirche seiner Zeit?
Er kritisiert die Korruption der institutionellen Kirche und sieht in ihr einen Machtfaktor, der die politische Einigung Italiens behindert.
Was bedeuten die Begriffe "virtù" und "fortuna" bei Machiavelli?
"Virtù" steht für die Tatkraft und Klugheit des Herrschers, während "fortuna" das wechselhafte Schicksal oder Glück bezeichnet, das Gelegenheiten zum Handeln bietet.
Glaubt Machiavelli an den freien Willen des Menschen?
Ja, Machiavelli argumentiert, dass der Mensch trotz des Einflusses von Fortuna einen freien Willen besitzt und durch seine virtù das Schicksal beeinflussen kann.
Welche Funktion weist Machiavelli der Religion für die Untertanen zu?
Die Religion dient dazu, das gewünschte politische Verhalten der Untertanen zu gewährleisten und den sozialen Zusammenhalt zu stärken.
- Quote paper
- Helen von der Höden (Author), 2007, Zur Bedeutung der Religion bei Machiavelli, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166881