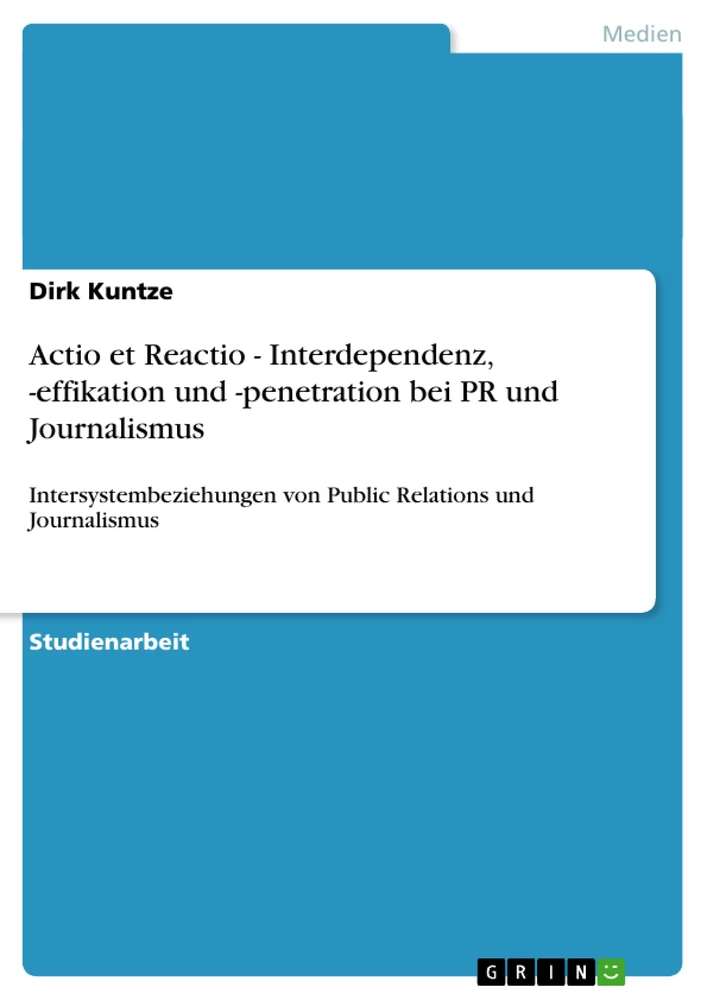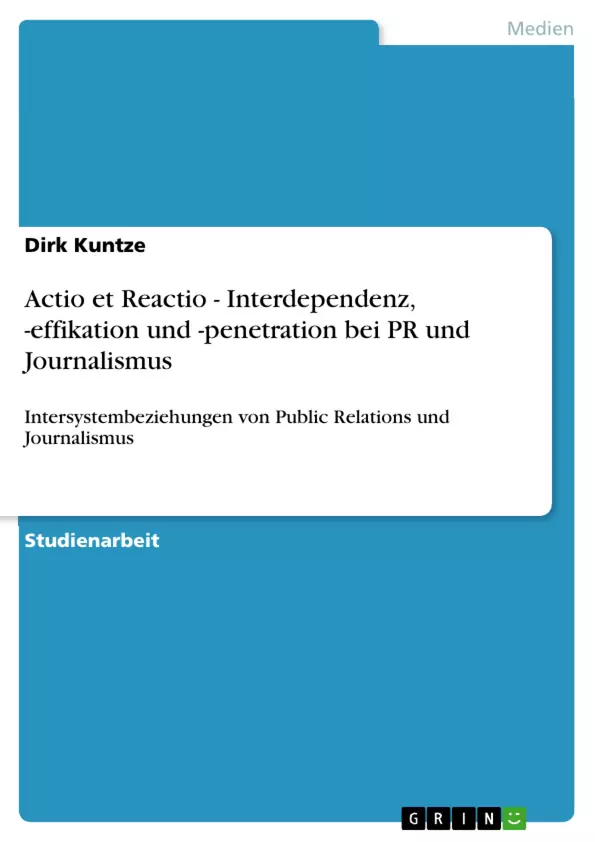Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit sind gegenwärtige kommunikations-wissenschaftlichen Theorieansätze, welche versuchen die mannigfaltigen Beziehungen zwischen Public Relations (PR) und Journalismus thesen- respektive modellhaft zu objektivieren. Anhand des Rekurses auf die aktuelle Debatte und der aus ihr erwachsenden (teilsweise kontradiktorischen) Postulate sollen Herkunft und Überprüfbarkeit sowie Tragfähigkeit bzw. Reichweite der verschiedenen Ansätze beleuchtet werden. Die Ansätze werden auf ihre theoretische Provenienz hin untersucht. Welche Theorien (System-, Handlungs-, Akteurstheorie) beeinflussten den Aufbau der zwei Modelle bzw. die Formulierung der These. Welche Folgen haben diese Wurzeln für die jeweiligen Modelle (die These)? In wieweit sind die Elemente der Modelle operational in empirische Studien zu überführen? Bieten sie Ansatzpunkte zur ihrer empirischen Überprüfung? Welche Studien könnten aufgrund der Modelle erstellt werden und mit welchem Ergebnis?
Im ersten Schritt wird versucht, das in der Kommunikationswissenschaft herrschende Verständnis über die Funktionen und Gegenständlichkeiten von Public Relations und Journalismus abzubilden. Angeschlossen ist die Vorstellung dreier früher und populärer Ansätze zur Beschreibung ihrer wechselseitigen Beziehungen. Vorgestellt werden Ansätze, die das Verhältnis als nichtlinear verstehen: die Interdependenzthese, das Intereffikationsmodell und das Interpenetrationsmodell. Die drei Ansätze werden im nächsten Schritt auf ihre theoretische Herkunft und Anbindung sowie ihre Reichweite hin untersucht. Der folgende Abschnitt zeigt Ähnlichkeiten und Gegensätze auf. Anhand des theoretischen Diskurses werden unterschiedliche Verortungen und Systematisierungen der „Intersystembeziehungen„ (Hoffjann: 2001) präsentiert. In den Schlussbetrachtungen wird ein Resümee gezogen. Mögliche Schritte zu einer weiterführenden Ausarbeitung der theoretischen Ansätze intersystematischer (Wechsel-) Beziehungen von Public Relations und Journalismus werden formuliert.
Inhaltsverzeichnis
Forschungsinteresse und Gegenstandsbeschreibung
Gegenstandsbeschreibung der PR:
Gegenstandsbeschreibung des Journalismus
Die Interdependenzthese
Das Intereffikationsmodell
Das Interpenetrationsmodell
Zur Theoretischen Provenienz und Reichweite der Ansätze
Theoretische Provenienz und Reichweite der Interdependenzthese
Theoretische Provenienz und Reichweite des Intereffikationsmodells
Theoretische Provenienz und Reichweite des Interpenetrationsmodells
Modellvergleich und -verortung im Diskurs
Schlussbetrachtungen
Literatur
Forschungsinteresse und Gegenstandsbeschreibung
Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit sind gegenwärtige kommunikationswissenschaftlichen Theorieansätze, welche versuchen die mannigfaltigen Beziehungen zwischen Public Relations (PR)[1] und Journalismus thesen- respektive modellhaft zu objektivieren. Anhand des Rekurses auf die aktuelle Debatte und der aus ihr erwachsenden (teilsweise kontradiktorischen) Postulate sollen Herkunft undüberprüfbarkeit sowie Tragfähigkeit bzw. Reichweite der verschiedenen Ansätze beleuchtet werden. Die Ansätze werden auf ihre theoretische Provenienz hin untersucht. Welche Theorien (System-, Handlungs-, Akteurstheorie) beeinflussten den Aufbau der zwei Modelle bzw. die Formulierung der These. Welche Folgen haben diese Wurzeln für die jeweiligen Modelle (die These)? In wieweit sind die Elemente der Modelle operational in empirische Studien zuüberführen? Bieten sie Ansatzpunkte zur ihrer empirischenüberprüfung? Welche Studien könnten aufgrund der Modelle erstellt werden und mit welchem Ergebnis?
Im ersten Schritt wird versucht, das in der Kommunikationswissenschaft herrschende Verständnisüber die Funktionen und Gegenständlichkeiten von Public Relations und Journalismus abzubilden. Angeschlossen ist die Vorstellung dreier früher und populärer Ansätze zur Beschreibung ihrer wechselseitigen Beziehungen. Vorgestellt werden Ansätze, die das Verhältnis als nichtlinear verstehen: die Interdependenzthese, das Intereffikationsmodell und das Interpenetrationsmodell. Die drei Ansätze werden im nächsten Schritt auf ihre theoretische Herkunft und Anbindung sowie ihre Reichweite hin untersucht. Der folgende Abschnitt zeigt Ähnlichkeiten und Gegensätze auf. Anhand des theoretischen Diskurses werden unterschiedliche Verortungen und Systematisierungen der „Intersystembeziehungen,, (Hoffjann: 2001) präsentiert. In den Schlussbetrachtungen wird ein Resümee gezogen. Mögliche Schritte zu einer weiterführenden Ausarbeitung der theoretischen Ansätze intersystematischer (Wechsel-)Beziehungen von Public Relations undjournalismus werden formuliert.
Gegenstandsbeschreibung der PR
Dass das Beziehungsgeflecht der intersystematischen (Wechsel-)Beziehungen zwischen PR und Journalismus bis heute allein zu Theorieansätzen gereicht hat, ist zu einem großen Teil der noch unzureichenden systematischen Definition der PR geschuldet[2]. Beispielhaft rekurriert Merten (2004: 21) auf die 472 Definitionen von PR, welche Harlow (1976) nennen kann. 1971 werden von Scharf mehr als 2000 Begriffsbestimmungen von PR gezählt (vgl. Scharf 1971: 166). Die oben genannten Defizite werden bereits bei der Betrachtung zweier namhafter PR-Definitionen erkennbar:
„Öffentlichkeitsarbeit oder Public Relations sind das Management von Informations- und Kommunikationsprozessen zwischen Organisationen einerseits und ihren internen oder externen Umwelten (Teilöffentlichkeiten) andererseits. Funktionen von Public Relations sind Information, Kommunikation, Persuasion, Imagegestaltung, kontinuierlicher Vertrauenserwerb, Konfliktmanagement und das Herstellen von gesellschaftlichem Konsens“ [ Bentele 1997)[3].
In einer kritischen Anmerkung zu jener Definition heißt es: „Diese Definition erweitert die Grunig'sche Definition um einen Funktionskatalog, der aber nicht abgeschlossen sein kann.“[4] Das System PR ist noch nicht und kann laut des Kommentators auch in Zukunft nicht abschließend definiert werden. In streng konstruktivistischer Sichtweise ist dieses Problem allen Definitionen eigen, die einen nichtstatischen Gegenstand zu definieren suchen. Daraus folgend, ist es ebenso unmöglich, eine umfassende und endgültige Theorie der intersystematischen (Wechsel-)Beziehungen der Disziplinen Public Relations und Journalismus festzuschreiben. Gerade durch technische Neuerungen, welche Public Relations und Journalismus unmittelbar und in besonderen Ausmaß beeinflussen, werden die beiden Systeme sowohl in sich als auch in ihrem intersystematischen Austausch zu fortlaufenden Anpassungen und Neuorientierungen genötigt. Zudem sind die Dimensionen des Zusammenspiels sehr komplex. Die Akteure der beiden Gruppen treffen in verschiedenen Wirkungs- und Handlungsdimensionen aufeinander. Es besteht eine Interaktion auf zeitlicher (Timing), sachlicher (Inhalte) und sozialer (Rollen-) Ebene. Die empirischeüberprüfung bestimmter Modelle ist gerade durch die Komplexität ihres Gegenstandes äußerst zeit- und ressourcenaufwändig. Dieser Aspekt findet sich auch in der neun Jahre später verfassten Definition von Merten:
„Public Relations sind das Differenzmanagement zwischen Fakt und Fiktion durch Kommunikationüber Kommunikation in zeitlicher, sachlicher und sozialer Perspektive" (Merten 2006J[5].
Diese Definition erscheint sehr abstrakt, heißt es in der Kritik. Positiv bewertet wird die Betonung der kommunikativen Basis und das Grundprinzip der Modellierung von Wirklichkeit durch Kommunikation. Im Laufe der Zeit verlieren ethischen Appelle an Definitionskraft, nähmlich zugunsten eines dynamischen Verständnisses des Managements von Kommunikation, mit dem Wirklichkeiten (im Hinblick auf unterschiedliche Zielgruppen) modelliert werden. Die Definitionen werden sachlicher und zugleich komplexer[6], was die Formulierung theoretische Ansätze zu den intersystematischen Beziehungen von Public Relations und Journalismus zu einer sehr anspruchsvollen Aufgabe werden lässt.
Gegenstandsbeschreibung des Journalismus
Seit 1990 weisen Journalismusdefinitionen durch das verstärkte Auftreten von PR signifikante Ergänzungen und Umschreibungen auf, schreibt Donsbach (vgl. 2004: 80). Eine praxisorientierte Definition aus den frühen 1980er Jahren bezeichnet Mitarbeiter in Pressestellen als Journalisten. Nach Weischenberger sammeln, selektieren Journalisten hauptberuflich und produzieren Nachrichten und Meldungen: seien es nun fest angestellte oder freie Mitarbeiter in Presse, Rundfunk, Nachrichtenagenturen oder Pressestellen von Politik, Interessensverbänden oder Privatwirtschaft (vgl. Weischenberger 1981: 96). Die Kommunikations- und Informationsleistung als Interessensvertreter wird noch nicht von der als Mitarbeiter bei Presse, Rundfunk und Nachrichtenagenturen getrennt. Dies ändert sich in den folgenden Jahren signifikant.
„Die im Grundgesetzt der Bundesrepublik verbürgte Pressefreiheit schließt die Unabhängigkeit und Freiheit der Informationen, der Meinungsäußerung und der Kritik ein. Verleger, Herausgeber und Journalisten müssen sich bei Ihrer Arbeit der Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit und ihrer Verpflichtung für das Ansehen der Presse bewusst sein. Sie nehmen ihre Publizistische Aufgabe fair, nach bestem Wissen und Gewissen, unbeeinflusstvon persönlichen Interessen undsachfremden Beweggründen wahr." (Deutscher Presserat 2008)
Die Präambel des Pressekodex des deutschen Presserats öffnet deutlich mit einer Formulierung, welche „Verpflichtungen“ gegenüber der Öffentlichkeit bzw. den Bürgern betont. Publizistisch Tätige dürfen sich nicht bewusst von partikulären Interessensvertretern (seien es nun politische, private, wirtschaftliche) beeinflussen lassen. Oberstes Gebot sei die Wahrheit und dessen Achtung. Schaffer (2010) kontrastiert diese Forderung mit Ergebnissen aus der Journalismusforschung und der Kommunikationswissenschaft. Er geht auf den Einfluss herrschender Blattlinien und den Einfluss des Nachrichtenwerts ein. „Informelleübereinkünfte“ innerhalb der Redaktionen oder Medieninstitutionen führen zu Blattlinien, welche bestimmen, wie journalistische Akteure (Redakteure) mit Informationen (der PR) umgehen (vgl. ebenda: 12). Mit Schmidt und Zurstiege (2007: 14ff.) muss Journalismus aus wissenschaftlicher Perspektive auch immer unter der Einordnung in ein Gesamtsystem (Einfluss gesellschaftlicher Rahmenbedingungen auf das Mediensystem und das Teilsystem Journalismus) betrachtet werden. Sie sprechen von einer „Medienkulturgesellschaft", in der sich Journalismus und Public Relations nur auf der Basis eines gemeinsamen Kulturbegriffs und dem dazugehörigen kollektiven Wissen austauschen können (ebenda: 143f.). Weisc]henbergers „Zwiebelmodell" definiert diese Umgebung des Journalismus in vier Kontexten. Akteure des Systems müssen sich mit Normen, Strukturen, Funktionen arrangieren und in Rollen behaupten (vgl. Weischenberger 1992/2004: 40ff.)
So stellt sich abschließend die Frage, in wieweit Journalisten Ereignisse durch ihre publizistische Aufbereitung erschaffen (Schulz) und als Gatekeeper agieren? Oder ob die zunehmend verständnisorientiert arbeitende PR und die mit besonders viel Nachrichtenwert ausgestatteten Informationen ihrer Akteure Events erst auf die journalistische Agenda setzten? Diesem Verhältnis trägt die Auffassung des Journalismus als „diskursivem Journalismus“ Rechnung. Burkart bezeichnet Journalisten als „professionelle Zweifler“, welche per se an kommunikativen Geltungsansprüchen zweifeln (vgl. Burkart 1998: 171f.). Er interpretiert dieses Verhalten als eine „logische Reaktion auf die zunehmend verständigungsorientierte Ausrichtung der PR“ (Schaffner 2010: 17).
Die Interdependenzthese
Die These stellt den frühsten theoretischen Ansatz zur Erforschung des Verhältnisses von Public Relations und Journalismus dar, vor dem Hintergrund einer wechselseitigen Beeinflussung. Sie markiert einen Paradigmenwechsel in der Betrachtung des Verhältnisses der beiden Systeme, welcher die Gedanken zu der Debatte seit den 1990er Jahren prägt. Die Annahme einer Gegen- oder Wechselseitigkeit kennzeichnet denübergang von der Determination (vgl. Baerns 1985/1991) zur Interdependenz. Grossenbacher fordert, Medien und PR als interdependente Systeme bzw. Komplementärsysteme in Abhängigkeit (Grossenbacher 1986: 730) aufzufassen. Schönhagen (2008) schreibt in seinem „ersten Beitrag zu systematischen Aufarbeitung des Verhältnisses von Public Relations und Journalismus“ in Rückgriff auf Grossenbacher: „Das Verhältnis von Public Relations (PR) und Journalismus wird heute meist als Beziehung »interdependente[r] Systeme« konzipiert“ (vgl. ebenda: 9). Hauptvertreter der These sind Ronneberger und Saxer. Die Interdependenzthese berücksichtigt beide Systemperspektiven gleichermaßen. Zentrale Aspekte sind die als „symbiotischer Charakter“ bzw. „Parallelstrukturen" definierten Beziehungen. Sie werden von Saxer (1981: 505f.) als die Informationsleistungen seitens der PR und im Gegenzug die Orientierungsleistungen und Beschaffung von Publizität durch das journalistische System benannt. Ronneberger (1983: 264) verweist auf die Janusköpfigkeit der Beziehungen hin. Er spricht sowohl von „symbiotischen“ (siehe oben) als auch vom „konfliktären Charakter“. Als einen möglichen konfliktären Zug nennt Saxer den „investigative(n) Journalismus, der in den Umweltsystemen Skandale thematisiert und damit zu einer Labilisierung dieser Systeme“ beitrage (Hoffjann 2001: 137). Saxer betont, dass die von Grossenbacher 1986 erkannte Wechsel- bzw. gegenseitige Abhängigkeit sich zunehmend steigert (vgl. Saxer 1998: 64).
Die Interdependenzthese bildet einen Vorläufer sowohl Intereffikations- als auch zum Interpenetrationsmodell[7]. „In diesem Zusammenhang ist bei (Schönhagen 2008: 9) von einer »ko-evolutive[n] Entwicklung von Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit« die Rede, die »bislangnichtsystematisch verfolgt« wurde (Löffelholz 2004: 472).“
[...]
[1] Diese Arbeit verwendet den englischen Fachausdruck Public Relations. Ausnahme bilden Zitate oder Paraphrasen, in denen der Begriff der Öffentlichkeitsarbeit benutzt wurde. Die beiden Begriffe werden im Rahmen der Arbeit synonym verwendet.
[2] Wie später von Schantel gezeigt wird, ist die Definition und Legitimation der PR als eigenständiges System (im Sinne der Systemtheorie] ein einflussreicher Grund für die bedingte Aussagekraft und Reichweite mancher Modellierungen der hier untersuchten intersystematischen (Wechsel-] Beziehungen.
[3] Quelle: http://www.pr-woerterbuch.de/wiki/index.php/PR-Definition, besucht am 07.01.2011.
[4] Quelle: http://www.pr-woerterbuch.de/wiki/index.php/PR-Definition, besucht am 07.01.2011.
[5] Quelle: http://www.pr-woerterbuch.de/wiki/index.php/PR-Definition, besucht am 07.01.2011.
[6] Vgl. ebenda.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Forschungsinteresse dieses Textes?
Das Forschungsinteresse dieser Arbeit liegt in der Untersuchung gegenwärtiger kommunikationswissenschaftlicher Theorieansätze, die versuchen, die Beziehungen zwischen Public Relations (PR) und Journalismus zu objektivieren. Dabei werden die Herkunft, Überprüfbarkeit, Tragfähigkeit und Reichweite verschiedener Ansätze beleuchtet. Die Arbeit untersucht auch, welche Theorien (System-, Handlungs-, Akteurstheorie) den Aufbau der Modelle beeinflusst haben und inwieweit die Modelle empirisch überprüfbar sind.
Was ist die Gegenstandsbeschreibung der PR laut diesem Text?
Der Text beschreibt, dass eine systematische Definition von PR schwierig ist, da es eine Vielzahl von Definitionen gibt. PR wird als Management von Informations- und Kommunikationsprozessen zwischen Organisationen und ihren Umwelten beschrieben, mit Funktionen wie Information, Kommunikation, Persuasion, Imagegestaltung, Vertrauenserwerb, Konfliktmanagement und Konsensherstellung. Neuere Definitionen betonen das Differenzmanagement zwischen Fakt und Fiktion durch Kommunikation in zeitlicher, sachlicher und sozialer Perspektive.
Wie wird der Journalismus in diesem Text beschrieben?
Der Text beschreibt, dass Journalismusdefinitionen seit 1990 durch das verstärkte Auftreten von PR signifikante Ergänzungen erfahren haben. Journalisten sammeln, selektieren und produzieren Nachrichten, wobei die Unabhängigkeit und Freiheit der Information im Grundgesetz verankert ist. Die publizistische Aufgabe soll fair und unbeeinflusst von persönlichen Interessen wahrgenommen werden. Der Text geht auch auf den Einfluss von Blattlinien und Nachrichtenwerten ein und betrachtet Journalismus als Teil eines Gesamtsystems (Medienkulturgesellschaft).
Was ist die Interdependenzthese?
Die Interdependenzthese ist ein früher theoretischer Ansatz zur Erforschung des Verhältnisses von PR und Journalismus vor dem Hintergrund einer wechselseitigen Beeinflussung. Sie geht von einer Interdependenz zwischen den Systemen aus und betont symbiotische und konfliktäre Beziehungen. PR leistet Informationsleistungen, während der Journalismus Orientierungsleistungen und Publizität beschafft.
Welche anderen Modelle werden im Text erwähnt?
Neben der Interdependenzthese werden auch das Intereffikationsmodell und das Interpenetrationsmodell erwähnt. Die Interdependenzthese wird als Vorläufer dieser beiden Modelle betrachtet.
Was sind die Schlussbetrachtungen des Textes?
Die Schlussbetrachtungen beinhalten ein Resümee und formulieren mögliche Schritte zu einer weiterführenden Ausarbeitung der theoretischen Ansätze intersystematischer Beziehungen von PR und Journalismus.
Welche Kritik wird an den PR Definitionen geübt?
Die Kritiken an den Definitionen besagen, dass diese nicht abschließend definiert werden können, und mit der Zeit verlieren ethische Appelle an Definitionskraft, nähmlich zugunsten eines dynamischen Verständnisses des Managements von Kommunikation, mit dem Wirklichkeiten (im Hinblick auf unterschiedliche Zielgruppen) modelliert werden.
Was ist die Interdependenzthese?
Die Interdependenzthese stellt den frühsten theoretischen Ansatz zur Erforschung des Verhältnisses von Public Relations und Journalismus dar, vor dem Hintergrund einer wechselseitigen Beeinflussung. Sie markiert einen Paradigmenwechsel in der Betrachtung des Verhältnisses der beiden Systeme, welcher die Gedanken zu der Debatte seit den 1990er Jahren prägt. Die Annahme einer Gegen- oder Wechselseitigkeit kennzeichnet denübergang von der Determination zur Interdependenz.
- Citation du texte
- Dirk Kuntze (Auteur), 2011, Actio et Reactio - Interdependenz, -effikation und -penetration bei PR und Journalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166900