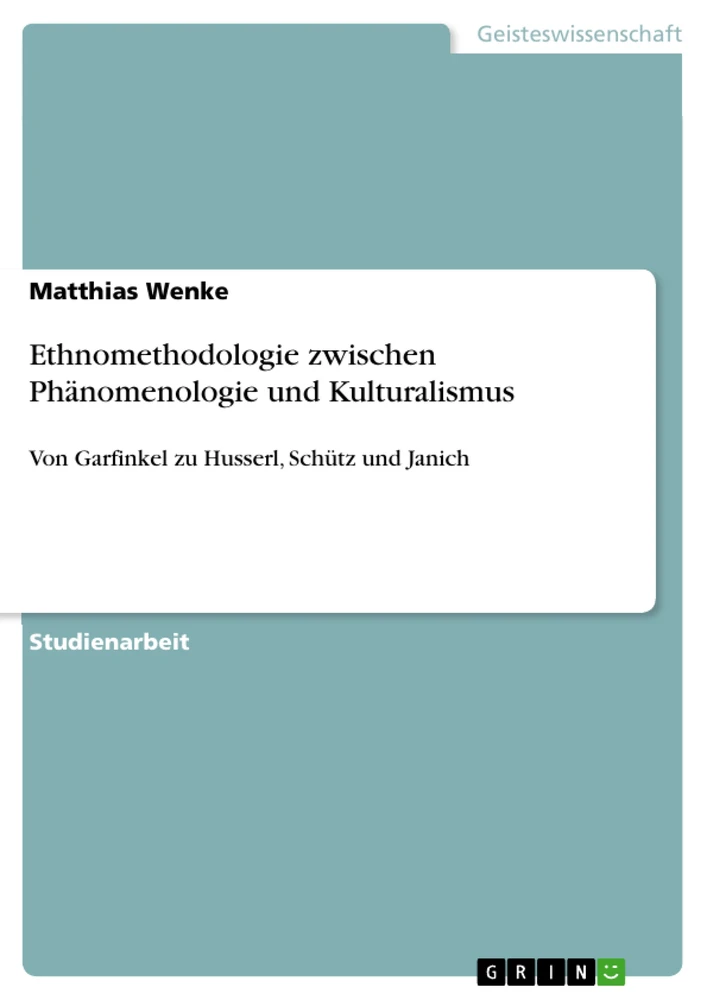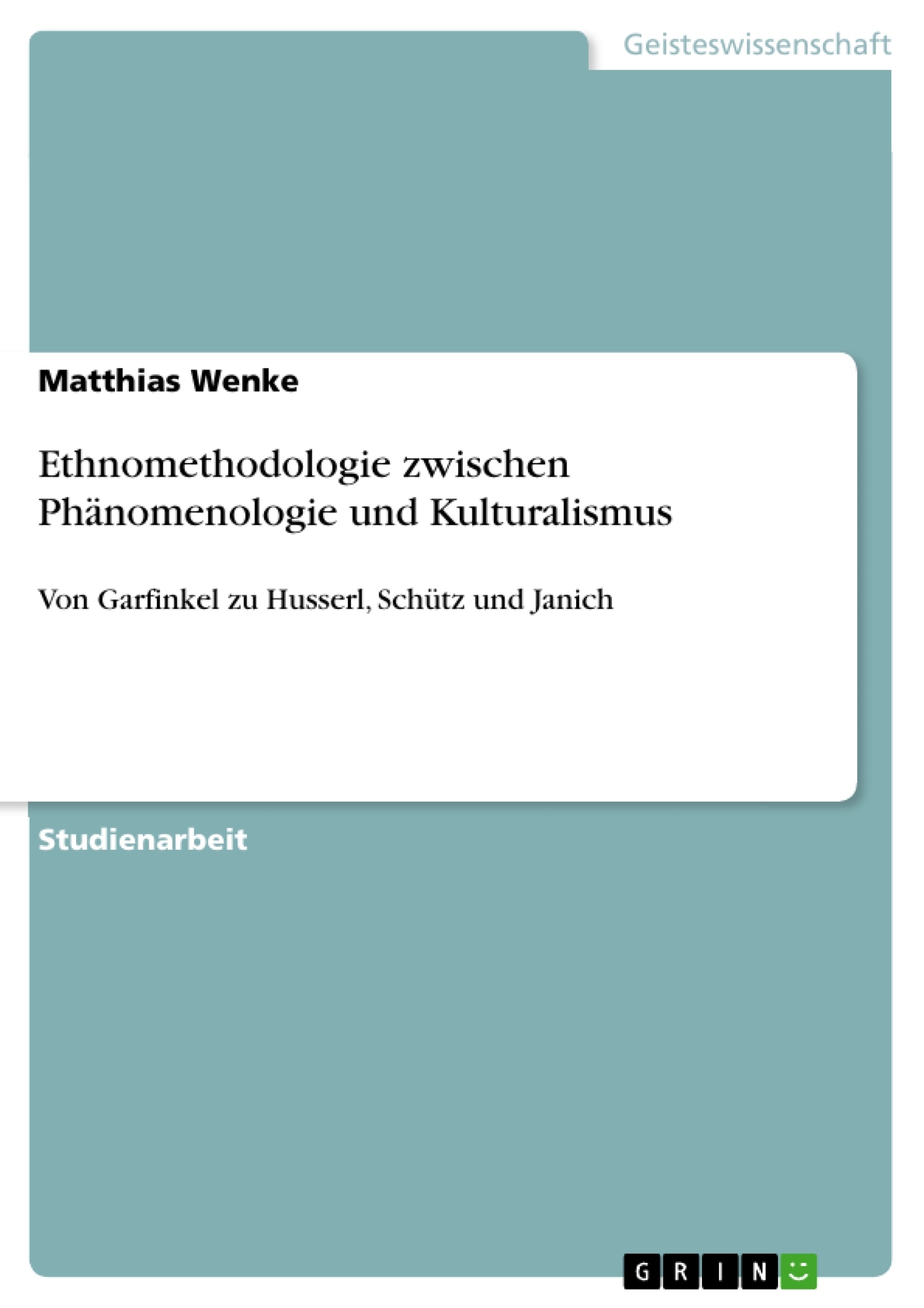Kernpunkte von Harold Garfinkels Ethnomethodologie und Querverbindungen zu Edmund Husserls Phänomenologie und dem Methodischen Konstruktivismus von Peter Janich.
Einen Zugang zur ethnomethodologischen Haltung kann man gewinnen, wenn man sich mit ihren philosophischen Wurzeln beschäftigt. Da LANGSDORF (1995, 180) annimmt, "that Garfinkels program carries out Husserls program", skizziert der Text zunächst die Phänomenologie HUSSERLs und dann SCHÜTZ´ Betrachtungen über "The Problem of Rationality in the Social World" (1943). Ethnomethodologie lässt sich als Lebensweltwissenschaft im HUSSERLschen Sinne verstehen und wird als Brücke zu JANICHs (1996) Wissenschaftstheorie des Methodischen Konstruktivismus genutzt, welche die Naturwissenschaften aus ihrer vermeintlich transzendenten Objektivität wieder an ihre Wurzeln in der Praxis rückbinden möchte.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung: Ethnomethodologie - ein Vakuum für Theoriebasteleien?
- 1. Husserl und Schütz - Wegbereiter der Ethnomethodologie..
- 1.1. Husserl's Phänomenologie
- 1.2. Schütz: Rationalität und Lebenswelt...
- 2. Ethnomethodologie - eine Methode für alle Methoden?
- 2.1. Grundsätzliches...
- 2.2. Spezielle Probleme..
- 2.2.1. Das Coroner-Problem....
- 2.2.2. Das Relativismus-Problem...
- 2.2.3. Das Rashomon-Problem...
- 2.3. Telefonläuten, Klatschen, ein Pulsar und GALILEIs schiefe Ebene..
- 2.3.1. Telefonläuten, Takt und Rhythmus...
- 2.3.2. Die Entdeckung eines Pulsars und GALILEIs schiefe Ebene..
- 3. Methodischer Konstruktivismus - ein Anschluss.
- 4. Schluss: Ethnomethodologie als Lebensweltwissenschaft...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Ethnomethodologie und untersucht ihre philosophischen Wurzeln in der Phänomenologie. Die Zielsetzung ist es, die Ethnomethodologie als Lebensweltwissenschaft zu begreifen und einen Bezug zum Methodischen Konstruktivismus herzustellen.
- Die Rolle der Phänomenologie in der Ethnomethodologie
- Die Bedeutung der Lebenswelt für die Ethnomethodologie
- Der methodische Konstruktivismus als Anschluss an die Ethnomethodologie
- Die Ethnomethodologie als Methode der Ordnungskonstitution
- Die Grenzen der Ethnomethodologie
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Entstehung der Ethnomethodologie und zeigt, wie sie sich von klassischen soziologischen Ansätzen unterscheidet. Es wird hervorgehoben, dass die Ethnomethodologie sich auf die praktische Ebene der Lebenswelt konzentriert und die Methoden der Ordnungskonstitution von Gesellschaftsmitgliedern untersucht.
Das zweite Kapitel beleuchtet die philosophischen Wurzeln der Ethnomethodologie in der Phänomenologie von Edmund Husserl und Alfred Schütz. Es wird gezeigt, wie die Phänomenologie die Grundlage für die Ethnomethodologie liefert, indem sie die Bedeutung des Bewusstseins und der Lebenswelt für das Verstehen sozialer Prozesse betont.
Das dritte Kapitel widmet sich der Ethnomethodologie als Methode. Es werden die zentralen Prinzipien der Ethnomethodologie erläutert und anhand von Beispielen illustriert. Außerdem werden die Grenzen und Herausforderungen der Ethnomethodologie als Methode diskutiert.
Schlüsselwörter
Ethnomethodologie, Phänomenologie, Lebenswelt, Methodischer Konstruktivismus, Ordnungskonstitution, soziale Praxis, Bewusstsein, Alltag, Interpretation, Sinnkonstruktion, Methode, Forschung, Harold Garfinkel, Edmund Husserl, Alfred Schütz, Michael Polanyi, Thomas Luckmann.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern der Ethnomethodologie nach Harold Garfinkel?
Die Ethnomethodologie untersucht die Methoden und Praktiken, mit denen Menschen in ihrem Alltag soziale Ordnung herstellen und verständlich machen.
Wie hängen Phänomenologie und Ethnomethodologie zusammen?
Garfinkels Programm basiert stark auf Edmund Husserls Phänomenologie und Alfred Schütz' Analysen der Lebenswelt, indem es soziale Prozesse als Ergebnis von Bewusstsein und Interpretation betrachtet.
Was ist das „Coroner-Problem“ in der Ethnomethodologie?
Es beschreibt die Problematik, wie offizielle Berichte (z. B. eines Leichenbeschauers) eine soziale Realität erst durch ihre spezifischen Dokumentationspraktiken konstruieren.
Was bedeutet „Methodischer Konstruktivismus“ in diesem Kontext?
Der Text nutzt Ethnomethodologie als Brücke zu Janichs Theorie, um zu zeigen, dass auch Naturwissenschaften in der alltäglichen Praxis und menschlichen Handlungen verwurzelt sind.
Welche Rolle spielt die „Lebenswelt“?
Die Lebenswelt ist der vorwissenschaftliche Boden aller Erfahrungen. Die Ethnomethodologie versteht sich als Lebensweltwissenschaft, die den Alltag ernst nimmt.
- Quote paper
- M.A. Matthias Wenke (Author), 2005, Ethnomethodologie zwischen Phänomenologie und Kulturalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166915