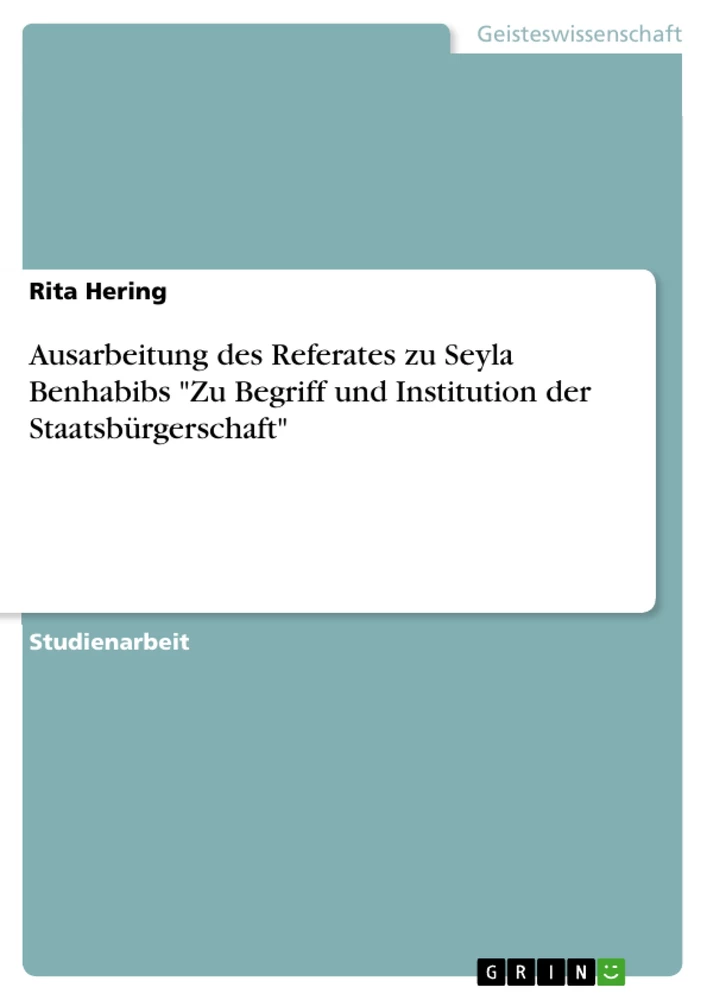Seyla Benhabib stellt im dritten Kapitel „Zu Begriff und Institution der Staatsbürgerschaft“, in: dies., Kulturelle Vielfalt und demokratische Gleichheit. Partizipation im Zeitalter der Globalisierung drei Hauptthesen auf.
Ihre erste These lautet, dass es eine Asymmetrie zwischen Staatsbürgern und Nichtstaatsbürgern gibt, die sich vor allem auf die politischen Mitbestimmungsrechte bezieht (ebd., S. 80). Weiterhin geht sie von einer Kluft zwischen Ausländern aus, die zwischen EU-Mitgliedern und solchen, die Nicht-EU-Mitglieder sind besteht. Aus diesen beiden Thesen und ihrer Darstellung des Ist-Zustandes, in der sie die historische Entwicklung der Staatsbürgerschaft vor allem in Europa betrachtet, kommt sie zu der schlussfolgernden These, dass das Modell der Staatsbürgerschaft aus normativer Perspektive neu überdacht werden muss, da die drei grundsätzlichen Prinzipien, nämlich das der Abstammung, das Territorialprinzip und das Konsensprinzip, wie die Staatsbürgerschaft erworben werden kann, nicht mehr zeitgemäß sind.
Inhaltsverzeichnis
- Hauptthesen
- Darstellung des Ist-Zustandes
- Komponenten der Staatsbürgerschaft
- Erwerb der Staatsbürgerschaft
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Seyla Benhabibs Analyse der Staatsbürgerschaft im Kontext der Globalisierung zielt darauf ab, die Asymmetrie zwischen Staatsbürgern und Nicht-Staatsbürgern aufzuzeigen und die Notwendigkeit einer Neubestimmung des Staatsbürgerschaftskonzepts zu argumentieren.
- Die Asymmetrie zwischen Staatsbürgern und Nicht-Staatsbürgern im Hinblick auf politische Mitbestimmungsrechte
- Die Kluft zwischen EU-Mitgliedsstaaten und Nicht-EU-Mitgliedsstaaten in Bezug auf die Staatsbürgerschaft
- Die Spannungsfelder zwischen universalistischen Menschenrechten und partikularistischen Forderungen nach nationaler Souveränität
- Die Herausforderungen der globalen Entwicklung für das traditionelle Staatsbürgerschaftsmodell
- Die Notwendigkeit eines neuen Systems der Staatsbürgerschaft, das die Aspekte der transnationalen Staatsbürgerschaft berücksichtigt
Zusammenfassung der Kapitel
1. Hauptthesen
Benhabib stellt drei Hauptthesen auf, die die Asymmetrie zwischen Staatsbürgern und Nicht-Staatsbürgern im Kontext der Globalisierung beleuchten. Sie argumentiert, dass das traditionelle Staatsbürgerschaftsmodell aus normativer Perspektive neu überdacht werden muss, da die drei Prinzipien der Abstammung, des Territorialprinzips und des Konsensprinzips nicht mehr zeitgemäß sind.
2. Darstellung des Ist-Zustandes
Benhabib analysiert die Entwicklung der Staatsbürgerschaft in Europa anhand von Verträgen und Abkommen wie dem Maastrichter Vertrag, dem Schengener Abkommen und dem Dubliner Übereinkommen. Sie zeigt, dass diese Abkommen zu einer Zweiklassen-Gesellschaft von Ausländern führen, die sich in EU-Mitgliedern und Nicht-EU-Mitgliedern unterscheiden.
3. Komponenten der Staatsbürgerschaft
Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Komponenten der Staatsbürgerschaft und analysiert, wie diese im Kontext der Globalisierung neu definiert werden müssen. Benhabib betont die Bedeutung von Menschenrechten und der Partizipation am Staat durch Zugehörigkeit zum Staatswesen.
4. Erwerb der Staatsbürgerschaft
Dieses Kapitel behandelt die verschiedenen Wege zum Erwerb der Staatsbürgerschaft und kritisiert die bestehenden Verfahren als ungerecht und nicht mehr zeitgemäß. Benhabib argumentiert, dass ein neues System geschaffen werden muss, das die Herausforderungen der Globalisierung berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Staatsbürgerschaft, Globalisierung, Menschenrechte, nationale Souveränität, transnationale Staatsbürgerschaft, Asymmetrie, EU-Staatsbürgerschaft, Asylrecht und Integration.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthesen von Seyla Benhabib zur Staatsbürgerschaft?
Benhabib argumentiert, dass eine Asymmetrie zwischen Staatsbürgern und Nicht-Staatsbürgern besteht und dass das traditionelle Modell (Abstammung, Territorium, Konsens) im Zeitalter der Globalisierung normativ neu überdacht werden muss.
Welche Kluft besteht zwischen EU- und Nicht-EU-Ausländern?
Durch Verträge wie Maastricht und Schengen ist eine Zweiklassen-Gesellschaft entstanden, in der EU-Bürger innerhalb der Union deutlich mehr Rechte genießen als Drittstaatsangehörige.
Warum sind die klassischen Prinzipien des Staatsbürgerschaftserwerbs veraltet?
Die Prinzipien der Abstammung und des Territoriums stoßen durch die globale Mobilität und transnationale Lebensrealitäten an Grenzen und führen oft zu politischer Exklusion.
Wie beeinflusst die Globalisierung das Konzept der nationalen Souveränität?
Es entsteht ein Spannungsfeld zwischen universalistischen Menschenrechten, die für alle gelten, und partikularistischen Forderungen souveräner Staaten, den Zugang zur Bürgerschaft selbst zu kontrollieren.
Was versteht Benhabib unter transnationaler Staatsbürgerschaft?
Es ist ein System, das politische Partizipation und Rechte über nationale Grenzen hinweg ermöglicht und der Realität einer vernetzten Welt gerecht wird.
- Quote paper
- Rita Hering (Author), 2009, Ausarbeitung des Referates zu Seyla Benhabibs "Zu Begriff und Institution der Staatsbürgerschaft", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166922