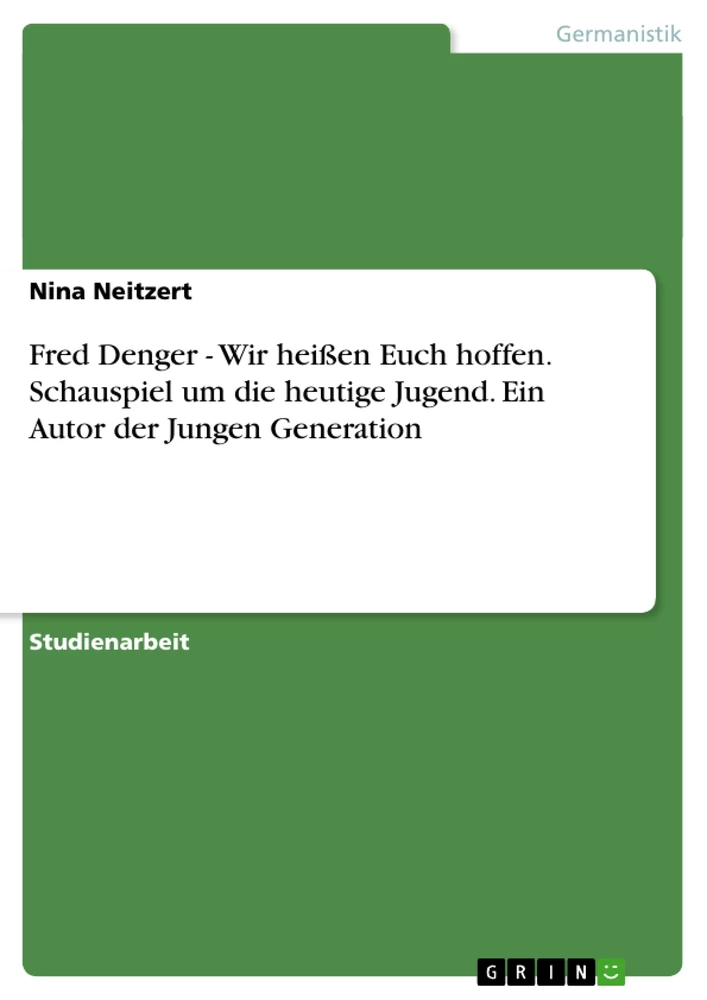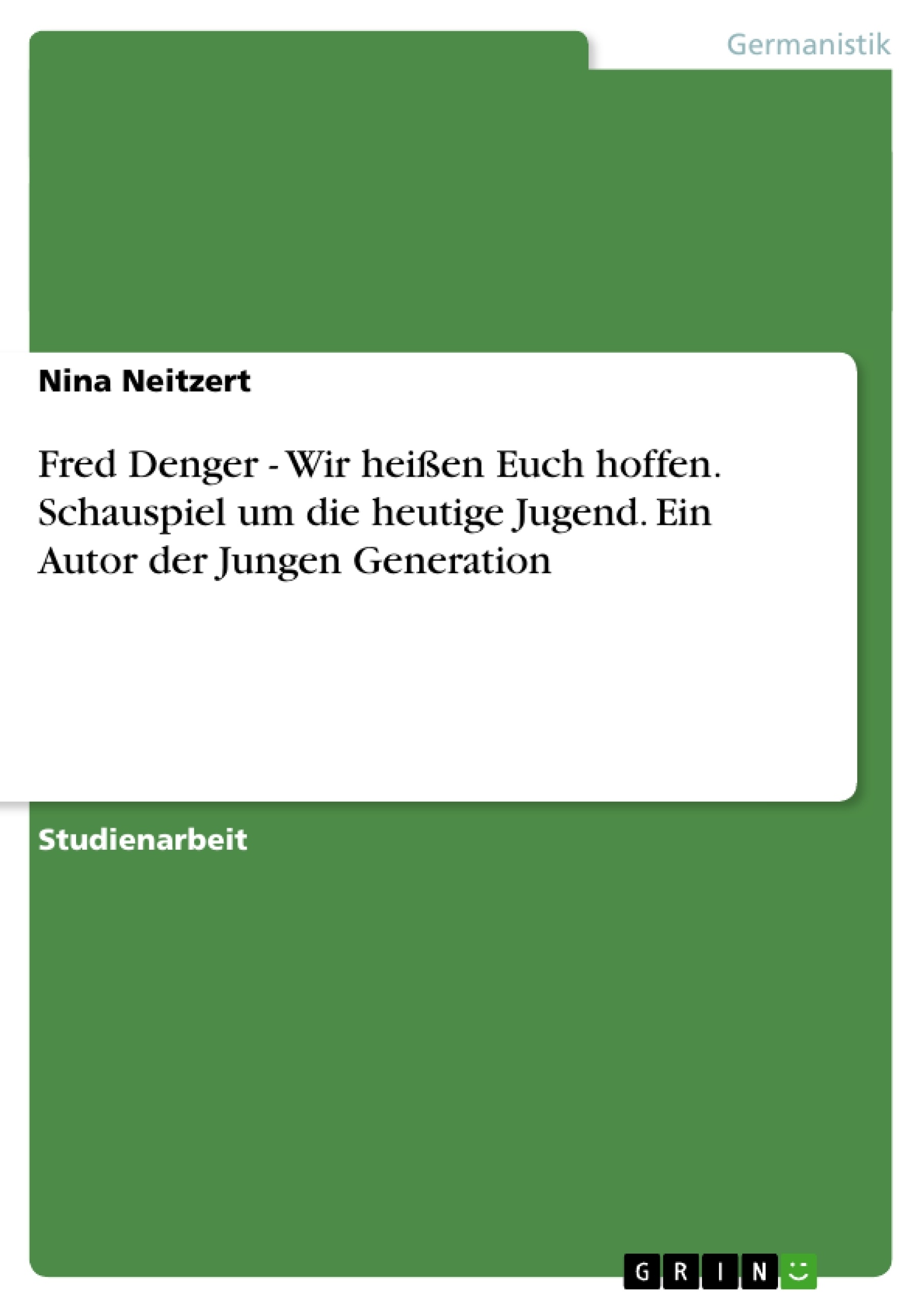Der Zusammenbruch des Dritten Reiches wird oft als die sogenannte “Stunde Null” bezeichnet.
Wie die nachfolgenden Entwicklungen jedoch gezeigt haben, kann nicht in dem
Verständnis von einem Neubeginn gesprochen werden, dass nun etwas vollkommen Neues
und noch nie Gewesenes seinen Anfang nahm, auch wenn dieses Gefühl bei vielen Zeitgenossen
vorherrschend gewesen sein mag. Kontinuitätslinien aus der Zeit des Nationalsozialismus
in das Nachkriegsdeutschland lassen sich in vielen Bereichen des öffentlichern, wie
auch des kulturellen Lebens nachweisen. Nur die Spitze des Eisberges bildeten hier die
engsten und als „tief braun“ geltenden Mitarbeiter Konrad Adenauers, wie zum Beispiel
Theodor Oberländer, Bundesvertriebenenminister von 1953 bis 1969, und Hans Maria
Globke, Oberregierungsrat im Innenministerium, die bereits eine nationalsozialistische Karriere
hinter sich hatten.1 Bis zur deutsch-deutschen Wiedervereinigung und dem Ende des
Kalten Krieges 1989 wird die bedingungslose Kapitulation von der deutschen Bevölkerung
als etwas sehr Zwiespältiges wahrgenommen, wie Theodor Heuß bereits 1949 bemerkte:
„Im Grunde genommen bleibt dieser 8.Mai 1945 die tragischste und fragwürdigste Paradoxie der Geschichte
für jeden von uns. Warum denn? Weil wir erlöst und vernichtet in einem gewesen sind.“2
Die Bewertung der jüngsten Vergangenheit wird zum Problem einer ganzen Gesellschaft
und führt den Bruch zweier Generationen herbei, wie Hans Werner Richter in seinem Artikel
„Warum schweigt die junge Generation“ in der Zeitung „Der Ruf“ zum Ausdruck
bringt:
„In Deutschland redet eine Generation, und in Deutschland schweigt eine Generation. [...]
1 Theodor Oberländer war im dritten Reich überzeugter Nationalsozialist, während es sich bei Hans Maria
Globke um den Kommentator der Nürnberger Rassengesetze. Vgl. dazu Glaser, Hermann: Deutsche Kultur.
Ein historischer Überblick von 1945 bis zur Gegenwart. München/ Wien 1997. S.190.
2 Zitiert nach Glaser. S.29f.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Fred Dengers Wir heißen Euch hoffen. Schauspiel um die heutige Jugend.
- 1. Autor und Werk
- 1.1. Zum Autor
- 1.2. Inhaltszusammenfassung
- 1.3. Aufbau
- 2. Zeitgenössische Rezeption im Spiegel der Theatersituation nach 1945
- 2.1. Das Theater als Ort der moralischen Erneuerung
- 2.2. Der Erfolg von Fred Dengers Zeitstück
- 3. Wir heißen Euch hoffen als Heimkehrerdrama
- 3.1. Kriegsfolgen
- 3.2. Jugendliche Heimkehrer in Fred Dengers Stück
- 4. Das Wandlungsdrama
- 4.1. Das Prinzip Hoffnung
- 4.2. Liebe und Wandlung
- 5. Der Generationskonflikt
- 5.1. Die Führerschaft der „älteren“ Generation
- 5.2. Die verschiedenen Generation in Wir heißen Euch hoffen
- 6. Die Junge Generation in Claires Traum
- 6.1. Der Traum
- 6.2. Claires Kindheitsverlust
- 6.3. Die Frage der Verantwortung
- 7. Die Sprache der Jungen Generation
- 7.1. Sprachstil
- 7.2. Graphische Gestaltung
- 7.3. Weitere sprachliche Gestaltungselemente
- 7.4. Zusammenfassung
- C. Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Schauspiel „Wir heißen Euch hoffen" von Fred Denger aus dem Jahr 1946. Das Ziel ist, die Rezeption des Stücks im Kontext der Nachkriegszeit zu beleuchten und die spezifischen Herausforderungen der jungen Generation in den Fokus zu rücken.
- Das Schauspiel als Spiegel der unmittelbaren Nachkriegszeit
- Die Darstellung jugendlicher Heimkehrer und ihrer Kriegserfahrungen
- Der Generationskonflikt zwischen den jungen und den älteren Generationen
- Die Suche nach Hoffnung und Sinn in einer zerstörten Welt
- Die Rolle von Liebe und Wandlung in der Bewältigung der Vergangenheit
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit dem Autor Fred Denger und seinem Werk „Wir heißen Euch hoffen". Es wird eine kurze Biografie Dengers sowie eine Inhaltszusammenfassung des Stücks gegeben. Außerdem wird der Aufbau des Stücks analysiert. Der zweite Teil befasst sich mit der zeitgenössischen Rezeption des Stücks im Spiegel der Theatersituation nach 1945. Es wird die Bedeutung des Theaters als Ort der moralischen Erneuerung beleuchtet und der Erfolg von Dengers Stück in der Nachkriegszeit analysiert. Der dritte Teil widmet sich der Interpretation des Stücks als Heimkehrerdrama. Dabei werden die Kriegsfolgen auf die Jugend und die spezifischen Herausforderungen der jugendlichen Heimkehrer in Dengers Stück beleuchtet. Im vierten Teil wird „Wir heißen Euch hoffen" als Wandlungsdrama analysiert. Es wird das Prinzip Hoffnung und die Rolle von Liebe und Wandlung im Stück betrachtet. Der fünfte Teil behandelt den Generationskonflikt im Stück. Dabei werden die Führungsrolle der älteren Generation und die unterschiedlichen Perspektiven der beiden Generationen in „Wir heißen Euch hoffen" untersucht. Der sechste Teil analysiert den Traum von Claire und seine Bedeutung für die Darstellung der jungen Generation. Es werden Claires Kindheitsverlust und die Frage nach der Verantwortung in der Nachkriegszeit diskutiert. Der siebte und letzte Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Sprache der jungen Generation in „Wir heißen Euch hoffen". Es werden der Sprachstil des Stücks, die graphische Gestaltung und weitere sprachliche Gestaltungselemente analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Nachkriegszeit in Deutschland, wie der Bewältigung von Kriegserfahrungen, der Suche nach Identität und der Rolle der Jugend im gesellschaftlichen Umbruch. Weitere wichtige Themen sind die Rezeption von Literatur in der Nachkriegszeit, das Heimkehrerdrama, der Generationskonflikt und die Sprache der jungen Generation. Außerdem werden die Themen Hoffnung, Liebe, Wandlung und Verantwortung im Kontext des Stücks „Wir heißen Euch hoffen" beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Fred Dengers Stück „Wir heißen Euch hoffen“?
Es ist ein Zeitstück von 1946, das die Situation der jungen Generation und jugendlicher Heimkehrer im zerstörten Nachkriegsdeutschland thematisiert.
Was bedeutet der Begriff „Stunde Null“ in diesem Kontext?
Der Begriff beschreibt den Zusammenbruch 1945, wobei das Stück zeigt, dass es trotz des Gefühls eines Neubeginns starke personelle und kulturelle Kontinuitäten gab.
Welcher Generationskonflikt wird im Stück dargestellt?
Es thematisiert das Schweigen der jungen Generation gegenüber der älteren Generation, die die Verantwortung für den Krieg trägt, aber weiterhin Führungsansprüche stellt.
Warum wird das Stück als „Wandlungsdrama“ bezeichnet?
Es zeigt die innere Wandlung der Charaktere durch Liebe und die Suche nach Hoffnung als Mittel zur Bewältigung der traumatischen Vergangenheit.
Welche Rolle spielt das Theater nach 1945?
Das Theater fungierte als Ort der moralischen Erneuerung und bot der Bevölkerung einen Raum zur Auseinandersetzung mit Schuld, Leid und Zukunftsvisionen.
- Quote paper
- Nina Neitzert (Author), 2003, Fred Denger - Wir heißen Euch hoffen. Schauspiel um die heutige Jugend. Ein Autor der Jungen Generation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16696