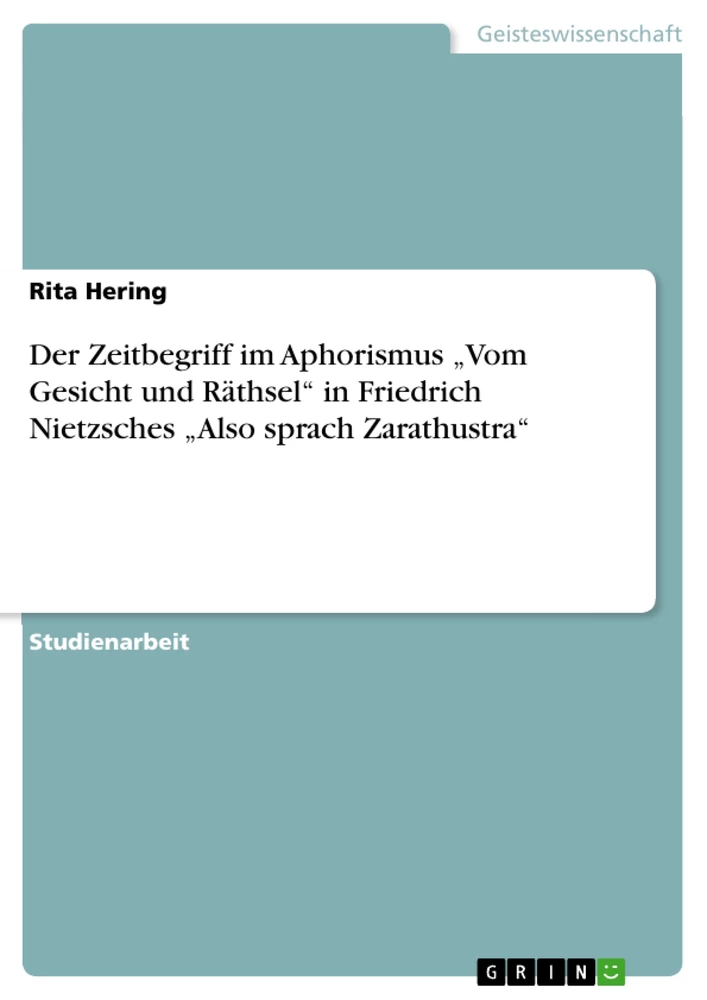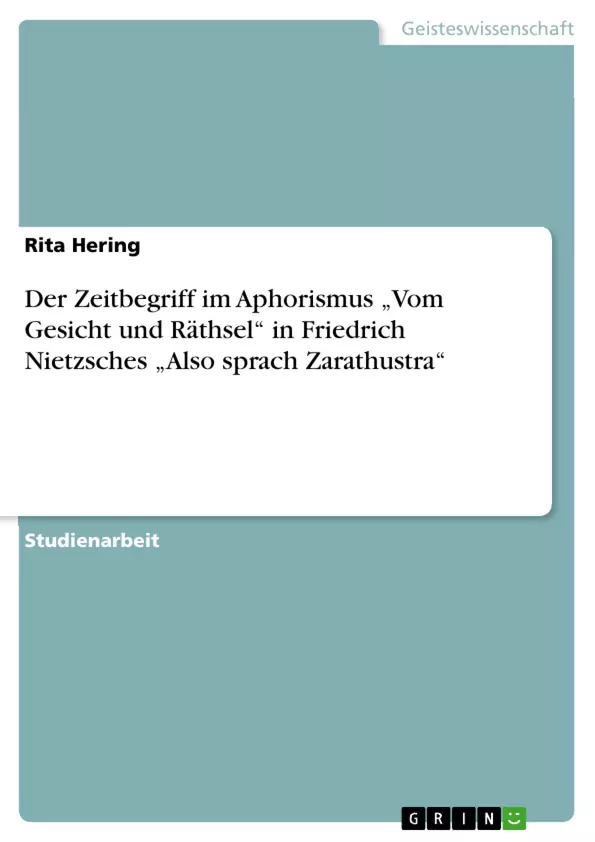Es wird der Versuch unternommen den Aphorismus „Vom Gesicht und Räthsel“ in Friedrich Nietzsches „Also sprach Zarathustra“ in Bezug auf den Begriff der Zeit zu entschlüsseln. Hierzu soll eine kurze Darstellung Friedrich Nietzsches und eine Einbettung in den Historischen Rahmen Hilfe leisten, um zu verdeutlichen unter welchen philosophischen Einflüssen Nietzsche seine Gedankengänge entwickelt.
Auf der einen Seite soll herausgestellt werden, welche Vorstellung Nietzsche von dem Begriff der Zeit hat und wie er das Dasein mit diesem Zeitbegriff verknüpft. Auf der anderen Seite soll geklärt werden, inwiefern sich die Zielsetzung und das Erreichen der Ziele des Lebens durch Nietzsches Zeitbegriff ändern. In diesem Zusammenhang soll erläutert werden, warum der „Augenblick“, der bewusst gelebt werden soll, zum Fokus des Lebens wird und das Streben nach einem Ziel am Ende des Lebens sinnlos zu werden scheint. Hierzu wird der Sisyphosmythos herangezogen, um den Begriff der „ewigen Wiederkehr des Gleichen“ zu verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Rahmen
- Vom Gesicht und Räthsel"
- Der Mythos von Sisyphos
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, den Aphorismus „Vom Gesicht und Räthsel“ in Friedrich Nietzsches „Also sprach Zarathustra“ unter dem Aspekt des Zeitbegriffs zu untersuchen. Dazu wird Nietzsche kurz vorgestellt und in seinen historischen Kontext eingeordnet, um zu verdeutlichen, welche philosophischen Einflüsse seine Denkweise geprägt haben.
- Nietzsches Vorstellung vom Zeitbegriff und seine Verbindung zum Dasein
- Die Auswirkungen von Nietzsches Zeitbegriff auf Lebensziele und deren Erreichung
- Die Bedeutung des bewusst gelebten „Augenblicks“ im Kontext der Sinnlosigkeit des Strebens nach Zielen am Ende des Lebens
- Der Sisyphosmythos als Veranschaulichung des Begriffs der „ewigen Wiederkehr des Gleichen“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung und das Ziel der Arbeit dar. Der „Historische Rahmen“ beleuchtet kurz die wichtigsten philosophischen Einflüsse auf Nietzsches Werk, darunter die Junghegelianer, Arthur Schopenhauer und Richard Wagner.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind Friedrich Nietzsche, „Also sprach Zarathustra“, der Aphorismus „Vom Gesicht und Räthsel“, der Zeitbegriff, die „ewige Wiederkehr des Gleichen“, der Sisyphosmythos und der „Augenblick“ als Fokus des Lebens.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel dieser Arbeit über Nietzsches „Also sprach Zarathustra“?
Die Arbeit versucht, den Aphorismus „Vom Gesicht und Räthsel“ in Bezug auf Nietzsches Zeitbegriff zu entschlüsseln und in seinen historischen Kontext einzuordnen.
Welche Rolle spielt der „Augenblick“ in Nietzsches Philosophie?
Der bewusst gelebte Augenblick wird zum Fokus des Lebens, da das Streben nach fernen Zielen am Lebensende durch Nietzsches Zeitverständnis an Sinn verliert.
Was versteht Nietzsche unter der „ewigen Wiederkehr des Gleichen“?
Es ist die Vorstellung einer zyklischen Zeit, in der sich alle Ereignisse unendlich wiederholen, was in der Arbeit mithilfe des Sisyphosmythos verdeutlicht wird.
Welche historischen Einflüsse prägten Nietzsches Denken?
Wichtige Einflüsse waren die Junghegelianer, Arthur Schopenhauer und Richard Wagner.
Warum wird der Sisyphosmythos in der Arbeit herangezogen?
Der Mythos dient als Veranschaulichung für die Sinnlosigkeit linearen Strebens und die Akzeptanz der ewigen Wiederkehr.
- Quote paper
- Rita Hering (Author), 2009, Der Zeitbegriff im Aphorismus „Vom Gesicht und Räthsel“ in Friedrich Nietzsches „Also sprach Zarathustra“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/166996