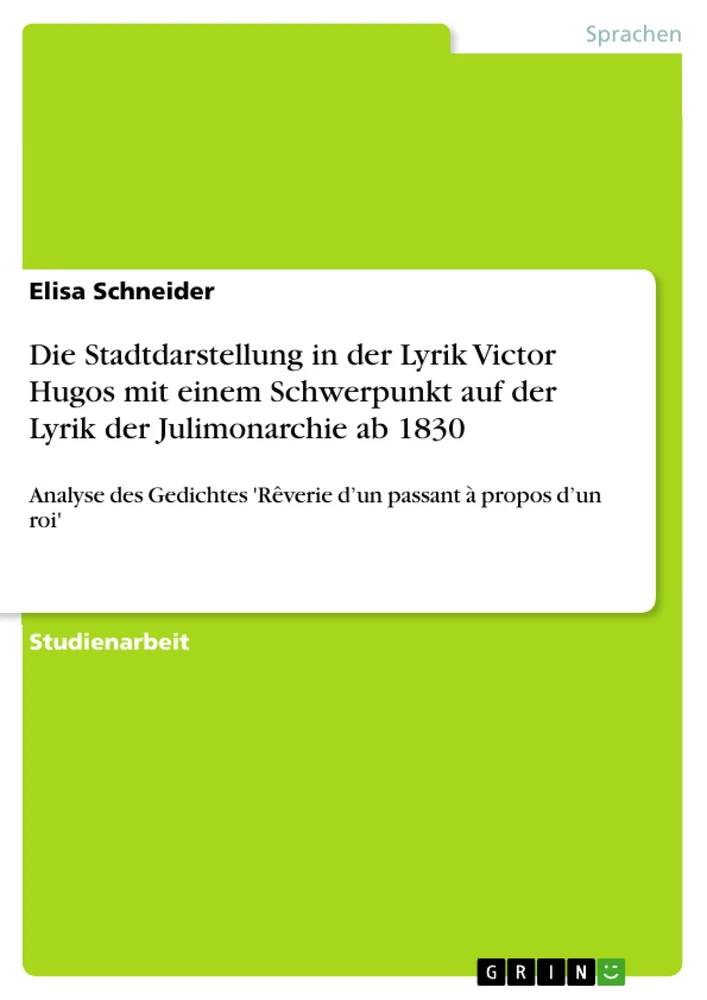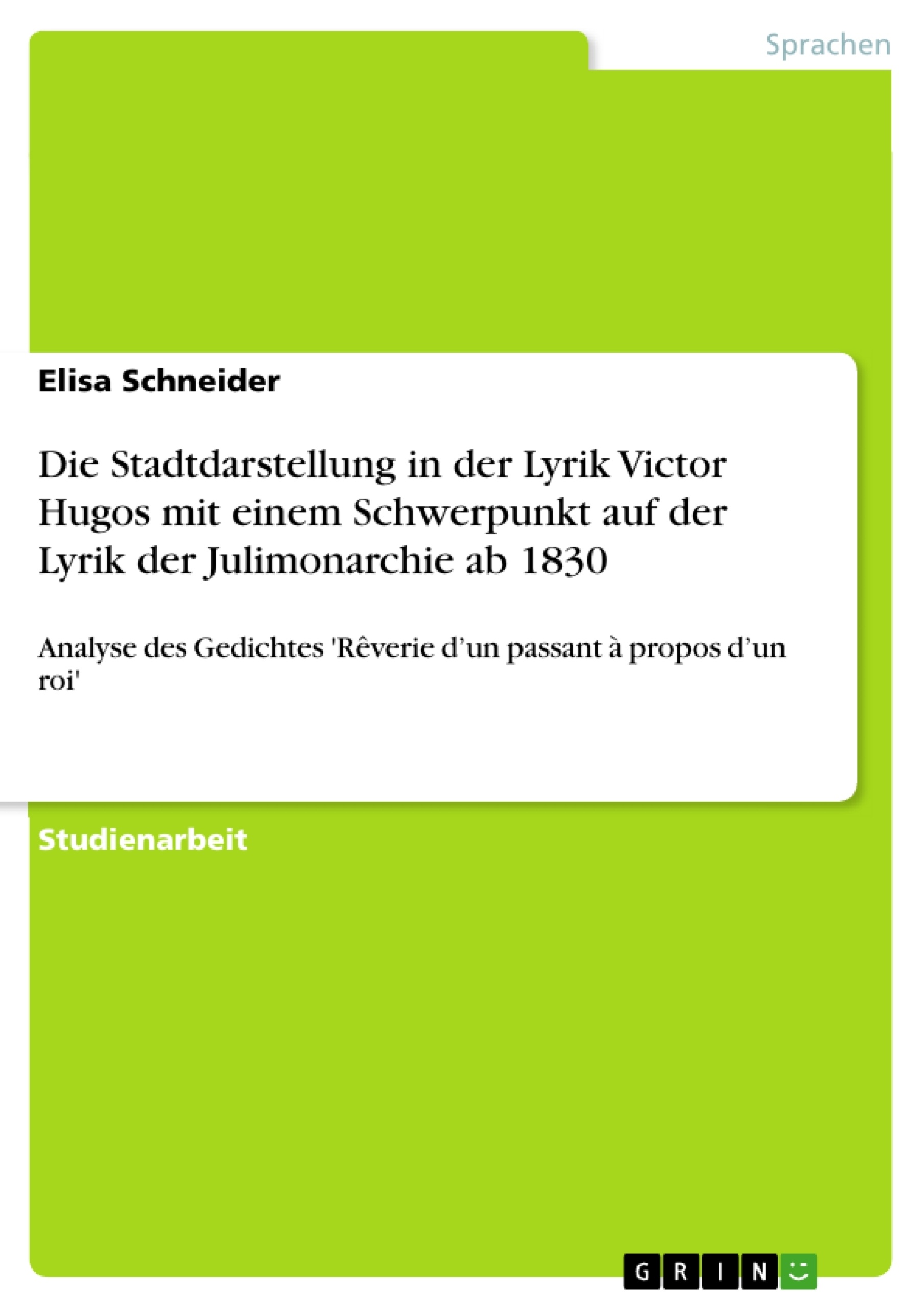Victor Hugo, Autor zwischen Romantik und Moderne, erkennt erstmals das Potenzial der Stadt Paris und beginnt Mitte der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts mit der poetischen Annäherung an das Sujet der Großstadt. Dies geschieht im Spannungsfeld vorherrschender romantischer Universalphilosophie und sich herausbildendem modernem Fortschrittsdenken und Dekadenzbewusstsein, zwischen „romantischem Kontinuitätsdenken und diskontinuierlicher Zeitlichkeit der Moderne.“1 Die Bearbeitung des Themas Großstadt in seiner Stadtlyrik gerät für Hugo unter den epochalen Voraussetzungen zu einer Herausforderung. Inwiefern nimmt Hugo diese Herausforderung an? Wie nähert er sich dem Thema, unter welchen Blickwinkeln betrachtet er die Großstadt? Wie verarbeitet er die Erfahrungen der Großstadt in seiner Lyrik?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Wiedergeburt der Parislyrik
- Überblick über die lyrischen Werke Hugos und Entwicklung der Großstadtlyrik
- Hugo und das zeitgenössische Paris – Die Stadt in der Julimonarchie
- Voraussetzungen
- Das Paris der Julimonarchie in der Darstellung Victor Hugos
- Allgemeine Merkmale
- Analyse des Gedichts « Rêverie d'un passant à propos d'un roi » im Hinblick auf die Darstellung der Stadt
- Zusammenfassung der Ergebnisse der Gedichtanalyse
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Victor Hugos lyrische Darstellung von Paris, insbesondere während der Julimonarchie (1830-1848). Ziel ist es, Hugos Annäherung an das Thema Großstadt im Spannungsfeld von Romantik und Moderne zu beleuchten und seine verschiedenen Reflexionsansätze zu thematisieren. Dabei wird der Einfluss politischer Ereignisse auf sein lyrisches Schaffen berücksichtigt.
- Die Wiedergeburt der Parislyrik im 19. Jahrhundert
- Hugos lyrische Auseinandersetzung mit den positiven und negativen Folgen des Pariser Großstadtwachstums
- Die Entwicklung der Großstadtlyrik in Hugos Werk
- Analyse von Hugos Gedicht « Rêverie d'un passant à propos d'un roi » im Kontext der Julimonarchie
- Die „Lesbarkeit der Stadt“ als zentrales Interpretationsmodell
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Stadtdarstellung in der Lyrik Victor Hugos ein. Sie stellt die Forschungsfrage nach Hugos Annäherung an das Thema Großstadt und seinen verschiedenen Reflexionsansätzen. Der Fokus liegt auf der Großstadtlyrik der Julimonarchie und dem Einfluss politischer Ereignisse. Die Arbeit stützt sich auf das Werk Karlheinz Stierles und das Passagen-Werk von Walter Benjamin, wobei die „Lesbarkeit der Stadt“ als zentrale Denkfigur dient. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit: eine Einführung in die Parislyrik, einen Überblick über Hugos lyrisches Schaffen, eine Betrachtung des Paris der Julimonarchie und eine abschließende Gedichtanalyse.
2. Die Wiedergeburt der Parislyrik: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der Parislyrik im 19. Jahrhundert. Im Gegensatz zum 18. Jahrhundert, wo die Lyrik eine untergeordnete Rolle spielte, gewinnt sie im 19. Jahrhundert, insbesondere im Kontext der sich entwickelnden Großstadt, stark an Bedeutung. Hugo wird als Wegbereiter einer neuen Art der Darstellung der Stadt hervorgehoben. Er präsentiert Paris nicht nur als Kulisse, sondern als eigenständiges Sujet, das sowohl Erhabenheit als auch Abgründigkeit birgt. Das Kapitel betont Hugos Pionierleistung, die moderne Stadt als Erfahrungsraum der Möglichkeiten des Menschen zu begreifen und in der Lyrik fruchtbar zu machen.
3. Überblick über die Werke und die damit verbundene Entwicklung der Großstadtlyrik: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über Hugos lyrisches Werk im Hinblick auf das Thema Großstadt. Es wird deutlich, dass die Großstadt zwar nicht den Hauptfokus von Hugos gesamtem Werk darstellt, aber dennoch in verschiedenen Gedichtbänden, insbesondere in den frühen Werken wie „Odes et ballades“, „Les Orientales“ und „Les feuilles d'automne“, eine zentrale Rolle spielt. Die späteren Gedichtbände konzentrieren sich hingegen auf andere Themen. Das Kapitel unterstreicht die Bedeutung der frühen Gedichtbände für die Entwicklung der Großstadtlyrik bei Hugo.
4. Hugo und das zeitgenössische Paris – Die Stadt in der Julimonarchie: Dieses Kapitel analysiert Hugos Darstellung des Paris der Julimonarchie. Es untersucht die gesellschaftlichen und politischen Voraussetzungen dieser Epoche und deren Einfluss auf Hugos lyrisches Schaffen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse des Gedichts „Rêverie d'un passant à propos d'un roi“, um die wichtigsten Merkmale von Hugos Großstadtlyrik während dieser Periode herauszustellen. Die Kapitel unterstreicht die komplexe Beziehung zwischen Hugo und dem Paris seiner Zeit, die sich in seinen Gedichten manifestiert.
Schlüsselwörter
Victor Hugo, Parislyrik, Julimonarchie, Großstadtlyrik, Romantik, Moderne, Stadtdarstellung, Gedichtanalyse, „Lesbarkeit der Stadt“, Erhabenheit, Abgründigkeit.
Häufig gestellte Fragen zu: Victor Hugos lyrische Darstellung von Paris während der Julimonarchie
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Victor Hugos lyrische Darstellung von Paris während der Julimonarchie (1830-1848). Der Fokus liegt auf seiner Annäherung an das Thema Großstadt im Spannungsfeld von Romantik und Moderne und seinen verschiedenen Reflexionsansätzen, unter Berücksichtigung des Einflusses politischer Ereignisse.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel ist es, Hugos Annäherung an das Thema Großstadt im Spannungsfeld von Romantik und Moderne zu beleuchten und seine verschiedenen Reflexionsansätze zu thematisieren. Der Einfluss politischer Ereignisse auf sein lyrisches Schaffen wird berücksichtigt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Wiedergeburt der Parislyrik im 19. Jahrhundert, Hugos lyrische Auseinandersetzung mit den positiven und negativen Folgen des Pariser Großstadtwachstums, die Entwicklung der Großstadtlyrik in Hugos Werk, eine Analyse von Hugos Gedicht „Rêverie d'un passant à propos d'un roi“ im Kontext der Julimonarchie und die „Lesbarkeit der Stadt“ als zentrales Interpretationsmodell.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was ist deren Inhalt?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Wiedergeburt der Parislyrik, ein Kapitel zum Überblick über Hugos lyrische Werke und die Entwicklung der Großstadtlyrik, ein Kapitel zu Hugo und dem zeitgenössischen Paris während der Julimonarchie (inkl. Gedichtanalyse von „Rêverie d'un passant à propos d'un roi“) und eine Zusammenfassung. Die Einleitung führt in das Thema ein und skizziert den Aufbau. Die Kapitel bieten eine umfassende Analyse von Hugos lyrischem Schaffen im Kontext der Großstadt und der Julimonarchie.
Welches Gedicht wird im Detail analysiert?
Das Gedicht „Rêverie d'un passant à propos d'un roi“ wird im Detail analysiert, um Hugos Darstellung des Paris der Julimonarchie und die wichtigsten Merkmale seiner Großstadtlyrik dieser Periode herauszustellen.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf das Werk Karlheinz Stierles und das Passagen-Werk von Walter Benjamin, wobei die „Lesbarkeit der Stadt“ als zentrale Denkfigur dient.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Victor Hugo, Parislyrik, Julimonarchie, Großstadtlyrik, Romantik, Moderne, Stadtdarstellung, Gedichtanalyse, „Lesbarkeit der Stadt“, Erhabenheit, Abgründigkeit.
- Quote paper
- Elisa Schneider (Author), 2008, Die Stadtdarstellung in der Lyrik Victor Hugos mit einem Schwerpunkt auf der Lyrik der Julimonarchie ab 1830, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167157