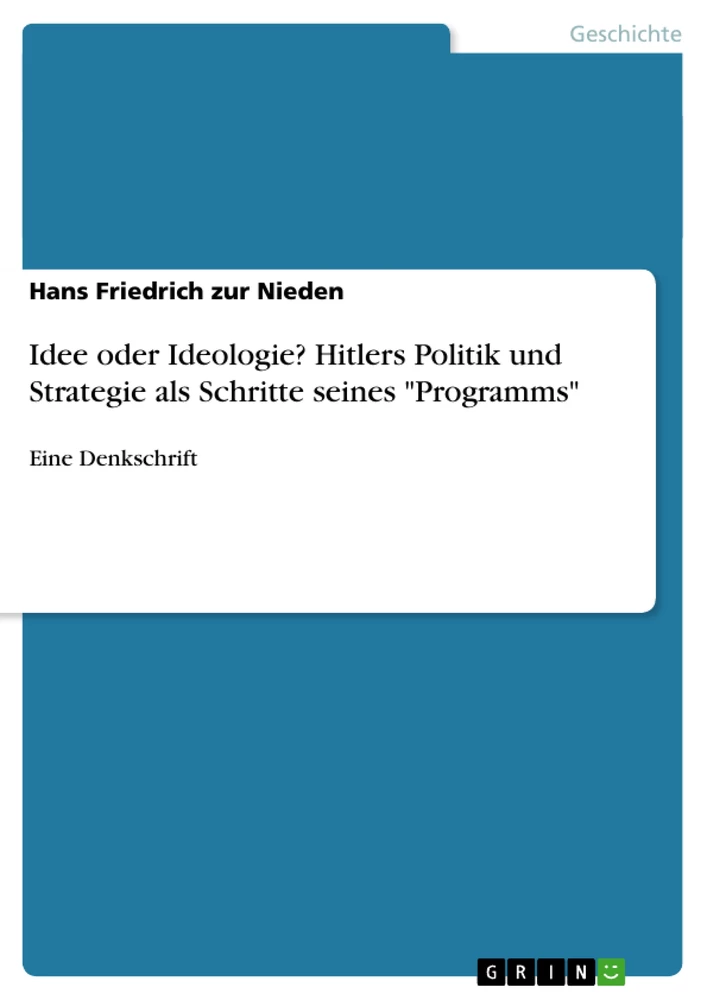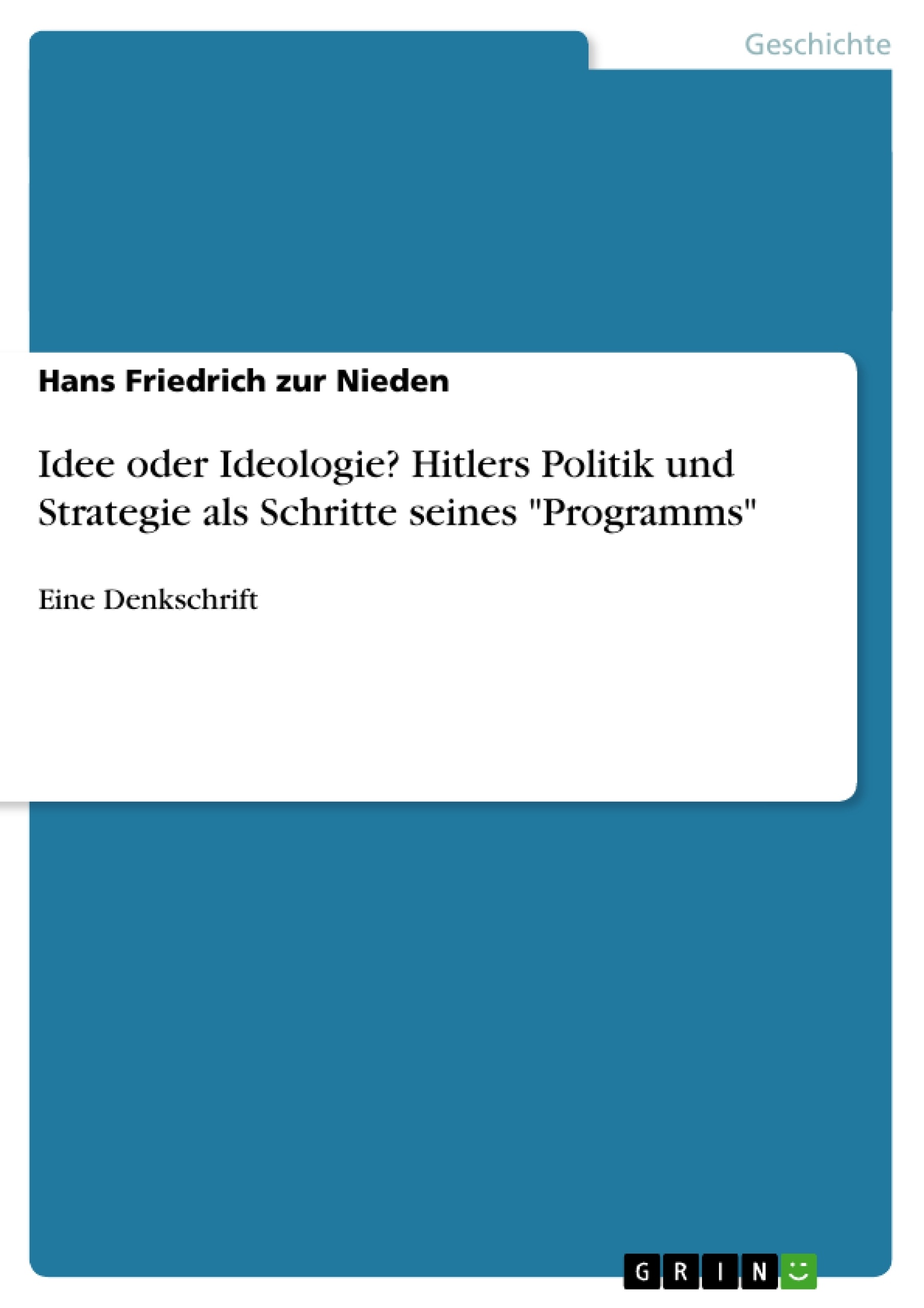Die Beschäftigung mit Adolph Hitler und dem Nationalsozialismus ruft zu recht eine mehr oder weniger starke, reflexhafte Abwehrhaltung in einer Mischung aus Abscheu und Unverständnishervor. Abscheu empfinden wir gegenüber den Untaten und maßlosen Verbrechen des Regimes,auf Unverständnis trifft das Verhalten der Mehrheit der damaligen Bevölkerung, weil sie die nationalsozialistische Bewegung lange aktiv unterstützte oder zumindest tolerierte, ganz zu schweigen von einem tatsächlichen Widerstand.Wir tradieren das “Versagen” einer früheren Generation und münzen es um in ein überzeugtes“Videant consules!” Rassismus und gar Antisemitismus finden heute keinen wirklichen Nährboden, die Nation ist als Selbstvergewisserung in einem geeinten Europa nur noch vonabgeschwächter Bedeutung, die damals offensichtliche Attraktivität einer egalitär-sozialistischenBewegung, die ihre “Volksgenossen” unter den “Arbeitern der Stirn und Faust” suchte und fand,wird leichthin übersehen. Als Nachgeborene entwickeln wir kein Gespür für das massen-psychologische Phänomen einer charismatischen Führungspersönlichkeit, die den Empfindungender Zuhörer geschickt entgegenzukommen wusste. Die politische Kultur in ganz Deutschland fordert, fördert und baut Mahnmale oder Gedenkstätten, um das ehrende Andenken an die Opfer lebendig zu halten, weil die Erinnerungan die Schrecken des Nationalsozialismus verblasst. Vielfach bleibt im heutigen Wissen nur Raum für ein Bild mit groben Strichen. So waren es gerade die Reaktionen meiner beiden 1981bzw 1985 geborenen Söhne und ihrer Mitschüler bzw Mitstudenten, die voller abwehrendem Widerwillen mit dem Dritten Reich und der Person Hitlers nahezu ausschließlich Angriffs-/Vernichtungskriege und systematische Verbrechen sowie planmäßigen Judenmord auf der Basis der Rassenideologie verbinden und mich so auf den Gedanken brachten, einen Anstoß zur differenzierteren Rückschau zu geben.
Inhalt
Vorwort
Einleitung
1. Das Thema im heutigen Umfeld
2. Die Aufgabenstellung der Arbeit
Teil I: Der Weg zum Führerstaat
3. Hitlers “Programm”
4. Die zwanziger Jahre - Erste Prägung und Umrisse eines Weltbilds
5. “Programm” und (Außen-)politik nach dem 30. Januar 1933
6. Parteiprogramm und Führerwille
Teil II: Schritte zum Krieg- die Idee der Großmachtposition als Ziel
7. Nichtangriffspakt mit Polen, Flottenabkommen mit England
8. Rheinlandbesetzung als außenpolitischer Coup
9. Anschluss Österreichs und außenpolitischer Machtzuwachs
10. Blick nach Osten - Münchener Abkommen
11. “Griff nach Prag”
12. Politik, Kriegspläne und Strategie - ein Langzeitprogramm?
Teil III: Idee oder Ideologie als Gesetz des Handelns
13. Überfall auf Polen - Kriegserklärung der Westmächte
14. “Weserübung” - die Aktion gegen Dänemark und Norwegen
15. Der Feldzug im Westen
16. Optionen nach dem Waffenstillstand mit Frankreich
17. Warum nach Russland?
Teil IV: Zugzwang oder Ideologie statt Vernunft
18.Kriegswende 1941- Halt vor Moskau
19. Der Weg in den Krieg mit den USA
20. Die Konferenz von Casablanca
21. Ideologie vor Strategie: Planvoller Mord
22. Invasion 1944 als faktisches Ende deutscher Außenpolitik
Teil V: Ergebnisse und Erkenntnisse
23. Hitler als “Finis Germaniae”
24. Schlussbetrachtung
Anmerkungen
Literatur
Vorwort
Die Beschäftigung mit Adolph Hitler und dem Nationalsozialismus ruft zu recht eine mehr oder weniger starke, reflexhafte Abwehrhaltung in einer Mischung aus Abscheu und Unverständnis hervor. Abscheu empfinden wir gegenüber den Untaten und maßlosen Verbrechen des Regimes, auf Unverständnis trifft das Verhalten der Mehrheit der damaligen Bevölkerung, weil sie die nationalsozialistische Bewegung lange aktiv unterstützte oder zumindest tolerierte, ganz zu schweigen von einem tatsächlichen Widerstand.
Wir tradieren das “Versagen” einer früheren Generation und münzen es um in ein überzeugtes “Videant consules!” Rassismus und gar Antisemitismus finden heute keinen wirklichen Nährboden, die Nation ist als Selbstvergewisserung in einem geeinten Europa nur noch von abgeschwächter Bedeutung. Wir wollen die damals offenbare Attraktivität einer egalitär-sozialistischen Bewegung, die ihre “Volks- genossen” unter den “Arbeitern der Stirn und Faust” suchte und fand, nicht wahr haben. Als Nachgeborene entwickeln wir kein Gespür für das massenpsycho- logische Phänomen einer charismatischen Führungspersönlichkeit, die den Empfindungen der Zuhörer geschickt entgegenzukommen wusste.
Die politische Kultur in ganz Deutschland fordert, fördert und baut Mahnmale oder Gedenkstätten, um das ehrende Andenken an die Opfer des Natio- nalsozialismus lebendig zu halten, weil die Erinnerung an die Schrecken ver- blasst. Vielfach bleibt im heutigen Wissen nur Raum für ein Bild mit groben Strichen. So waren es gerade die Reaktionen meiner beiden 1981 bzw 1985 geborenen Söhne und ihrer Mitschüler bzw Mitstudenten, die voller abwehrendem Widerwillen mit dem Dritten Reich und der Person Hitlers nahezu ausschließlich organisierte Angriffs-/Vernichtungskriege und systematische Verbrechen sowie planmäßigen Judenmord auf der Basis der Rassenideologie verbinden und mich so auf den Gedanken brachten, einen Anstoß zur mehr analytischen Rückschau zu geben.
Bonn, im Januar 2011
Vorwort zur überarbeiteten Fassung
In dem grundsätzlich unveränderten Text mit beibehaltener Einteilung sind neben notwendigen redaktionellen Korrekturen einige Passagen nach Auswertung weiterer Literatur ergänzt, umgestellt oder konkreter formuliert worden. Dies betrifft etwa im Kapitel 18 die Situation im Herbst 1941 und die Waffenstillstands- /Separatfriedensinitiativen Englands und Russlands im Frühjahr 1942. Inhaltlich wurde in Kapitel 19 die Rolle der USA stärker aus ihrer wirtschafts- und macht- politischen Grundhaltung erklärt. In den Aktivitäten sahen Deutschland, Italien und Japan jeweils die wesentliche Ursache für ihren Entschluss zum Kriegs- beginn.
Bonn, im Juli 2011
Einleitung
1. Das Thema im heutigen Umfeld
Die Urkatastrophe1 des Ersten Weltkriegs hatte u. a. zum Zusammenbruch des deutschen, des österreichisch-ungarischen, des türkisch-osmanischen und des russischen Reichs geführt. Die Erinnerung an diesen “Großen Krieg”, wie er im englischen und französischen Sprachgebrauch noch heute heißt2, wird dort durch den Gedenktag an den Waffenstillstand vom 11. November 1918 und den damit errungenen Sieg als nationales Ereignis wach gehalten. Erst im Jahr 2009 nahm dann mit Bundeskanzlerin Angela Merkel erstmals die deutsche Seite offiziell an den Feierlichkeiten in Paris teil. In Deutschland haben Schrecken und Leid des Zweiten Weltkriegs mit den Untaten des NS-Regimes das Gedenken an die Jahre von 1914 bis 1918 längst überlagert und verdrängt. Stevenson3 sieht eine dahinge- hende Veränderung in allen Ländern.
Während des gesamten Kriegsverlaufs von 1914 - 1918 standen nur ganz kurz im Osten (bis zum deutschen Sieg bei Tannenberg) fremde Truppen auf deutschem Boden; Luftangriffe nach dem damaligen Stand der Technik erfolgten nicht syste- matisch und in insgesamt nur begrenztem Umfang mit eher fraglicher Wirkung auf die Einsatzfähigkeit des deutschen Heeres und die Moral der Zivilbevölkerung. Dagegen hatten etwa Italien (Isonzo), Frankreich (Verdun, Somme) oder Belgien (Flandern, speziell Ypern) das Kriegsleid der Graben- und Stellungskämpfe mit ihren verlustreichen, aber häufig militärisch ergebnisarmen Angriffen4 über lange Zeit ertragen.
Im Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland schon sehr früh durch Luftangriffe und dann, nach einem entsprechenden Beschluss der Alliierten während der Konferenz in Casablanca im Januar 1943, mit sich bis ins Unsägliche steigernder Intensität der Flächenbombardements Schauplatz des Bombenkriegs und schließlich des Landkriegs. Im Frühjahr 1945 kämpften sich von Ost und West die gegnerischen Truppen über die Gesamtfläche Deutschlands hinweg bis zu ihrem symbolischen Treffen am 25. April1945 bei Torgau an der Elbe5 vor.
Mit dem wachsenden zeitlichen Abstand zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa kommt acht Aspekten bei der objektivierenden Beschreibung der Geschehnisse, bei der Bewertung der handelnden Personen und der Interpretation ihrer Motive eine verstärkte Bedeutung zu:
1. Die Quellenlage zu den dokumentierten Fakten dürfte - vorbehaltlich immer noch denkbarer Entdeckungen - als prinzipiell vollständig einzuschätzen sein. Die Unzahl nicht oder noch nicht erschlossener staatlicher, halböffentlicher und privater Quellen sollte keine wirklichen Überraschungen mehr bergen, sie wird bereits Bekanntes insgesamt eher bekräftigen.
2. Wer unter deutschen Verbrechen und Kriegsverbrechen gelitten hat oder in seiner Umgebung traumatisierte Erzähler erlebt, empfindet Fakten, die dies bestätigen, als Stimulans zu spezifisch intensiver Erforschung und Aufhellung des Geschehens. Das dabei dann vorrangig archivarische Interesse an den - zumeist grausamen - Details lässt keinen Raum oder verhindert sogar die als zweiten Schritt notwendige Einordnung in den historischen Kontext..
3. In vielen Bereichen hat heute die Geschichtswissenschaft ihre Elfenbeintürme verlassen . Die heutigen Medien, insbesondere das Fernsehen, wecken und un- terhalten das Interesse breiter Kreise an der Zeitgeschichte. Dabei wird der Histori- ker leicht aus der Rolle des Wissenschaftlers in die Funktion eines - unangreifbaren- Zeugen gedrängt. Nicht er stellt dass Ergebnis einer Forschungs- arbeit vor, sondern ihm wird eine konkrete Frage, ein eingegrenztes Beweisthema, vorgelegt. Er bestätigt dann mit seinen sachlichen und objektivierten Aussagen, was die Erinnerungskultur an Bildern - in unserem Fall - über die Diktatur des “Dritten Reiches” und die Ursachen seines Aufstiegs und Falls schon vermittelt hat. Bei aller berechtigten Freude über die gesteigerte Aufmerksamkeit bleibt ein Desiderat der wissenschaftlichen Tätigkeit, sich in diesem Aufgabenfeld sorgfältig von der eher effekthascherischen Erinnerungskultur abzugrenzen. Weder die Memoiren früherer Entscheidungsträger noch die Berichte einfacher Befehls- empfänger oder überlebender Opfer der Terror- und Vernichtungsmaßnahmen des NS-Staates ergeben allein oder auch im Kontext ein vollständiges Bild. Die “entscheidende Erkenntnisoperation der historischen Forschung” bleibt mit Theo- dor Mommsens klassischem Credo6 die auf lückenloser Erfassung und Auswertung der zugänglichen Quellen beruhende “objektivierende und systematisierende Interpretation der Überlieferung”, um so, wie Ranke es fordert, zeigen zu können, wie es eigentlich gewesen war.
4. Differenzen in der Bewertung eines Geschehensablaufs, beispielhaft steht hier die bekannte “Fischer-Kontroverse” über die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914 - 1918, führen zu heftig ausgetragenen Meinungsverschieden- heiten unter den Fachleuten, freudig begleitet von einem breiten Medienecho. Das rechtlich-moralisch gefestigte Urteil über die Nationalsozialisten und das “Dritte Reich” mit ihren singulären Verbrechen überwölbt zwangsläufig auch die histori- sche Forschung. Die Möglichkeit ist nicht von der Hand zu weisen, dass Auffassungen und Interpretationen besser Gehör finden und die Deutungshoheit reklamieren können, weil sie auf der Linie des consensualen Werturteils besonders eingängig erscheinen.
Hier gewinnt noch ein eher psychologisches Moment an Gewicht. Der Extremis- mus der Nationalsozialisten, ihre Führergläubigkeit und -hörigkeit (“Führer befiel, wir folgen!”), die Zurückdrängung der individuellen Persönlichkeitsrechte zuguns- ten der Volksgemeinschaft, das Bemühen, jeden Volksgenossen in einer der zahl- reichen Organisationen des Regimes zu erfassen7, die ständigen Appelle der NS- Propaganda an die Emotionen, die Uniformierung der Gesellschaft und letztlich der Horror des zweiten Weltkriegs vor dem Hintergrund des millionenfachen Juden- mords bedingen ein zwiespältiges Reflektieren. Jeder Erörterung wird schon im Ansatz der Boden entzogen, wenn sie als “rechts”, “antisemitisch”, “nazistisch” oder vereinfachend “faschistisch”8 bezeichnet wird. Eine angemeldete Versammlung/-Kundgebung von “Rechten” darf behindert und gestört werden9, auch wenn das Versammlungsgesetz für Störungen Sanktionen vorschreibt10. Wir schätzen die Meinungs- und Pressefreiheit als ganz hohes demokratisches
Grundrecht; im Schutz dieses Rechts darf man mehr oder weniger jede Fahne mit sich führen, aber das Zeigen eines NS-Symbols ist strafbar11.Wer singt “Völker, hört die Signale, auf zum letzten Gefecht!”12, ist nicht unbedingt ein Weltver- besserer, aber bekennt sich als Sozialist, wer seinen inhaltlich ähnlichen Aufruf mit den Worten anstimmt “Zum letzten Mal wird zum Appell geblasen. Zum Kampfe stehn wir alle schon bereit,”13 begeht eine strafbare Handlung und ist zudem ein Fall für den Verfassungsschutz. Die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen kann jederzeit mit grausigen Bildern und Dokumentationen von den Zuständen in den Konzentrationslagern am Jahresanfang 1945 bei Einmarsch der alliierten Truppen gestärkt werden14. Die bedrückende Bildmacht wirkt - obwohl ein direkter Zusammenhang fehlt - zurück auf die Vorstellung vom Geschehensablauf spätestens seit Kriegsbeginn 193915. Das politische Spektrum im Nachkriegsdeutschland hat möglicherweise links und rechts seiner Mitte nicht die gleich weit reichende Ausdehnung oder der Focus ist - durchaus getragen von der Mehrheitsmeinung - nach links verschoben. So ist es schlecht vorstellbar, dass sich korrespondierend zur Partei “Die Linke” am anderen Endpunkt eine Gruppierung unter dem Namen “Die Rechte” etablieren und halten könnte. Eine Gedenkver- anstaltung am Grab eines “Rechten” könnte kaum so selbstverständlich und un- gestört ablaufen, wie dies alljährlich im Januar in Berlin-Friedrichsfelde zur Erinnerung an die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht am 15. Januar 1919 möglich ist16. Mit bisweilen missionarischem Eifer, wird alles “Rechte” ohne auch nur den Versuch der Unterscheidung zwischen rechts, rechtsextrem und rechtsradikal aufgespürt und bekämpft.
5. Daran knüpft noch ein weiterer Aspekt an. Wir verdammen eher pauschal und vorsorglich alles, was in den zwölf Jahren der NS-Herrschaft geschehen ist, um uns gegen den möglichen Vorwurf der verdeckten oder gar von uns selbst noch nicht eingestandenen Sympathie zu wappnen. Zugleich betonen wir, dass es ja immer “die Nazis” waren, denen wir alle Schuld zuweisen können. Dagegen beschreibt Conze17 beispielhaft die Unterschiede und unterschiedlichen Einschätzungen der Regimenähe von Angehörigen des Auswärtigen Dienstes. Die Bundesrepublik ehrte am 20. Juli 1961 elf der wegen ihres Widerstands gegen das NS-Regime hinge- richteten Diplomaten mit einer Gedenktafel in der Eingangshalle des Auswärtigen Amtes in Bonn, dabei waren sechs der Geehrten - z. B. Werner Graf von der Schulenburg seit dem 01. Oktober 1934 - Mitglieder der NSDAP18. Irritiert erfahren wir, dass der Schriftsteller Günter Grass der Waffen-SS angehört hatte. Die durch eine Dissertation von 2008 wohl erstmals breiter bekannt gewordene Mitglied- schaft des späteren Bundespräsidenten Gustav Heinemann im Bund Nationalsozia- listischer Deutscher Juristen (BNSDJ) und in der Nationalsozialistischen Volks- wohlfahrt (NSV) delegitimiert ihn keineswegs a limine, wie der Verfasser deutlich macht19.
Unter dem beherrschenden Eindruck des planmäßigen Mordes an den Juden und an anderen Menschengruppen laufen wir Gefahr, ohne anderweitige Prüfung hierin das Movens aller Politik des NS-Staates zu sehen20. Tatsächlich war die Judenfrage anfänglich aus der Sicht der damaligen Machthaber wohl eher nachrangig. Schließ- lich lebten vor 1933 im Reich kaum mehr als 500.000 Juden. Ein unverhältnis- mäßig hoher Anteil allerdings in exponierten Positionen von Wissenschaft und Kunst, Kreditwesen, Handel und Gewerbe. Daher waren vielfach nur Neid und Mißgunst der eigentliche Kern des vermeintlichen Antisemitismus. Jüdische Sol- daten hatten sich im Ersten Weltkrieg keineswegs vor dem Dienst gedrückt21 und waren vielfach ausgezeichnet worden.
Aber jetzt folgte - ausgehend von dem Ausschluss aus der Volksgemeinschaft durch das NS-Parteiprogramm - ab 1933 die systematische Entrechtung und Ent- eignung des deutschen jüdischen Bevölkerungsteils. Endziel und damit “Endlö- sung” im ursprünglichen Sinn war noch nicht die physische Vernichtung, vielmehr die durch Freiwilligkeit, Drohung, Rechtsbruch und Gewalt bewirkte Entfernung aus Deutschland. Nach Kriegbeginn und der Besetzung der angrenzenden Länder war einerseits ein Abschub in einen zur Aufnahme bereiten Staat rechtlich und tatsächlich kaum noch möglich, andererseits vervielfachte sich das Problem, weil in den außerdeutschen Territorien erheblich mehr Juden lebten, allein in Polen etwa 1,5 Millionen. In dieser selbst geschaffenen scheinbaren Zwangslage bedurfte es dann der Strukturen des Regimes mit seinen Exponenten wie Himmler oder Hey- drich, um dem Wort “Endlösung” mit den beginnenden Massenmorden seinen uns geläufigen entsetzlichen Sinn zu geben und nach den Beschlüssen der Wannseekonferenz vom 20. Januar 1942 dann zentral organisierte Taten folgen zu lassen.
Weitaus wichtiger als das sekundäre Judenproblem war das Bemühen um die “Volksgenossen” und um ihr Engagement für die Ideen des NS-Staates. Wir übersehen, dass die “Bewegung” neben dem Hakenkreuz und dem vielgestaltigen Appell an die Emotionen durchaus sehr Konkretes zu bieten wusste..Die Zahl der Arbeitslosen sank von mehr als sechs Millionen im Zeitpunkt von Hitlers Macht- übernahme innerhalb der folgenden fünf Jahre auf unter 500 000. Baumaßnahmen wie die Schwarzwaldhochstraße, das überdimensionale Erholungsheim in Prora auf Rügen oder der Nürburgring boten gezielt für strukturschwache Gegenden Arbeit und Wohlstand. Der Staat zeigte sich bewusst zukunftsorientiert, propagierte eine neue Zeit und gab dem Fortschritt z. B. durch Mobilität (Verkehrsprojekte wie Autobahnausbau und VW-Konzept) oder die moderne Technik der Informations- verbreitung (Rundfunk und preiswerte “Volksempfänger”) Raum22. Es ist eine wenig berechtigte Vereinfachung, wenn man die hier zuletzt genannten Punkte als Teil der systematischen Kriegsvorbereitung oder der effektiveren Massenbeein- flussung abtut. Die große Mehrheit der neuen Arbeitsplätze entstand nicht im Rüstungsbereich sondern in normalen zivilen Produktionseinrichtungen23 und der Rundfunkempfang war nicht auf regierungsamtliche Informationen beschränkt. Das betont egalitäre Element des Systems verschaffte breite Sympathie, die attraktiven Leistungen für alle “Volksgenossen” etwa der NS-Volkswohlfahrt oder des Erho- lungswerks “Kraft durch Freude” (KdF) der Deutschen Arbeitsfront ( DAF) sicher- ten Rückhalt. Nicht ohne Grund waren die Anhänger der NSDAP und ihre Füh- rungselite ungewöhnlich jung, Adolf Hitler war bei der Machtübernahme am 30. Januar 1933 erst 43 Jahre alt, seine Parteimitglieder waren zu 70 % jünger als 40 Jahre. Das Bild der Nationalsozialisten in der Öffentlichkeit vermittelte keineswegs den Eindruck einer dumpfen “braunen Horde” oder von halbkriminellen Schlägertypen, es war überwiegend positiv besetzt24. Die SS mit dem Wahlspruch “Meine Ehre heißt Treue” konnte insoweit kaum anstößig erscheinen25
In der Rückschau werden diese Faktoren von den Schrecken des späteren (Vernichtungs-)krieges mit den eigenen und gegnerischen Gefallenen der regulären Kriegshandlungen einerseits und andererseits den Opfern der Geiselerschießungen, kriegsverbrecherischen Einsätze gegen “Partisanen” und “Banden” oder der Ge- fangenenmisshandlung überdeckt und verdrängt. Der bewußt in Kauf genommene Hungertod russischer Kriegsgefangener bleibt unfasslich, der millionenfache Mord der Rassen- und Lebensraumideologie sprengt die Vorstellungskraft.. Die Ereignisse verschwimmen. zu einer traumatischen Last26. Das Datum 08. Mai 1945 gilt in erster Linie als ein Tag der Befreiung vom Joch des Unrechtregimes, dass Deutschland an diesem Datum umfassend besiegt und der Gnade oder Ungnade der Sieger ausgeliefert war, wird als gerechte Strafe für das von “den Nazis” begangene Unrecht, insbesondere für den Beginn und die Führung des Krieges empfunden. Mit den damaligen Siegern gemeinsam “freuen” wir uns über unsere Niederlage
6. Mit der Sprachregelung über die (Allein-)verantwortlichkeit der Nazis laufen wir Gefahr, ein schiefes , unscharfes Bild des Geschehens zu erzeugen, mit dem zugleich eine wenig angebrachte Entlastung der Bevölkerungsmehrheit einhergeht. Nicht allein “die Nazis” haben auf deutscher Seite Krieg geführt, das damalige Deutsche Reich hat unter der NS-Führung so agiert. Begriffe wie “Anti-Hitler- Koalition” oder “Nazi-Deutschland” verschleiern, dass in dem Millionenheer der Wehrmacht ein wesentlicher Teil der deutschen Bevölkerung im Kampf stand und zumindest bis zur Vernichtung der 6. Armee des Generalfeldmarschalls Paulus in Stalingrad im Winter 1942/43 dabei breiten Rückhalt fand27.
7. Der Zweite Weltkrieg hat die Menschen insgesamt keineswegs friedlicher ge- macht oder gestimmt. Die Massenvernichtungswaffen aus der Büchse der Pandora mit atomarer, biologischer und chemischer Wirkung konnten die Angst vor dem Krieg erhöhen, aber das Übel nicht abschaffen28. Wie schon der Völkerbund haben auch die Vereinten Nationen sich nicht als wirksames Instrument zur Kriegsverhinderung erwiesen. Die gewaltsamen kriegerischen Auseinandersetzungen nach 1945 haben die Zahl 200 bereits überstiegen. Nur wenige davon erreichen unser kritisches Bewusstsein29. Wir halten in Deutschland an der Grundüberzeugung fest, dass vom deutschen Boden nie wieder Krieg ausgehen darf, unsere Verfassung verbietet in Artikel 26 Abs. 1 des Grundgesetzes den Angriffskrieg30, aber wir sehen zugleich, wie wenig Andere eine vergleichbare Auffassung vertreten. Wir sind unsicher, ob die Einschätzung nicht doch zutrifft, eine spezifisch deutsche Neigung zur Gewalt und eine spezielle Kriegsbereitschaft31 seien, wenn nicht Hauptursache, so doch zu- mindest wesentlicher Faktor für die offensichtlich über mehr als fünf Kriegsjahre hinweg fortdauernde Bereitschaft des großen Teils der deutschen Bevölkerung gewesen, ihrem “Führer” willig zu folgen. Diese deutschen Eigenschaften seien für die Dauer und die Dimension des Zweiten Weltkriegs entscheidend geworden32. Die Bekämpfung jeder Form von Militarismus33 ist für breite Kreise in der Zivilgesellschaft selbstverständliche Bürgerpflicht, um dahingehend vermutete Neigungen und Absichten nicht manifest werden zu lassen. Das Grundgesetz nennt und begrenzt aufzählend die Einsatzmöglichkeiten der Streitkräfte, ihr oberster Soldat gehört nicht der Regierung an; der zivile Bundesminister der Verteidigung ist Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt.
8. Bis in die Neuzeit hinein wurde im Kontext mit zwischenstaatlichen Kriegen die Frage nach einer eventuellen Schuld oder Mitschuld an der Auseinandersetzung nicht gestellt34. Die Kampfhandlungen wurden mit Clausewitz als Politik unter Einsatz äußerster Mittel interpretiert und akzeptiert. Der jeweilige Friedensschluss regelte Art und Umfang des Ausgleichs. Kaum jemand nennt Napoleon schuldig an den Kriegen in und mit all den Ländern, die er in seinen Feldzügen einseitig mit Waffengewalt erobert und besetzt hat. Erstmals nach dem ersten Weltkrieg enthielt der Friedensver- trag ausdrücklich die Feststellung von der Alleinschuld35 einer Kriegspartei.
Nach 1945 herrscht. zumindest in der westlichen Welt und in Russland weitgehend Konsens, wonach Deutschland den “Zweiten Weltkrieg entfesselt” hat36.. Diese - eine erneute Alleinschuld wie selbstverständlich implizierende - Wortwahl engt darüber hinaus doppelt ein, geographisch auf Europa und Nordafrika sowie zeitlich auf die Jahre von 1939 bis 1945. Zudem ist der 01. September 1939 als der Anfang einer im Wortsinne weltweiten Auseinandersetzung ein entweder recht willkürlich oder sogar sehr gezielt irreführend gewähltes Datum. Dabei werden aus den Vorjahren der japanisch-chinesische Krieg von 193137, der mit internationaler Beteiligung auf beiden Seiten unterstützte spanische Bürgerkrieg von 1936 bis 1939 oder der Krieg Italiens gegen Abessinien 1935/1936 und der 1937 erneute Krieg Japans gegen China38 sowie der russisch-japanische Grenzkonflikt der Sommermonate 1939 im Grenzdreieck Korea-Mandschurei-Sowjetunion ausgeklammert. Bei einer betont völkerrechtlichen Wertung müßte man auch sehen, dass das Vorgehen des Deutschen Reiches 1938 gegen die Tschechei mit militärischen Mitteln realisiert wurde; es handelte sich um eine Aggression, ein Eindringen unter deutlicher Verwendung militärischer Machtmittel, bei dem jedoch für die Einordnung als “Krieg” das Ele- ment der Gegenwehr des Angegriffenen fehlte39. Tatsächlich begann am 01. Septem- ber 1939 zunächst “nur” der deutsche Überfall auf Polen als ein weiterer - und nach dem spanischen Bürgerkrieg - in Europa zweiter Krieg in diesem Jahrzehnt. Rein von der Anzahl der Staaten her, die sich im Kriegszustand befanden, wäre als Zeitpunkt der 03. September 1939 mit der förmlichen englischen und ebenfalls der französi- schen Erklärung sowie den Folgekriegserklärungen weiterer Länder40 eher zutref- fend. Mit der Kriegserklärung oder - falls sie unterbleibt - mit der Eröffnung der Feindseligkeiten beginnt der Krieg41. Hier ex-post zunächst die genannten Aus- einandersetzungen in der Welt der dreißiger Jahre wie kleine Scharmützel zu überge- hen, um dann den Zeitpunkt des Beginns eines annähernd weltweiten Kriegszustands nicht mit der Vielzahl rechtsändernder Erklärungen sondern mit der politisch-mora- lischen Bewertung des schon laufenden Kriegshandelns einer Seite in einem bilatera- len Konflikt zu fixieren, ist jedenfalls fragwürdig. Aber selbst wenn man die kriegerischen Ereignisse vor 1939 und nach dem 08. Mai 1945 bis zur bedingungslosen Kapitulation Japans am 02. September 194542 außer Acht lässt und für Europa den spezifischen, nämlich auf Vernichtung gerichteten Charakter der deutschen Kriegführung im Osten herausstellt43, bleibt der Begriff doch eher psychologisch als historisch vertretbar. Kriege werden nicht entfesselt, vielmehr von einer Seite in der Hoffnung auf den Sieg erklärt oder begonnen. Die unterschwelligen Assoziationen des von seinen Fesseln befreiten Untiers korrespon- dieren mit der Kriegserinnerung der Menschen aller Nationen und aller Länder, die unter dem Krieg und den Deutschen gelitten haben. Die Chronologie der politischen Aktivitäten, der strategische Plan und die tatsächlichen Motive der Kriegshand- lungen und -entscheidungen aller Beteiligten ergeben ein durchaus komplexes Bild. Hier sei für die deutsche Seite auf Hildebrands Darstellung zur deutschen Außenpolitik von 1933 - 194544 und für die Hauptkriegsgegner auf Hillgrubers Werk über die Kriegsziele der Alliierten45 verwiesen46. Jan Kershaw stellt in seinen “Fateful choices”47 etwa am Beispiel der Situation der englischen Regierung im Mai/Juni 1940 heraus, welche innerstaatlichen Schwierigkeiten zu überwinden waren, um den Widerstand gegen Deutschland fortzusetzen und weiter “im Krieg” zu bleiben.
Nach dem deutschen Überfall auf Polen am 01. September 1939 entschieden in Paris und London verantwortliche Politiker, die durchaus Herr ihrer eigenen Handlungs- spielräume waren, das politisch aus ihrer Sicht einzig Richtige zu tun und dem Expan- sionsstreben Hitler-Deutschlands nachdrücklich Einhalt zu gebieten. Sie erklärten dem deutschen Reich am 03. September 1939 förmlich den Krieg. Es ist hier nicht der Ort, diese Erklärungen an der Völkerbundsatzung48 oder dem Briand-Kellogg-Pakt49 oder der rückwirkend maßgeblichen Rechtsprechung des Internationalen Militärgerichtshofs von Nürnberg (International Military Tribunal - IMT50 ) zu messen. Beide Länder wollten den Kriegszustand mit Deutschland, den sie ohne Zwang durch eine äußere Macht herbeiführten. Die an Polen im Vorfeld gegebenen Garantien51 sollten eher Deutschland beeindrucken als Polen schützen. Keineswegs wollten England und Frankreich damals Krieg gegen “die Nazis” führen oder etwa Deutschland vom Joch der Naziherrschaft befreien. Beide Länder nahmen ausschließlich die eigenen Inter- essen wahr, es gibt keine direkte Bedingtheit zwischen Naziherrschaft in Deutschland und Kriegserklärung der Alliierten52. Die Grenzen zwischen einem reinen Angriffskrieg und einem möglicherweise gerechtfertigten Präventivkrieg werden schwer zu ziehen sein. Hier sei nur an englische Pläne aus dem September 1939 zur Besetzung Norwe- gens mit dem Ziel der Sicherung des Zugangs zu den schwedischen Erzgruben in Kiruna53 erinnert, an die tatsächliche Besetzung der Färoer-Inseln am 16. April 1940 und Islands am 10. Mai 1940 durch englische Kräfte, nur kurz nach Beginn des deutschen Angriffs auf Dänemark und Norwegen am 09. April194054, an die spätere Besetzung Islands durch die USA im Juli 194155, das Suez-Unternehmen Englands und Frankreichs im Jahr 1956, die Einsätze der NATO 1995 in Bosnien und 1999 im Kosovo oder den Irak-Krieg der USA.
Hofer verteidigt in seinem in der sechsten Auflage neu aufgelegten und ergänzten Buch56 in einem einleitenden Kapitel unter der Überschrift: “Gibt es eine deutsche Kriegsschuldfrage?”57 seine seit 35 Jahren vertretene These von der “Entfesselung” des Zweiten Weltkriegs durch Deutschland mit detaillierten Belegen aus dem aktuellen Forschungsstand. Tatsächlich hatte ja Hitler kriegerische Absichten, wie sie etwa das Hoßbach-Protokoll58 nachzeichnet, mit den späteren Handlungen realisiert. Mit den Kriegserklärungen Englands und Frankreichs wurde aber seine Langfristplanung über- holt und eine neue Kausalität gesetzt. Diesen Kriegserklärungen folgten auch un- mittelbar Feindseligkeiten, deren in den Septemberwochen letztlich geringes Geplän- kel Polen keine wirkliche Entlastung vom Angriffsdruck Deutschlands bot. Als Er- klärung wird regelmäßig auf moralische Bedenken der Alliierten und fehlende waffen- technische und psychologische Einsatzfähigkeit ihrer Streitkräfte verwiesen. Beide Argumente sind weder einzeln noch in der Summe überzeugend. Wer einen Krieg erklärt, hat irgendwelche Skrupel bereits zurückgestellt oder sieht sich zumindest ge- rechtfertigt und hofft zudem, den Waffengang mit seinen Mitteln siegreich führen zu können. Jedoch beide Länder zögerten, so unterblieb der - allerdings nur bei Über- windung des deutschen Westwalls mögliche - schnelle Stoß in das Ruhrgebiet als das rüstungstechnische Zentrum des Reiches, den die deutsche Generalität mit guten Gründen fürchtete. Die Westgrenze Deutschlands war während der Kämpfe in Polen nur schwach gesichert. Es gab aus damaliger alliierter Sicht offensichtlich kein Kriegs- ziel, das den sofortigen großen Einsatz im Westen Europas gegen Deutschland, schon gar nicht gegen die “Nazis”, erfordert und gelohnt hätte und dabei vom Mehrheits- willen der Bevölkerung beider Staaten getragen worden wäre. Polen war ohnehin verloren. Nach der Niederlage Polens mußten sich die Politiker in London und Paris zudem vorsorglich die Frage stellen, wie wohl Russland regieren würde, wenn ein englisch/französischer Feldzug gegen den deutschen Westen eine Bedrohung oder Störung des deutsch-russischen Warenverkehrs und eine Verschiebung der politischen Gewichte in Europa verursachen würde. Ein eher langatmiges Konzept sollte die Wirkung einer Blockade herbeiführen und Deutschland im Norden von der Erzzufuhr und im Südosten vom Ölnachschub abschneiden. Hier sei nochmals auf Hillgrubers oben erwähnte Darstellung zu den alliierten Kriegszielen verwiesen.
2. Die Aufgabenstellung der Arbeit
Die nachfolgenden Darlegungen gehen zunächst der Frage nach, ob, und wenn ja in welchem Umfang, von wann an und bis zu welchem Zeitpunkt der “Führer”59 als letztlich die Richtlinien der nationalsozialistischen Außenpolitik bestimmende zentrale Figur die Idee von einer Großmacht Deutschland auf dem Weg zur Weltmacht, ja zur Weltvormacht verfolgte und verkörperte. Es wird auszuleuchten sein, ob und inwie- weit ein ideologisch verblendetes Konzept die Oberhand gewann, das sich in bestimm- ten Merkmalen der Persönlichkeit bereits am Anfang seiner politischen Laufbahn andeutet. Beides wird sich nicht völlig voneinander trennen lassen. Sein enormes politisches Talent, die charismatische Fähigkeit, Menschen und speziell große Men- schenversammlungen durch Reden und Ansprachen für sich einzunehmen und für seine Überzeugungen zu gewinnen60, seine Bereitschaft, Politik als die Kunst des Möglichen ohne jedweden moralischen Skrupel zu betreiben, führten ihn auf eine Erfolgsspur zunächst ohne Beispiel. Sein erster deutlicher Misserfolg, die Kriegserklärungen Frankreichs und Englands nach dem deutschen Überfall auf Polen, beruhte auf der Fehleinschätzung in der Haltung dieser Länder und ihrer Regierungen61 Dauerhaft erfolgreich konnte er nicht werden, weil seine fanatischen Grundüberzeugungen, Rassenlehre und Judenhass, ihm den in der Politik notwendig nüchternen Blick auf die weltpolitischen Realitäten in den entscheidenden Momenten versperrten. Dabei werden die Entwicklungslinien und Brüche sowie die Aktionen und nur Reaktionen im Hand- lungsbild herauszuarbeiten sein.
Auf dieser Grundlage aufbauend sind nachfolgende Fragen zu beantworten:
1. Erlauben die uns vorliegenden Erkenntnisse von der Persönlichkeitsentwicklung Hitlers den Schluss auf die frühzeitige Entwicklung und Existenz und weiter die systematische Verfolgung eines radikalen “Programms”?
2. Sind seine Maßnahmen folgerichtig und als Einzelschritte zum Ziel anzusprechen oder bestimmen vorrangig ideologische Motive den Entscheidungsgang?
3. Gibt es eine Zäsur, einen Zeitpunkt oder ein Ereignis, von dem an das Gesetz des Handelns ihm aus der Hand glitt und ein System der Aushilfen unter Zugzwang die planende Politik ablöste?
4. Scheiterten Hitlers Großmachtambitionen an seiner eigenen Ideologie und seinen rassistischen, antisemitischen Wahnvorstellungen?62
Es wird der Versuch zu unternehmen sein, die im Einzelfall rücksichtslos mit hohem Risiko unternommenen Aktivitäten als Mosaiksteine eines zukünftigen Weltbildes oder als Zwischenziele auf dem Weg zur Realisierung einer Grundidee einzuordnen. Dann müßten die äußeren Ereignisse einer inneren Linie folgen. Ebenso gilt es zu verdeutlichen, wo ein solcher Kontext nicht oder nicht mehr erkennbar wird.
Teil I: Der Weg zum Führerstaat
3. Hitlers “Programm”
Bei der Beschäftigung mit Hitlers Plänen, Zielvorstellungen, Absichten und Visionen versteht man heute unter dem überwölbenden Begriff “Programm”63 die großen und letzten Ziele der konsequenten Machtpolitik sowie die dafür notwendigen Schritte. Das machtpolitische “Programm” ist deshalb klar vom Parteiprogramm64 seiner Na- tionalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) abzugrenzen. Hitler fixiert keineswegs eine aufzählbare Reihe von Einzelzielen. Der Ausdruck beschreibt die ausschließlich in der Person des “Führers” als Gedankengebäude manifesten Vorstel- lungen von der in eine fernere Zukunft projizierten Stellung Deutschlands in der Welt.
Von einem solchen “Programm” mit hinreichend konkretisierten Inhalten lässt sich in der frühen Kampfzeit von 1919 - 1923 kaum sprechen. Hildebrand verweist auf die in dieser Zeit noch durchaus konservativen und an die Politik der Kaiserzeit erinnernden Gedanken in Hitlers außenpolitischen Äußerungen65. Der Eindruck des von den “No- vemberverbrechern”66 ohne Not erbetenen Waffenstllstands und der erklärten Niederla- ge Deutschlands dürfte restaurativen Gedanken gebührend Raum verschafft haben. Die Wiederherstellung des zertrümmerten (Kaiser-)reichs ist ein vages Wunschbild, aber es bleibt noch weit entfernt von einem halbwegs strukturierten Programm für ein zukünftiges Großreich unter deutscher Vorherrschaft. Dieser Bewertung steht keines- wegs Hitlers schon damals überbordender Nationalismus und Antisemitismus und auch nicht sein manischer Blick zum ”Lebensraum im Osten” entgegen. Die formalen Umstände der Verhandlungen in Versailles, zunächst nur unter den alliierten und assoziierten Mächten, dann Konfrontation des besiegten Reiches mit einem für nicht abänderbar erklärten Vertragsentwurf67 die Symbolkraft des nicht zufällig gewählten Orts der Ausrufung des Deutschen Reichs am 18. Januar 1871 für die Unterzeich- nung, hatten den Charakter eines kompromißlosen Diktats ohne jede caesarische clementia. Die belastenden Bedingungen (Reparationen in Geld und Waren, Verlust großer Territorien, Ablieferung/Internierung der Kriegsflotte) und erniedrigenden Inhalte ( Alleinschuldartikel) weckten zwangsläufig heftige nationale Emotionen, auch ohne weitergehende machtpolitische Ambitionen68. Erst in der Summe konnte aus den unterschiedlichen Faktoren der Charakterzüge, den ersten Prägungen, traumatischen Kriegserlebnissen sowie den Verhältnissen im Nachkriegsdeutschland eine Überzeu- gung entstehen, die mit unterschiedlichen Gewichten aus machtpolitischem Ehrgeiz und ideologischem Fanatismus resultierte. Jäckel69 sieht im Zeitraum von 1919 bis 1924 in Hitlers außenpolitischem Konzept Wandlungen vom ”gewöhnlichen Revisio- nismus zum Lebenraumimperialismus”.
Haffner70 ist genauer, wenn er eine Unterscheidung vornimmt .Danach war der innen- politische Teil des “Programms” gewissermaßen als Schlussfolgerung aus der” unnöti- gen” Niederlage Deutschlands vom November 1918 bei Hitlers tatsächlichem Beginn seiner politischen Arbeit im Oktober 1919 weitgehend strukturiert71. Neben und nach diesem innenpolitischen Programmteil habe Hitler in den Jahren nach 1919 die außen- politischen Ideen entwickelt, die er später in seiner Kampfschrift artikulierte.
Dabei wäre es zu einfach, Hitlers Programmatik nur als Produkt aus einem über- steigerten Nationalismus und Antisemitismus unter der Klammer eines rücksichtslosen Machthungers anzusehen. Auf dieser Linie bewegt sich eine zu vordergründige Bewertung. Sie stützt sich auf Hitlers Selbstzeugnis in seinem Buch “Mein Kampf”, das heißt eigentlich nur auf die prophetische Aussage im 14. Kapitel über “Ostorientie- rung oder Ostpolitik”, die in der Prognose des Autors gipfelt: “Deutschland wird entweder Weltmacht oder überhaupt nicht sein”72. Tatsächlich ist das Werk, das ohne Änderung immer wieder neu aufgelegt und in Millionen von Exemplaren verbreitet wurde (Standesämter überreichten es dem Brautpaar bei der Trauung, es dürfte nach der Bibel das meistgedruckte Buch weltweit sein), immer wieder als schwer lesbar und über weite Strecken unverständlich eingestuft worden. Es gibt dafür eine banale, aber einleuchtende Erklärung. Mit diesem Argument konnte man dem Druck zur Lektüre der mehr als 700 Seiten damals vielfach ausweichen, heute will kaum noch jemand sich ernsthaft mit dem Machwerk auseinandersetzen. Hinzu kommt, dass es in Deutschland durch Strafandrohung nach § 86 des Strafgesetzbuchs nicht gedruckt oder vertrieben werden darf. Von der Befürchtung ganz zu schweigen, man bewege sich in geistiger
Nähe zum Nationalsozialismus. Jaeckel kommt etwas überraschend zu einem gegenteiligen Ergebnis73, er wagt es sogar74 hier einen “ungewöhnlichen Geist” des Urhe- bers zu attestieren, der zugleich “eine ungewöhnliche politische Kraft” bildete. Hitler habe in einem dreistufigen Prozeß zunächst vorhandene Ansichten - Antisemitismus und Revisionismus - aufgenommen, sie im zweiten Takt zu Radikalisierung und Expansionismus verstärkt und schließlich auf der dritten Ebene mit weiteren Elementen wie Daseinskampf und Sieg des Stärkeren zu einer geschlossenen Weltanschauung zusammengeführt. Um zu diesem durchaus innerlich distanzierten Urteil zu kommen, muss man allerdings zunächst Hitlers schwierigen Stil akzeptieren und sich darauf einlassen, seinen Gedankengängen zu folgen.
Hitlers Selbstverständnis erschöpfte sich aber gerade nicht in der Entwicklung und Ausformulierung eines Programms für eine innere und äußere Ordnung eines Gemein- wesens. Derartige Anschauungen und Überzeugungen bleiben im Regelfall theoreti- sche Gedankengebäude wie etwa bei Staatsrechtsphilosophen oder Gesellschafts- kritikern wie Karl Marx. Bei Hitler geht im November 1918 der unter dem Schock der Verkündung des Waffenstillstands geborene Entschluss voraus, “Politiker zu werden”75. Damit findet das spätere hitlersche Programm in seiner eigenen Person bereits eine Figur vor, die sich energisch für die Verwirklichung einsetzen wird. Hitler ist also nach seiner Selbsteinschätzung zugleich Politiker und Programmatiker, wobei er dieser Kombination Seltenheitswert zuspricht und sie deshalb für sich mit einem spürbaren Stolz in Anspruch nimmt76.
Radikaler Antisemitismus, die Überzeugung von unterschiedlicher Wertigkeit der Rassen und die Vorstellung von einem Großreich, keineswegs von einem Großdeutschland, verschmolzen zu einer spezifischen Vision . Hitler war nicht auf das deutsche Volk, die deutsche Nation fixiert. Überwölbend war für ihn die Rasse als Herrenrasse im von ihr beherrschten Raum. Eine Bestätigung für diese Fundamente seiner inneren Haltung findet sich später in der unterschiedlichen Behandlung der nordischen Bewohner Dänemarks und Norwegens nach der Besetzung und der slawischen Völker im Russlandfeldzug. Dass er sich mit der engeren deutschen Bevölkerung keineswegs identifizierte und von ihr “eiskalten” Abstand hielt, hat er bei zwei entlarvenden Gelegenheiten77 währen des Krieges selbst gesagt.
Hitlers “Mein Kampf”aus dem Jahr 1923 enthält keineswegs bereits das endgültige “Programm”, mögen diese Ideen in drei späteren Dokumenten aus den Jahren 1932- 1934, 1941-1942 und 1945 auch wieder auftauchen. Die von Haffner (s. o.) heraus- gestellten unterschiedlichen Entstehungszeiträume des innenpolitischen und des außenpolitischen Programms und das unterschiedliche Gewicht in seinem Buch spre- chen gegen ein bereits ausgeformtes außenpolitisches Konzept in dem frühen Zeit- punkt. Allein der tatsächlich ab September 1939 in Europa geführte Krieg belegt nicht überzeugend, dass dem noch politisch unerfahrenen Hitler des Jahres 1923 bereits ein Krieg, ein großes weltweites Ringen unter Beteiligung der USA als Gegner vorschweb- te .In den der Außenpolitik gewidmeten Kapiteln 13 - 15. des zweiten Bandes von “Mein Kampf” ergeht Hitler sich eher pathetisch-schwülstig über die Lage und die Absichten der großen europäischen Mächte, die “richtige” deutsche Außenpolitik und den derzeitigen Rang Deutschlands unter den Staaten. Der beispielhafte Satz: “Unsere Aufgabe..ist, unser eigenes Volk zu der Einsicht zu bringen, dass es sein Zukunftziel nicht im berauschenden Eindruck eines neuen Alexanderzuges erfüllt sieht, sondern vielmehr in der emsigen Arbeit des deutschen Pfluges, dem das Schwert nur den Boden zu geben hat”, sprechen eher gegen ein Weltmachtkonzept. Reinhardt zitiert eine Äußerung Hitlers, der im November 1941 der Meinung war, dass “der europäische Raum, den Deutschland sich durch seine bisherige Kriegführung gesichert habe, für die Zukunft des deutschen Volkes ausreichend sei78
4. Die zwanziger Jahre - Umrisse eines Weltbilds
Der am 20. April 1889 im österreichischen Braunau am Inn geborene Adolf Hitler kehrte 1918 als Gefreiter, dekoriert mit dem Eisernen Kreuz 1. Klasse, aus einem Krieg zurück, den das Kaiserreich zwar im Osten im Jahr 1917 mit dem Diktatfrieden von Brest-Litowsk überlegen hatte beenden können. Im Westen hatten sich die Verhält- nisse anders entwickelt. Nach definitiver Erschöpfung der militärischen Kräfte hatte die Oberste Heeresleitung die Politik ultimativ aufgefordert, Waffenstillstandsver- handlungen mit den Alliierten aufzunehmen. Die Reichsregierung akzeptierte als Vorbedingung die 14 Punkte des US-Präsidenten Wilson und ab 11. November 1918 schwiegen die Waffen, während die deutschen Truppen überall noch im Ausland standen.
Vor diesem Hintergrund keimte bei vielen Soldaten aller Ränge und in weiten, nicht nur deutsch-national oder konservativ gesonnenen Kreisen der Zivilbevölkerung die Dolchstoßlegende79, weil man sich in völliger Verkennung der tatsächlichen Lage “im Felde unbesiegt”80 wähnte. Diese Gefühl dürfte auch den “böhmischen Gefreiten”81 beseelt haben. .Für ihn war die Bekanntgabe des Waffenstillstands am 11. November 1918 ein tiefgehender Schock, ein Erweckungserlebnis82, das seinen Entschluss aus- löste, Politiker zu werden83. In seinen Augen hatten die politischen “Novemberver- brecher” den Krieg ohne militärische Notwendigkeit verloren gegeben. Hier liegt eine Wurzel für seine später regelmäßig polemisch gerittenen Attacken gegen die Reichsregierung, die das “Diktat von Versailles”84 angenommen hatte.
Bei diesen Angriffen gegen die offizielle deutsche Politik zeigte sich früh eine außergewöhnliche rhetorische Begabung und das in der Tat bemerkenswerte Gespür Hitlers, verbreitete Stimmungen und zum Teil nur unbewusste Abwehrhaltungen der Bevölkerung aufzunehmen, mit griffigen Formulierungen für die Angesprochenen fassbar zu machen und so propagandistisch auszunutzen. Ganz offensichtlich beruhte seine Fähigkeit, einen Zuhörerkreis und letztlich eine große Menschenmenge redne- risch einzufangen, in seinen Bann zu schlagen und Begeisterungsstürme zu entfachen, auf einem sehr spezifischen und überstark ausgeprägten demagogischen Talent, einer persönlichen Ausstrahlung, der sich nur Wenige zu entziehen vermochten85 Hitler war sich dieser Eigenschaft sehr bewusst, er setzte sie als Trommler seiner Partei erfolg- reich ein und versicherte sich später so der Zustimmung weiter Bevölkerungskreise86.
Am 16. September 1919 trat Hitler als Mitglied Nr..787 der von Anton Drexler am 05. Januar 1919 gegründeten “”Deutschen Arbeiterpartei” bei; sie war als “NationalsoziaProgramm der dann Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) vom listischer Deutscher Arbeiterverein” ins Vereinsregister eingetragen worden88 Das 25. Februar 1920 umfasste nach einer Präambel 25 Einzelforderungen. Hier taucht zwar die Forderung (Nr. 3) nach Land und Boden zur Ernährung des Volkes und Ansiedlung des Bevölkerungsüberschusses auf, konkrete Territorien sind aber nicht benannt.
Aus heutiger Sicht ist wie selbstverständlich die NSDAP im politischen Spektrum ganz rechts und extremistisch einzuordnen. Anknüpfungspunkte liefern die Überbeto- nung des völkisch-deutschen Elements, die rassistischen Parolen und die erklärt antisemitischen Programmsätze. Jedoch rechtfertigt ein Blick auf das Gesamtpro- gramm diese plakative Zuordnung nicht. Schon der im Namen auftauchende Teilbegriff “...sozialistisch” und der Parteiname als “Arbeiterpartei” weisen zur anderen politi- schen Seite. Unter den Exponenten des NS-Apparates steht Joseph Goebbels für diese eher antikapitalistisch.-sozialistische Richtung89. In diesem Umfeld war man durchaus russophil und sah eine ideologische Nähe zu den Kommunisten. So sah sich durch die Unterscheidung zwischen dem “schaffenden” und dem “raffenden” Kapital das Bank- gewerbe durchaus bedroht. Der Gegensatz zum Mainstream der NSDAP und damit zu Hitlers eigenen Auffassungen wurde nicht wirklich ausgeräumt, vielmehr fand Goeb- bels schließlich eine Brücke mit der von ihm entwickelten Definition, wonach Sozialis- mus die “Überordnung des Volksbegriffs über den Individualbegriff” bedeute. Hitler selber spricht von sich und seiner Partei im Plural regelmäßig mit der Wendung. “Wir Nationalsozialisten..”. Nach dem im “Horst-Wessel-Lied” immer wieder gesungenen Credo der Nationalsozialisten waren die politischen Gegner sowohl die “Rotfront”90 auf der einen Seite als auch die “Reaktion” am anderen Rand des Spektrums91.”. Heuss sieht als Generalnenner aller Gruppen, die zur NSDAP stießen, die gemeinsame antikapitalistische Gesinnung92.
Hierher gehört eine Begriffserklärung. Im Alltag sprach und spricht heutzutage niemand von “Nationalsozialisten”, üblich ist die Bezeichnung “Nazi” oder für die vorgeblichen Nachfolger “Neonazi”. Das Wort soll - ähnlich wie “Sozi” für Sozialis- ten/Sozialdemokraten - herabsetzend wirken oder die Betroffenen zumindest lächerlich machen. So muss, wer einen Sozialisten oder Sozialdemokraten als “Sozi” bezeichnet, mit einer Beleidigungsklage rechnen. Es kommt im Fall der NS-Anhänger jedoch eine politische Absicht hinzu. Anders als das Langwort vermeidet die Abkürzung jede Assoziation mit der linken Domäne des Sozialismus und etikettiert “Nazis” plakativ als durchgehend rechtsextremistisch.
Ein Streben nach Vormacht oder Herrschaftsposition in der internationalen Umge- bung ist im Parteprogramm der NSDAP nicht enthalten, als Forderung Nr. 3 erscheint das Verlangen nach Gleichberechtigung des deutschen Volkes gegenüber anderen Nationen. Der Ungeist des Nationalsozialismus kommt in Nr. 4 zum Ausdruck: “Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer
deutschen Blutes ist, ohne Rücksicht auf die Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein”. Eine genauere Lektüre ergibt, dass in mehr als der Hälfte der 25 Punkte des Parteiprogramms Forderungen gegen die Juden enthalten sind. Picker93 sieht in Hitlers Entscheidung für das Hakenkreuz als Symbol der NSDAP die Anknüpfung an das alte, weit verbreitete Kult-Zeichen der Germanen für die Sonne, das Gute und das Glück und zugleich ein Abwehr-Symbol gegen alles Jüdische, weil den Semiten dies Heilszeichen unbekannt gewesen sei94.
Der so dezidiert in das Parteiprogramm aufgenommene Antisemitismus war nun keineswegs neu oder überraschend. Noch weniger war er typisch deutsch. Er fand sich während der Industrialisierungsphase des 19. Jahrhunderts als reflexhafte Abwehr der Moderne. Die Produktion in großen Fabriken erforderte Kapital. Im Geld- und Kredit- geschäft waren jüdische Kaufleute lange vor den noch feudalistisch strukturierten Völkern Europas engagiert. Jüdische Bankiers kannten, betrieben und förderten die moderne kapitalistische Konkurrenzwirtschaft95. In der besonderen Nachkriegssituation nährte sich der Antisemitismus aus der vielerorts willig aufgenommenen Vorstellung, das Versagen in der Heimat hinter der Front, der Dolchstoß, sei auf planvolle und gezielte Aktionen der Juden zurückzuführen. Die Mär wurde um so leichter geglaubt, weil die Lehre von der unterschiedlichen Veranlagung verschiedener Rassen im ausgehenden 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit pseudo-wissen- schaftlichen Argumenten durchaus Anhänger gefunden hatte. So reichte es aus, auf die vielerorts sichtbaren Erfolge der Juden im Geschäftsleben und ihre internationalen Kontakte hinzuweisen, um Vorbehalte aufzubauen. Die recht abenteuerliche Version fand durchaus Anhänger, wonach die weltweit agierenden Juden planvoll die deutsche Industrie geschwächt und die alliierten Produktionskräfte gestärkt hätten, um so den tatsächlichen Ausgang des Krieges herbeizuführen. Tatsächlich dürfen eher Neid und Mißgunst einen erheblichen Anteil an dem zur Schau getragenen Antisemitismus gehabt haben.
Hitler selber versucht später den Eindruck zu vermeiden, er habe einfach die Vor- urteile seiner Umgebung gegen die Juden übernommen. Er will “das Wirken des jüdischen Volkes in ruhiger Klarheit einer Betrachtung unterzogen” haben. Zwar muss eher im Bereich der Vermutungen die Frage nach den frühesten Gründen und dem ersten Äußern antijüdischer Vorurteile bleiben. Die Quellenlage weist dann aber schon konkret in eine eindeutige Richtung. Danach ist zumindest für seine Jahr ein Wien, das heißt bis 1913, neben einem extrovertierten Nationalismus - er meldete sich im folgenden ersten Kriegsjahr 1914 freiwillig als Soldat - auch ein virulenter Antise- mitismus belegt96. Es erscheint richtig, hier ein Segment seiner Persönlichkeit weiter auszuleuchten. Offensichtlich hatte sich bei Hitler bereits 1920 die Grundüberzeugung von einer jüdischen Weltverschwörung und einem systematischen, im Verborgenen agierenden Streben nach umfassender Beherrschung der ganzen Welt gebildet97. Auch
der frühe Demagoge Hitler wird keine Bedenken gehabt haben, bewusste Unwahrheiten in eine Rede einzuflechten, aber die Häufung und die wechselnden Lebensbereiche, für die er den schädlichen jüdischen Einfluss entdecken zu müssen glaubte, nötigen zu dem Schluss, dass er in dieses Phase bereits weit über den in seinem Umfeld gepflegten Antisemitismus hinaus einen fanatischen, krankhaften Judenhass entwickelt hatte. Sonst wäre kaum erklärlich, warum er sich -wenn auch auf einer Parteiversammlung- nicht scheute, im Umgang mit Juden Unrecht für richtig und Inhumanität für gerechtfertigt zu erklären98.
Die Breite und Tiefe der hier schon sichtbaren Charakterzüge erlaubt den noch spekulativen Blick in die Zukunft der Persönlichkeit. Hitler wird mit allen Mitteln für seine extreme Form des Antisemitismus werben, ihn auf seine Fahnen schreiben und damit eben einen wesentlichen Teil seines politischen Programms bestreiten. Sodann wird er jedes ihm zukünftig zuwachsende Machtmittel mit Schwerpunkt antijüdisch einsetzen. Schließlich ist es dann nur logisch, wenn er seine feste Überzeugung vom Weltherrschaftsstreben der Juden als Ausgangspunkt nimmt, um selber eine herrschende Position anzustreben und so den Juden entgegenzutreten.
Andererseits liegen aus der “Kampfzeit” in den Jahren bevor Hitler 1924/1925 das Manuskript seines Buches “Mein Kampf” diktierte, keine verwertbaren Quellen vor, aus denen sich auf ein schon damals bestehendes Weltbild Hitlers als Vision oder Ziel eines langen Marsches seiner Ideen durch die Köpfe und Herzen der noch zu findenden und zu begeisternden Mitkämpfer schließen ließe. Die äußeren Umstände, das Umfeld der noch kleinen Gruppe nationalistisch gesinnter Genossen, die traumatischen Kriegserlebnisse sprechen eher dagegen. Die Formulierungen zu außenpolitischen Fragen sind nur in den letzten drei von insgesamt 27 Kapiteln enthalten. Sie weisen keineswegs schon klar in Richtung eines damals in der Person angelegten Strebens nach Weltherrschaft. Wenn Hitler als Ziel künftiger Außenpolitik des Deutschen Reiches die “Ostpolitik im Sine der Eroberung der notwendigen Scholle für unser deutsches Volk”99 aufzeigt, wissen wir heute, dass er damit überraschend deutlich, seine späteren Zielvorstellungen zu erkennen gab. Die Forderung erhält durch ein weiteres Element eine besondere Bedeutung. Auch wenn die Informationen über den Ablauf der russischen Oktoberrevolution nicht unbedingt ungeprüft richtig waren, entwickelte sich doch in Deutschland die instinktive Furcht vor ähnlichen Verhält- nissen. Es war nicht zuletzt Hitler, der in seinen Reden die Bolschewisten mit übelster Polemik verächtlich machte100 So konnte sich die Forderung nach Lebensraum im Osten quasi mit dem Streben nach Abwehr der marxistischen Revolution und der “Vernichtung und Ausrottung der marxistischen Weltanschauung” verbinden.
[...]
1. Ausdruck des amerikanischen Diplomaten George Kennan, englisch “original catastrophe”
2. The Great War, La Grande Guerre
3. Stevenson a.. a. O. S.594
4. Von den etwa 120.000 britischen Soldaten, die zu Beginn der Somme-Schlacht am 01. Juli 1916 die deutschen Stellungen angriffen, wurden an diesem Tag über 19.000 getötet und etwa 57.000 verwundet (Stevenson a. a. O. S. 209). Zusätzlich wurden etwa 21.000 Mann als vermisst gemeldet. Bei Abbruch der Schlacht im Herbst 1916 waren die Gesamtverluste der Angreifer größer als die der Verteidiger, ohne dass ein nennenswerter unmittelbarer Vorteil errungen worden wäre.
5. Symbolischer Handschlag zwichen Amerikanern und Russen am 25. April 1945
6. Rebenich a. a. O., S, 34/35
7.Der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann wurde Ende 1933 Mitglied im Bund Natinalsozialistischer Deutscher Juristen und trat der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt bei, Treffke a. a. O. S. 73
8.Hier ist nicht der Raum,, um auf die prinzipiellen Unterschiede zwischen der Ideologie des Nationalsozialismus und des Faschismaus einzugehen.
9. Am 19./20. September 2008 blockierten in Köln Gegendemonstranten den Zugang zu einem “Anti-Islamisierungskongress” der Bürgerbewegung “Pro Köln”, die den Bau der Großmoschee im Kölner Stadtteil Ehrenfeld verhindern wollte. Am 01. Mai 2010 nahm Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse in Berlin an einer Sitzblockade gegenn eine geplante Demonstration von Rechtsextremisten teil
10. § 21 des Versammlungsgesetzes sieht Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor.
11. Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole, strafbar nach § 86 a Strafgesetzbuch in Verb. mit § 86 Abs. 1 StGB
12. Refrain der “Internationale”
13. Eingangszeilen der dritten Strophe des Horst-Wessel-Liedes der Nationalsozialisten
14. Dagegen sind die kommunistischen Verbrechen - wohl mangels vorhandener oder bekannter Quellen - in der öffentlichen Erinnerung kaum präsent. (Vgl. Karl Peter Schwarz: Das grausige Geheimnis der Partisanen, FAZ 15. April 2009, S. 7). So töteten etwa Titos Partisanen bei Gottschee 50.000 Landsleute (Gebhardt, Band 21, S. 372)
15. Die Bundeswehr tut sich seit Aufstellung ihrer ersten Verbände Ende 1955 schwer, in der soldatischen Traditionspflege der Wehrmacht und ihren Soldaten einen wohl angemessenen Platz einzuräumen. Zur Traditionsproblematik jetzt sehr ausgewogen unter der Kapitelüberschrift “Reflexion und Ausblick” Roth a .a. O. S. 263 ff.
16.In einer Grundsatzentscheidung vom 16. November 2009 hat das Bundesverfassungsgericht Gedenkveranstaltungen für den Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß als strafbare Verherrlichung des NS-Regimes eingestuft. Di entsprechende Strafvorschrift in § 130 Abs. 4 des StGB sei zwar kein allgemeines Gesetz, wie es Artikel 5 Abs. 2 des Grundgesetzes für zulässige Einschränkungen der Meinungsfreiheit verlange, jedoch müsse in Bezug auf den Nationalsozialismus eine Ausnahme gelten - Az 1 BvR 2150/08. Damit legalisiert der Rechtsstaat eine einfachgesetzliche Ausnahmevorschrift als zulässige Durchbrechung seiner Prinzipien.
17.a. a. O. z .B S. 319 ff
18. Rainer Blasius in einem Artikel “Das Amt und der 20. Juli” (FAZ vom 20. Juli 2011, S. 6)
19. Treffke a. a. O. S. 73
20. Evans, Band III, S. 949 -
21. Ergebnis des preußischen Erlasses zur “Judenzählung” vom 01. November 1916
22. Die Lesart, wonach es sich bei allen Maßnahmen nur um Teil einer systematischen Kriegsvorbereitung gehandelt habe, argumentiert ausschließlich vom Ergebnis, nämlich dem tatsächlich folgenden Krieg her.
23. Rommel a.a. O. S. 37
24. Ein bekanntes Beispiel ist der Unterschied in der Stubenordnung von Wehrmacht und SS. Soldaten mußten ihren Spind ständig abschließen, ein Verstoß galt als ahndungswürdige Anstiftung zum Kameradendiebstahl. Bei der SS waren die Schränke offen.
25. Sie beseitigte im internen Dienstgefüge den Unterschied zwischen Offizieren und Unteroffizieren indem sie durchgängig alle Funktionsträger als Führer auf den unterschiedlichen Ebenen ihrer Gliederung, also Rotten-, Sturm-, Sturmbann- Gruppenführer usw. einstufte. Die Vorgesetzten waren nur mit dieser Funktionsbezeichnung, also ohne “Herr” anzusprechen
26. Hartmann, Wehrmacht im Ostkrieg, betont in seinem dort vorangestellten Prolog, ( S. 2 - 10) wie schwierig es ist, die ganze Bandbreite von unterschiedlichen Arten der Kriegführung im Osten zwischen den Extremen der weitgehenden Rechtstreue und der rücksichtslosen Vernichtung in ihren Größenverhältnissen zu erfassen.
27.Diese Freude hat sehr divergierende Gründe. Der italienische Ministerpräsident Giulio Andreott hatte 1984 gefordert: “Es gibt zwei germanische Staaten und zwei müssen es bleiben.” (Zitiert bei Scholtyseck im Aufsatz: “Staatskunst und “Kunst der Diplomatie” 1989/1990, im Sammelband “20 Jahre Deutsche Einheit” S. 32)
28. Rommel a.a .O. S. 252, der auf den psychologischen Effekt hinweist, wonach auch Kriege, die gegen den Willen der Bevölkerung begonnen wurden, mit Begeisterung fortgeführt werden, sobald die ersten Opfer gebracht sind.
29.Haffner, Anmerkungen zu Hitler, S. 146
30.Allein für die Jahre 2008/2009 lassen sich etwa 19 “Krisen” (z. B. der Machtkampf zwischen Regierung und Opposition in Kenia oder der Terror in Irak) und 9 Kriege ( z.B. der georgisch-russische Krieg um Südossetien oder der Krieg islamistischer Gruppen in Somalia gegen die Regierung in Mogadischu) registrieren.
31.Der Krieg zwischen Iran und Irak in den Jahren von 1980bis 1988 dauerte länger als der Zweite Weltkrieg in Europa. Allein in diesem Krieg verloren nach Schätzungen etwa 1 Million Menschen ihr Leben. Die Besetzung Afghanistans durch Russland in der Zeit zwischen 1979 und dem Rückzug der Russen 1989 forderte zwischen 1 und 1,5 Mio Menschenverluste
32.Die fortdauernden Diskussionen und die Abstimmungsergebnisse im Deutschen Bundestag bei Beschlüssen zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr sprechen eine beredte Sprache
33. Die Vertreter dieser Auffassung werden nach dem englischen Unterstaatssekretär Vansittart als “Vansittartisten” bezeichnet.
34.Das Argument stützt sich auf die kurze Folge der deutschen Einigungskriege zwischen 1864 und 1871 sowie die - insbesondere aus französischer Sicht schwer hinnehmbare - Tatsache, dass Deutschland ab 1870 in weniger als 80 Jahren dreimal in Frankreich eingefallen ist.
35. Ob die Bezeichnung als “Neonazis” zutreffend oder nur Abwehrreflexe weckend gebraucht wird, kann hier dahinstehen.
36..Die Theorien vom bellum iustum ( Stichworte bei Repgen a.. a. O S. 11), dem ius ad bellum im Unterschied zum ius in bello, also dem ursprünglich nur Staaten zugebilligten Recht, einen Krieg beginnen zu dürfen in Abgrenzung zu der Frage, wie und mit welchen erlaubten Mitteln er zu führen ist, werden hier nicht behandelt.
37. Artikel 231 a. a. O.
38. Hofer a. a. O.
39. W. Rahn in “Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg”, Band 6, S. 183
40. W. Rahn , a. a. O. S. 196
41. Bernd Wegner: “Wann begann und wann endete der Zweite Weltkrieg?”- FAZ, Mittwoch, 12. August 2009, S. N 3)
42. Zeitgleich mit England: Australien, Burma, Ceylon, Indien, Jordanien, Kambodscha, Laos, Marokko, Neuseeland, Tunesien und Vietnam; am 06.September 1939 folgte Südafrika und am 10. September 1939 noch Kanada. Bis zum Kriegsende in Europa wurden es insgesamt 53 Staaten, von denen sich viele nicht aktiv an den Feindseligkeiten gegen Deutschland beteiligten.
43.vgl auch die Fiktion des eingetretenen Verteidigungsfalls in Art 115a Abs. 4 des Grundgesetzes, falls das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird.
44.Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde durch japanische Unterhändler an Bord des US-Schlachtschiffs Missouri in der Bucht von Tokio
45.Weinberg a. a. O. S. 2/3
46. Deutsche Außenpolitik 1933 - 1945, Kalkül oder Dogma ? (siehe Literaturliste)
47.Der Zweite Weltkrieg - Kriegsziele und Strategie der Großen Mächte (siehe Literaturliste)
48.Die Westmächte planten z. B. ernstlich, die Öleinfuhr Deutschlands aus Russland durch Bombardierung der russischen (!) Ölförderzentren im Raum Baku, Batum, Poti und Grosnij zu unterbinden, a. a. O. S. 36/37.
49. a. a. O. S.11-53
50.Sie ist Teil I des Versailler Vertrages vom 28. Juni 1919. In Artikel 1 Abs. 1 wird “ausdrücklich festgestellt, dass jeder Krieg und jede Bedrohung mit Krieg, mag davon ein Bundesmitglied betroffen werden oder nicht, eine Angelegenheit des ganzen Bundes ist und das dieser zum wirksamen Schutz des Völkerfriedens erforderliche Maßnahmen zu ergreifen hat.”
51.Der “Vertrag zur Ächtung des Krieges”, RGBl 1929 II, S. 97, verpflichtet die Vertragsschließenden, auf den Krieg als Werkzeug nationaler Politik zu verzichten. Sie verurteilen zugleich den Krieg als Mittel für die Lösung internationaler Streitfälle
52.Das IMT verhandelte insbesondere wegen folgender vier neu geschaffenen Straftatbestände: 1. Verschwörung gegen den Frieden, 2. Verbrechen gegen den Frieden, 3. Verbrechen gegen das Kriegsrecht, 4. Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dabei erlaubten die ersten beiden Punkte die Verurteilung für Planung, Vorbereitung , Führung und auch nur Teilnahme an einem Angriffskrieg. Vor dem IMT wurden zwischen dem 01. Oktober 1946 und dem 14. April 1949 insgesamt 13 Verfahren gegen 199 Angeklagte geführt und mit einem Urteil beendet. Gegen 36 Angeklagte erging ein Todesurteil,davon wurden 18 vollstreckt, in 23 Fällen verhängte daas Gericht lebenslängliche Freiheitsstrafen, 39 Personen wurden freigesprochen, der Rest erhielt Freiheitsstrafen zwischen eineihalb und 25 Jahren.
53. Messerschmidt in “Das Deutsche Reich..und der Zweite Weltkrieg”,. Band 1, S. 160
54. Dies wird sehr deutlich durch die ersten Ziele der Besatzungsmächte in Deutschland ab Mai 1945 belegt. Neben der Demilitarisierung, Deindustrialisierung und Demokratisierung war die Denazifizierung nur ein weiterer Punkt.
55. Hubatsch, Weserübung,, S. 21/22 Aufschlußreich in diesem Kontext ist auch das finnische Hillfeersuchen an England und Frankreich mit der Bitte um Unterstützung im finnisch-russischen Winterkrieg 1939/1940. Allein die Vorstellung von englisch-französischen Truppen im Ostseebereich bewog Rußland zum Abbruch des Krieges und zu Friedensschluss mit Finnland am 12. März 1940 - Hubatsch a.a. O. S.20.
56. Weserübung, Details in Hubatschs Darstellung, siehe Literaturverzeichnis
57.Als Eckpfeiler der systematischen Ausdehnung der amerikanischen Machtsphäre im Nordatlantik im Rahmen der “short-of war-Politik” gegenüber Deutschland
58.siehe Literaturverzeichnis
59. a.a. O. S. XXI
60. Hoßbach a. a. S. 217
61.Erlass vom 02. August 1934 (RGBl I S 751) zum Gesetz über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches vom 01. August 1934 (RGBl I S. 747)- Aus “Respekt” vor dem verstorbenen Hindenburg “verzichtet” Hitler auf den Titel des Reichspräsidenten. Es soll bei der Anrede als “Führer und Reichskanzler” bleiben.
62.Haffner, Anmerkungen zu Hitler, S. 21
63.Nolte, a. a. O. S. 452
64. Hofer a.a. O. S. 411 zitiert aus der Diagnose eines Psychiaters (Prof. Schaltenbrand): Hitler muß in jene Gruppe schwer charaktergestörter Menschen gereiht werden, die wir als Psychopathen bezeichnen. Er ist ein seelisch Abnormer, der zur Bildung abnormer Vorstellungen neigte und auch zu abormalen gefühlsmäßigen Reaktionen. Seine Vorstel-lungen tragen einen paranoischen Zug und seinen Reaktionen fehlen jene Hemmungen, die ein gesunder Mensch durch Erziehung erwirbt
65.Anm. Ausdruck erstmals so bei H .R. Trevor-Roper: Hitlers Kriegsziele, in: Stationen der deutschen Geschichte 1919-1945, Internationaler Kongress zur Zeitgeschichte, Hrsg. Von B. Freudenfeld, Stuttgart 1962, S. 9/10. Der Verfasser spricht dort von einem “radikalen Programm”, auf das bereits Hitlers Buch “Mein Kampf” einen eindeutigen Hinweis gebe
66.Abdruck z. B. bei Grimm a. a. O. S. 216 - 220.
67. Hildebrand, Deutsche Außenpolitik 1933 - 1945, Kalkül oder Dogma?, S. 25
68. Ein wohl nicht von Hitler stammender, aber von ihm gern gebrauchter Ausdruck für die Verantwortlichen des Waffenstillstands vom 11. November 1918.
69. Details bei Haffner, Der Vertrag von Verdailles, siehe Literaturverzeichnis 6. Die Selbstversenkung der in Scapa Flow.internierten Flotte unter Admiral von Reuter am 21. Juni 1919 wurde in Deutschland als Triumph empfunden. Wir ordnen heute das Handeln der damals verantwortlichen deutschen Seeoffiziere als einem unsinnigen, überkommenen Ehrbegriff entspringend ein. In ähnlicher, nicht vergleichbarer Lage entzog sich die im Hafen von Toulon liegende französische Flotte am 27.. November 1942 durch Selbstversenkung dem deutschen Zugriff während der militärischen Besetzung Südfrankreichs. Es handelte sich immerhin um 77 Einheiten, darunter 3 Schlachtschiffe,7 Kreuzer und 32 Zerstörer. Einzelheiten zum deutschen Unternehmen “Anton” in: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, Band 6, S. 124 und S. 741 - 745. Auch die dänischen Marineoffiziere, die am 29. August 1943 die dänische Flotte versenkten, handelten aus diesem Motiv.
70.Jäckel, Hitlers Weltanschauung, S. 125
71. Anmerkungen zu Hitler, S. 18-21 9.Dabei unterlegt Haffner dem Obersatz “Nie wieder ein November 1918" insgesamt neun Einzelziele, von denen allerdings nur die ersten fünf daraus herleitbar sind, nämlich Vermeidung einer Revolution, Schaffung der Lage wie 1918, Wiederaufnahme des Krieges, Verfaßtheit ohne revolutionäre Kräfte und Abschaffung aller linken Parteien. Schon bei dem sechsten Teilziel, der Gewinnung der linken Arbeiterschaft für eine neue Form des Sozialismus, also den Nationalsozialismus, ist der Zusammenhang kaum noch erkennbar, bei den Schritten sieben bis neun, Ausrottung des Glaubens an den Marxismus, physische Vernichtung der marxistischen Politiker und Intellektuellen und letztlich Ausrottungsfeldzug gegen alle Juden, fehlt er völlig
72. a. a. O. S. 741
73. Hitlers Weltanschauung, S. 129
74.a.. a. O. S. 139
75. Mein Kampf, S. 225
76. a. a. O. S. 229-232
77. Hitler am 27. November 1941 im Gespräch mit dem dänischen Außenminister Scavenius und am 27. Januar 1942
78. Reinhardt a. a. O. S. 142
79. Hierzu ausführlich Rainer Sammet a. a. O., der darunter alle Erklärungsversuche subsumiert, wonach der Krieg nicht notwendig verloren gegeben werden mußte und die dabei die Ursache nicht primär in der Überlegenheit der Entente sehen.
80. Wie verbreitet und auch ganz offiziell unterstützt diese Interpretation war, lässt sich an den Begrüßungsworten des Reichspräsidenten Ebert am 10. Dezember 1918 für die heimkehrende Garde am Brandenburger Tor ablesen: “Eure Opfer und Taten sind ohne Beispiel. Kein Feind hat Euch überwunden. Erst als die Übermacht der Gegner an Mensch und Material immer drückender wurde, haben wir den Kampf aufgegeben. (..) Erhobenen Hauptes dürft Ihr zurückkehren.” ( zitiert nach Sammet a.a. O. S. 67). Bemerkenswert an Eberts Ansprache, der selbst zwei Söhne verloren hatte, ist der symbolträchtige Ort, an dem die siegreich heimkehrenden Truppen der Jahre 1815, 1864, 1866 und 1871 empfangen worden waren. Ob im übrigen Großadmiral Dönitz für den letzten OKW-Bericht vom 09. Mai 1945 Eberts Rede herangezogen hat, lässt sich nur vermuten. Immerhin heißt es dort (Salewski, Deutsche Quellen, S. 311: “...Die deutsche Wehrmacht ist am Ende einer gewaltigen Übermacht ehrenvoll unterlegen. ....Der deutsche Soldat hat, getreu seinem Eid, in höchstem Einsatz für sein Volk für immer Unvergeßliches geleistet....Die einmalige Leistung von Front und Heimat wird in einem späteren gerechten Urteil der Geschichte ihre endgültige Würdigung finden...Jeder Soldat kann deshalb die Waffe aufrecht und stolz aus der Hand legen...
81. Abfällige Bezeichnung, deren Herkunft nicht belegt ist. Sie dürfte sich insbesondere bei Hitler gegenüber kritisch eingestellten Soldaten einer gewissen Beliebtheit erfreut haben.
82. Haffner a. a. O. S. 189
83. Mein Kampf, S. 225
84.Die nicht nur in der hitlerschen Polemik übliche Bezeichnung knüpft an den Umstand an, dass der Inhalt einseitig von den Siegermächten konzipiert/”diktiert” und nicht verhandelbar war.
85. Haffner spricht von hypnotischer Fähigkeit, a. a. O. S. 21.
86. Hitler wörtlich: “Der Redner... wird sich von der breiten Masse immer so tragen lassen, dass ihm daraus gefühlsmäßig gerade die Worte flüssig werden, die er braucht, um seinen jeweiligen Zuhörern aus dem Herzen zu sprechen” - a. a. O. S. 527
87. Mein Kampf, S. 244; Zentner (a. a. O. S. 76) macht deutlich, dass Hitler in Wirklichkeit als 55. Mitglied der DAP beigetreten war und nachträglich die Mitgliedsnummer 7 gefälscht wurde.
88. Grimm, Der Nationalsozialismus - Programm und Verwirklichung, S. 42. Fest stellt deutlich heraus, dass der Nationalsozialismus lediglich eine “Spielart dieser Protest- und Widerstandsbewegung europäischen Zuschnitts” war, “die sich anschickte, den Weltzustand umzukehren.”, a. a. O. S. 130
89. Graml a. a. O. S.149; bezeichnend ist auch die polemische Unterscheidung zwischen dem “schaffenden” und dem “raffenden” Kapital.
90. Der “Rotfront-Kämpferbund” war die paramilitärische Truppe der KPD, zur SPD gehörte das “Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold”, der “Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten” stand der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) nahe, die NSDAP hatte ihre SA.
91. Die Textzeile in der ersten Strophe des Liedes lautet: “Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen”
92. Hitlers Weg, S. 165
93. a. a. O. S. 13
94. Es würde daher der Herkunft des Symbols mehr entsprechen, wenn es nicht als Kreuz sondern als Rune bezeichnet würde, die aus zwei übereinander gelegten gewinkelten Linien besteht.
95. Anm. Fest a. a. O. S. 139
96. a. a. O. S. 59 ff; Fest ist vorsichtiger, wenn er es nur für wahrscheinlicher hält, dass “Ansatz und Richtung des Weltbildes vom ideologischen Milieu der oberösterreichischen Landeshauptstadt vorgeprägt” worden sind.
97. Schubert: Anfänge nationalsozialistischer .Außenpolitik, S, 27
98.Schubert a.a. O..S. 29
99. Mein Kampf S. 757
Häufig gestellte Fragen zu "Inhalt"
Worum geht es in dem Vorwort?
Das Vorwort thematisiert die Abwehrhaltung gegenüber Adolph Hitler und dem Nationalsozialismus, bedingt durch Abscheu vor den Verbrechen des Regimes und Unverständnis für die damalige Unterstützung oder Tolerierung durch die Bevölkerung. Es kritisiert die Vereinfachung des historischen Verständnisses und plädiert für eine analytischere Rückschau.
Was ist der Inhalt von Teil I: Der Weg zum Führerstaat?
Dieser Teil behandelt Hitlers "Programm", seine Anfänge in den 1920er Jahren und die Entwicklung seines Weltbildes. Es wird untersucht, wie sich dieses "Programm" nach dem 30. Januar 1933 in der Politik manifestierte und wie es sich zum Parteiprogramm verhielt.
Was behandelt Teil II: Schritte zum Krieg- die Idee der Großmachtposition als Ziel?
Teil II analysiert die außenpolitischen Schritte, die zum Krieg führten, wobei die Idee der Großmachtposition als zentrales Ziel betrachtet wird. Es werden der Nichtangriffspakt mit Polen, das Flottenabkommen mit England, die Rheinlandbesetzung, der Anschluss Österreichs, das Münchener Abkommen, der "Griff nach Prag" sowie die Kriegsplanung und Strategie untersucht.
Womit beschäftigt sich Teil III: Idee oder Ideologie als Gesetz des Handelns?
Dieser Teil untersucht, ob Ideologie oder rationale Überlegungen die Handlungen des NS-Regimes bestimmten. Behandelt werden der Überfall auf Polen, die "Weserübung", der Feldzug im Westen, die Optionen nach dem Waffenstillstand mit Frankreich und die Gründe für den Angriff auf Russland.
Was wird in Teil IV: Zugzwang oder Ideologie statt Vernunft behandelt?
Teil IV analysiert die Kriegswende 1941, den Weg in den Krieg mit den USA, die Konferenz von Casablanca, die Rolle der Ideologie vor der Strategie, den planvollen Mord und die Invasion 1944 als faktisches Ende der deutschen Außenpolitik.
Welchen Inhalt haben Teil V: Ergebnisse und Erkenntnisse, Schlussbetrachtung, Anmerkungen, Literatur?
Teil V fasst die Ergebnisse und Erkenntnisse der Arbeit zusammen. Die Schlussbetrachtung bewertet Hitler als "Finis Germaniae". Es folgen Anmerkungen und ein Literaturverzeichnis.
Was sind die Hauptthemen der Einleitung?
Die Einleitung behandelt das Thema im heutigen Umfeld, wobei die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg, die Schrecken des Zweiten Weltkriegs und die veränderten Perspektiven im Laufe der Zeit diskutiert werden. Es wird auf die Bedeutung einer objektiven Beschreibung der Geschehnisse und auf die Rolle der Geschichtswissenschaft eingegangen.
Welche Fragen werden in der Aufgabenstellung der Arbeit formuliert?
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit Hitler die Idee einer Großmacht Deutschland auf dem Weg zur Weltmacht verfolgte. Es werden folgende Fragen untersucht: Entwicklung eines radikalen Programms, Einfluss ideologischer Motive, Zäsur in der Handlungsweise und Scheitern an der eigenen Ideologie.
Was beschreibt Abschnitt 3: Hitlers “Programm”?
Dieser Abschnitt thematisiert den Begriff "Programm" im Kontext von Hitlers Machtpolitik, abgrenzt vom Parteiprogramm. Es wird die Frage aufgeworfen, ob in der frühen Kampfzeit bereits ein solches Programm mit konkretisierten Inhalten existierte.
Was beinhaltet Abschnitt 4: Die zwanziger Jahre - Umrisse eines Weltbilds?
Dieser Abschnitt beschreibt Hitlers Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg, seine Teilnahme an der Deutschen Arbeiterpartei und die Entwicklung seines Weltbildes in den 1920er Jahren, inklusive seines Antisemitismus.
- Citation du texte
- Hans Friedrich zur Nieden (Auteur), 2011, Idee oder Ideologie? Hitlers Politik und Strategie als Schritte seines "Programms", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167165