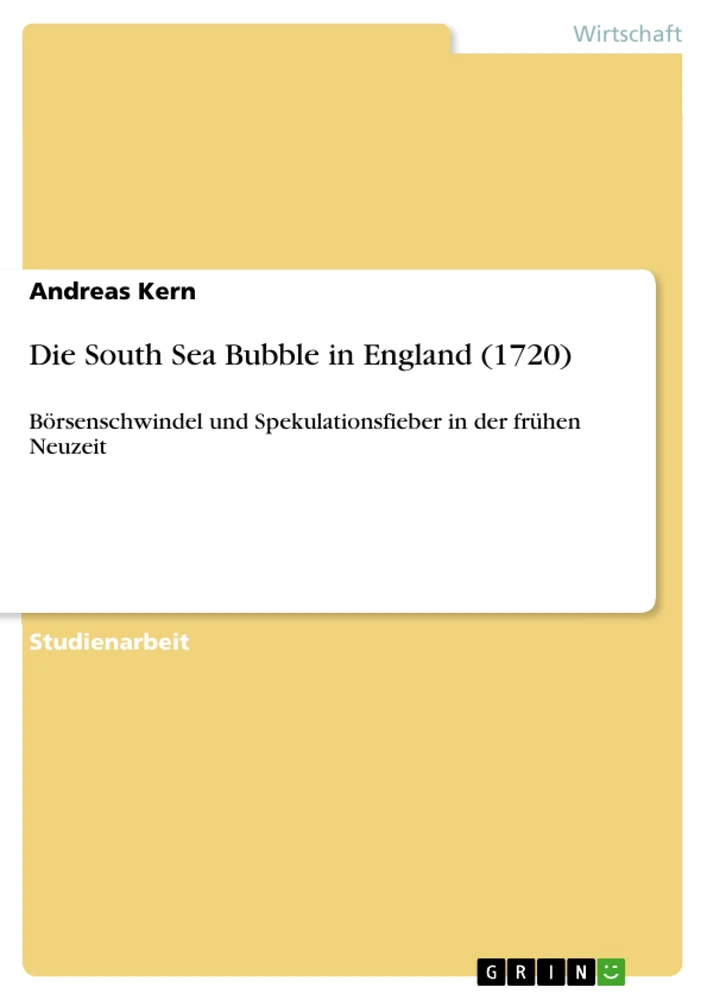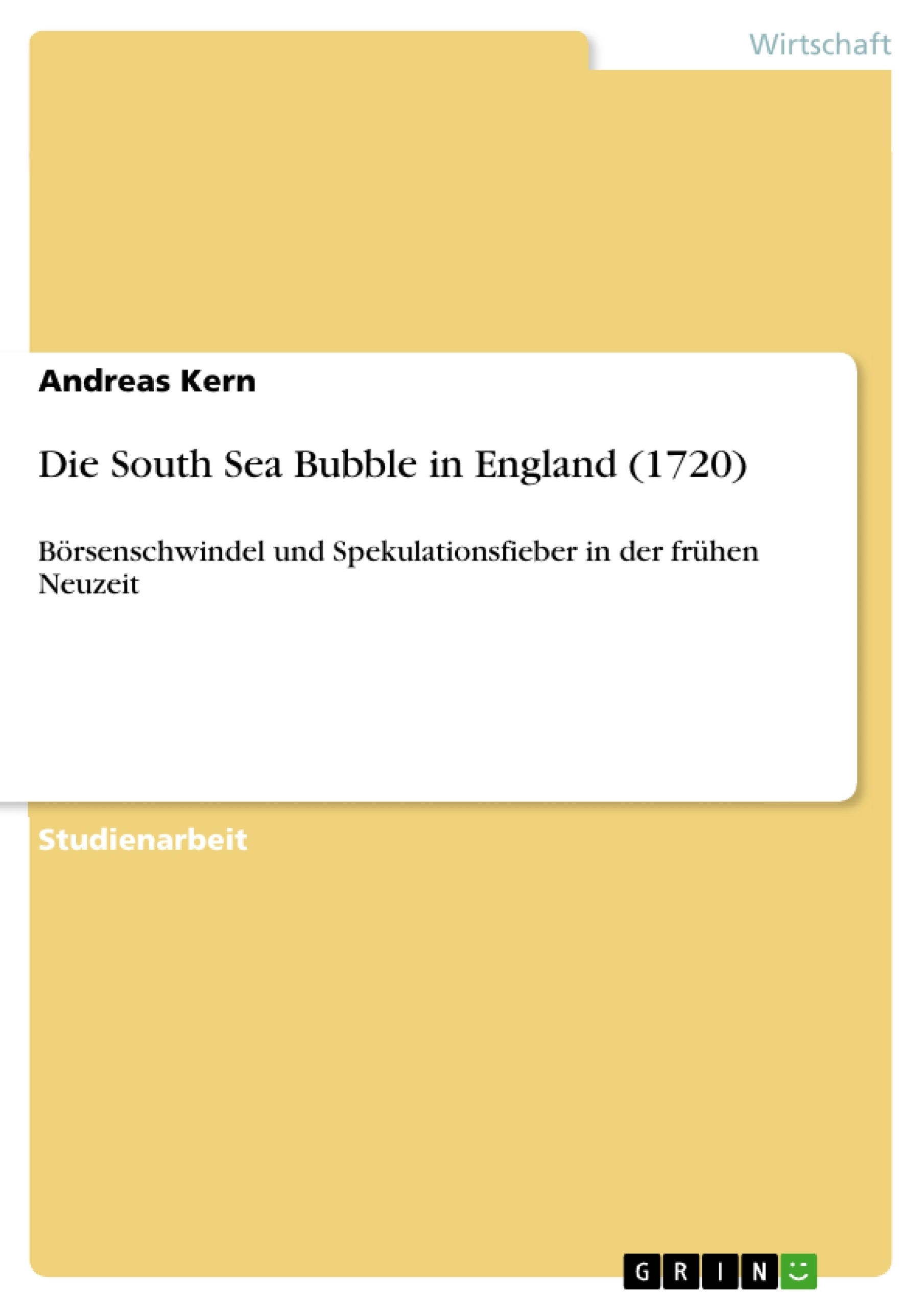Das Platzen der „South Sea Bubble“ markiert einen der bekanntesten und größten Börsencrashs der vorindustriellen Epoche. Das Unglück ereignete sich im Jahr 1720, als die Aktie der „South Sea Company“ innerhalb weniger Monate einen fulminanten Höheflug erlebte, und danach noch im selben Jahre ebenso schnell wieder abstürzte. Der bewusst gewählte Name der Handelsgesellschaft suggerierte den Anteilsnehmern sich am hochprofitablen Südseehandel (Ausbeutung der südamerikanischen Kolonien) zu beteiligen. Vielmehr wurden jedoch niemals nennenswerte Gewinne im scheinbaren „Kerngeschäft“ der Gesellschaft erwirtschaftet. Stattdessen fungierte die „South Sea Company“ überwiegend als gewöhnlicher Finanzdienstleister dessen maßgebliches Hauptgeschäft die Refinanzierung der britischen Staatschulden darstellte. Dank günstiger Konditionen und Verflechtungen mit der Politik, hielt die vermeintliche Handelsgesellschaft gegen 1720 bereits über 80% der britischen Staatsschulden.
Die „South Sea Bubble“ in London, wie sie schon von den Zeitgenossen genannt wurde, war mit dem Law' schen Börsenfieber in Paris und dessen Mississippigesellschaft sehr gut zu vergleichen. Auch hier war der unmittelbare Zweck die Ablösung der drückenden Staatsschulden, wobei man das Anlegerpublikum ebenfalls mit der Suggestion ferner Schätze in den Kolonien köderte. Der einzige Unterschied bestand, darin das Law seine Wirkungsstätte als armer Mann verließ – somit mutmaßlich an sein System geglaubt hatte – während die Drahtzieher der „South Sea Company“ rechtzeitig ihre Schäfchen ins Trockene brachten und das sinkende Schiff sich selbst überließen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangslage – Geschichtlicher Rahmen
- Politische und Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
- Leere (Kriegs-)Kassen
- Refinanzierung der Schulden
- Gründung der „South Sea Company“
- Gründungsväter
- Startkapital gewürzt mit Südseephantasien
- Entwicklung des Kerngeschäfts
- Kursverlauf und Kapitalerhöhung
- Staatschulden
- 1720-,,Entregulierung“ des Finanzmarktes
- Kursfeuerwerk, die Blase steigt auf
- Grassierendes Spekulationsfieber
- ,,Bubble Gesellschaften“
- Die Talfahrt
- Katzenjammer
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beleuchtet das Platzen der „South Sea Bubble“ im Jahr 1720, einen der größten Börsencrashs der vorindustriellen Zeit. Die Analyse fokussiert auf die Gründung der „South Sea Company“, deren Kerngeschäft und die daraus resultierende Spekulationsblase. Der Text untersucht die historischen und ökonomischen Rahmenbedingungen, die zur Entstehung der Blase führten, und beleuchtet die Rolle der politischen und wirtschaftlichen Akteure.
- Die Entstehung und Entwicklung der „South Sea Company“
- Die Rolle der Staatsverschuldung und deren Refinanzierung
- Das Spekulationsfieber und die Bildung der „Bubble“
- Der Zusammenbruch der „South Sea Company“ und die Folgen
- Vergleich mit ähnlichen Finanzkrisen der Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema „South Sea Bubble“ ein und erläutert die Bedeutung des Börsencrashs im Jahr 1720. Das zweite Kapitel beleuchtet die politische und wirtschaftliche Rahmenlage in England zu Beginn des 18. Jahrhunderts, inklusive der Folgen der kriegerischen Auseinandersetzungen und der daraus resultierenden Staatsverschuldung. Kapitel drei widmet sich der Gründung der „South Sea Company“ und ihrer Gründungsväter, sowie der Finanzierung des Unternehmens durch die Umwandlung von Staatsschulden in Aktien. Das vierte Kapitel beschreibt die Entwicklung des Kerngeschäfts der Gesellschaft, während Kapitel fünf den Kursverlauf der Aktien und die Kapitalerhöhung beleuchtet. Kapitel sechs untersucht das Spekulationsfieber, die Entstehung der Blase und deren Zusammenbruch.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die „South Sea Bubble“, die „South Sea Company“, die britische Staatsverschuldung, das Spekulationsfieber, den Börsencrash von 1720, den historischen Kontext, die politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen sowie die Rolle der Akteure in der Entstehung der Blase.
Häufig gestellte Fragen
Was war die „South Sea Bubble“?
Die South Sea Bubble war ein massiver Börsencrash im Jahr 1720 in England, ausgelöst durch eine Spekulationsblase rund um die Aktien der South Sea Company.
Was war das eigentliche Geschäft der South Sea Company?
Obwohl sie als Handelsgesellschaft für Südamerika auftrat, bestand ihr Hauptgeschäft in der Refinanzierung der britischen Staatsschulden.
Wie entstand das Spekulationsfieber?
Durch die Suggestion unermesslicher Schätze in den Kolonien und enge Verflechtungen mit der Politik wurden Anleger zu massiven Investitionen gelockt.
Was unterscheidet die South Sea Bubble vom Law’schen System in Paris?
Während John Law in Paris mutmaßlich an sein System glaubte, brachten die Drahtzieher der South Sea Company ihre Gewinne rechtzeitig in Sicherheit, bevor die Blase platzte.
Was waren die Folgen des Crashs?
Der Zusammenbruch führte zu ruinösen Verlusten für tausende Anleger und hinterließ einen tiefen „Katzenjammer“ in der britischen Gesellschaft und Wirtschaft.
- Quote paper
- Andreas Kern (Author), 2010, Die South Sea Bubble in England (1720), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167177