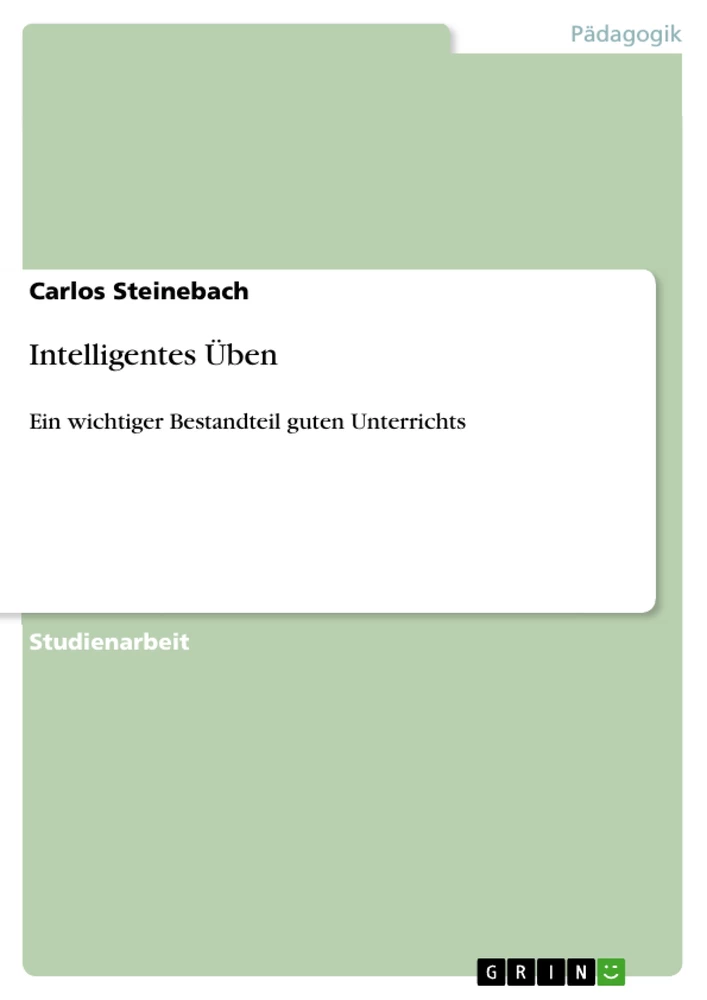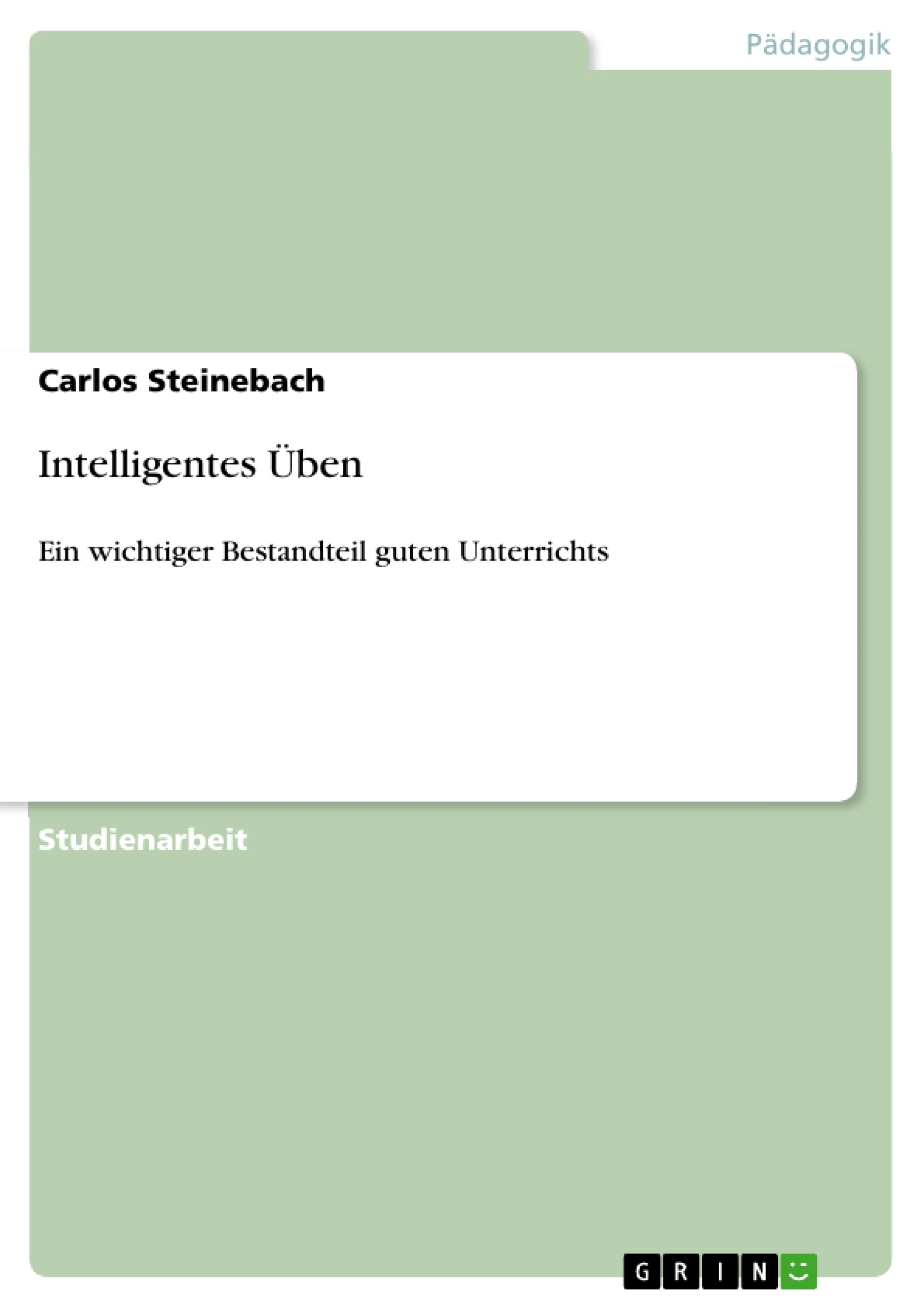Inhaltsverzeichnis
1. Was ist „Intelligentes Üben“?
3. Probleme bei der Durchführung
2. Wieso ist „Intelligentes Üben“ ein Bestandteil guten Unterrichts?
3. Training des Gedächtnisses
4. Lernstrategien nach Meyer und Leutwyler
Literaturverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
- Was ist „Intelligentes Üben“?
- Probleme bei der Durchführung
- Wieso ist „Intelligentes Üben“ ein Bestandteil guten Unterrichts?
- Training des Gedächtnisses
- Lernstrategien nach Meyer und Leutwyler
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Bedeutung und Umsetzung von „intelligentem Üben“ im Unterricht. Er analysiert die Vorteile dieser Lernform und beleuchtet die Herausforderungen bei der Implementierung im Kontext des traditionellen Schulalltags.
- Definition und Ziele des „Intelligenten Übens“
- Strukturelle und methodische Herausforderungen
- Die Rolle des „Intelligenten Übens“ in der Förderung von Lernerfolg und Lernmotivation
- Die Verbindung von „intelligentem Üben“ mit Gedächtnisentwicklung und Lernstrategien
- Empirische Befunde und Trends im Zusammenhang mit Übungsphasen im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
- Was ist „Intelligentes Üben“?: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Intelligentes Üben“ nach Hilbert Meyer und erläutert dessen drei grundlegende Zwecke. Es werden die Voraussetzungen für erfolgreiche Übungsphasen im Unterricht dargestellt, sowie die Rolle der Lehrkraft und die Bedeutung von Feedback und Selbstkontrolle hervorgehoben.
- Probleme bei der Durchführung: Dieses Kapitel beleuchtet die strukturellen Herausforderungen bei der Implementierung von „intelligentem Üben“ im klassischen Unterricht. Es werden die Auswirkungen des Fachunterrichtsprinzips und der 45-Minuten-Taktung auf die Durchführung von Übungsphasen diskutiert.
- Wieso ist „Intelligentes Üben“ ein Bestandteil guten Unterrichts?: Dieses Kapitel erläutert die Vorteile von „intelligentem Üben“ für Schülerinnen und Schüler. Es wird die Bedeutung des Übens für die Festigung von Fachwissen, die Entwicklung von Könnenserfahrungen und die Förderung von Lernmotivation und Selbstreflexion hervorgehoben.
- Training des Gedächtnisses: Dieses Kapitel untersucht die Frage, wie man durch „intelligentes Üben“ das Gedächtnis trainieren kann. Es werden verschiedene Arten von Gedächtnistraining dargestellt und die Bedeutung von Automatisierungsprozessen im Lernprozess hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Intelligentes Üben, guter Unterricht, Übungsphasen, Lernerfolg, Lernmotivation, Gedächtnisentwicklung, Lernstrategien, Selbstreflexion, empirische Forschung, PISA-Studien
Excerpt out of 9 pages
- scroll top
- Quote paper
- Carlos Steinebach (Author), 2009, Intelligentes Üben, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167198
Look inside the ebook