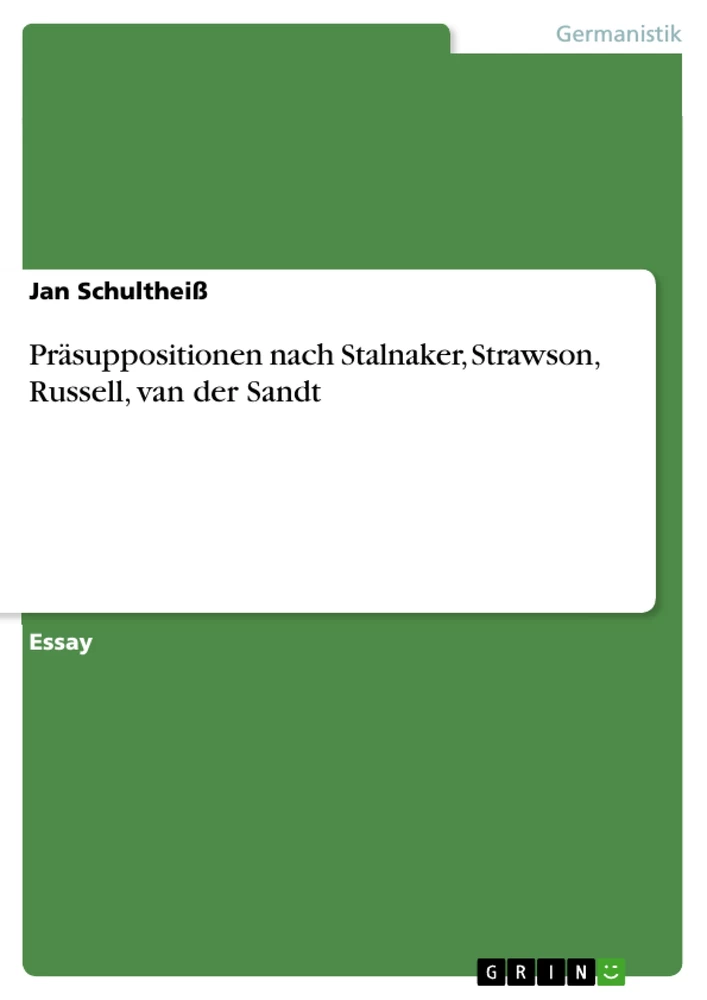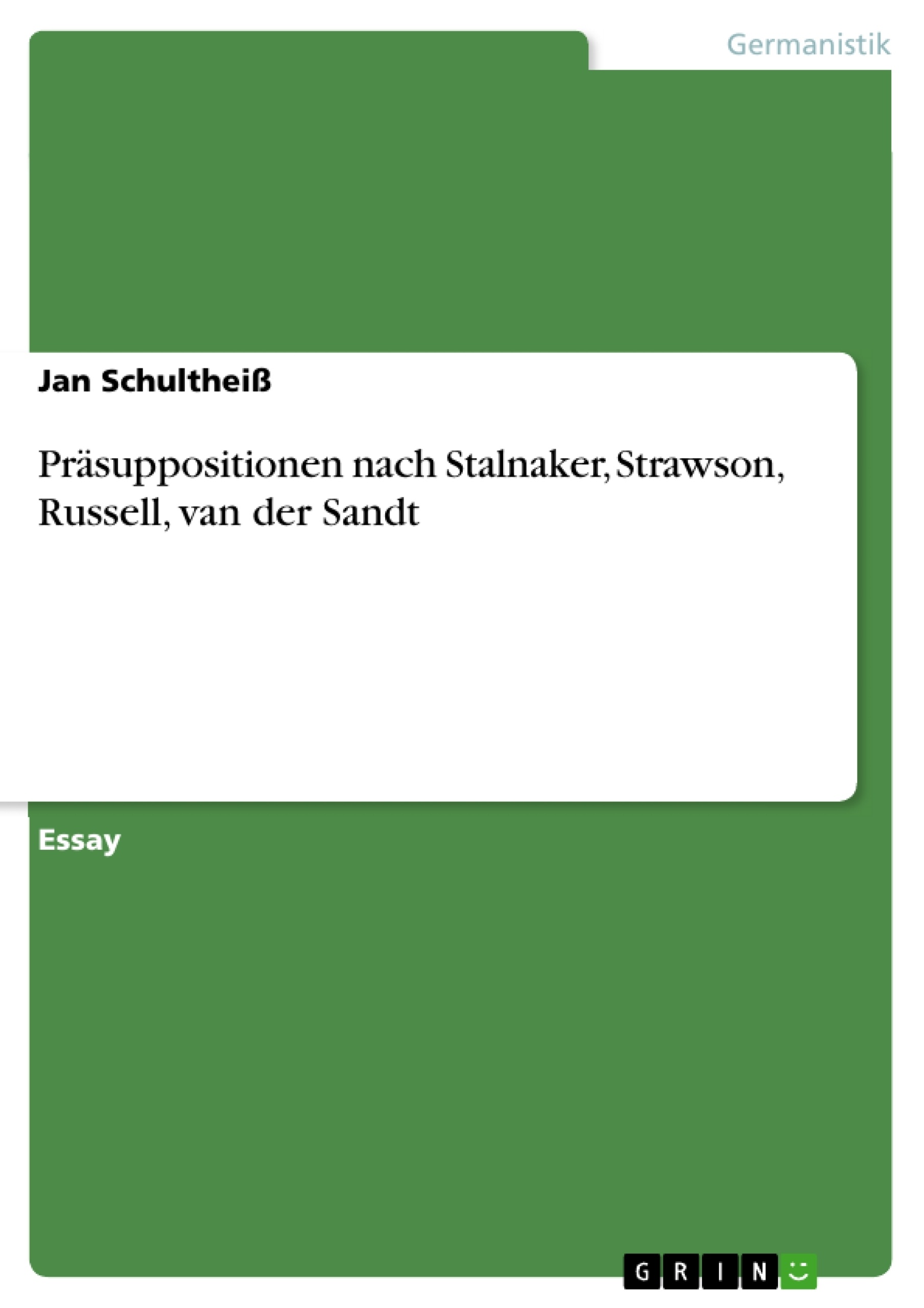Präsuppositionen sind die notwendigen Voraussetzungen der Äußerung eines Sprechers. Sie werden vom Sprecher als garantiert vorausgesetzt und müssen erfüllt sein, damit ein Satz überhaupt sinnvoll gebraucht werden kann. Präsuppositionen sind konstant unter Negation, nicht (ohne weiteres) aufhebbar (Ausnahme bei modalen Subordinationen), nicht kontextabhängig und bekräftigbar. Des Weiteren werden Präsuppositionen von bestimmtem Ausdrücken, den so genannten Präsuppositionstriggern, ausgelöst. Dies sind zum Beispiel faktive Verben (wissen, bereuen, bemerken, erkennen, …), implikative Verben, Fokuspartikeln, Spaltsätze, definite Beschreibungen (der, …).
Die theoretische Zuordnung der Präsuppositionen ist in der Linguistik umstritten. Es wird die pragmatische und semantische Präsuppositionstheorie unterschieden. Semantische Präsuppositionstheorien basieren auf der Eigenschaft der Präsupposition, konstant unter Negation zu sein.
Inhaltsverzeichnis
- Präsuppositionen
- Semantische Präsuppositionstheorien
- Pragmatische Präsuppositionstheorien
- Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Präsuppositionen
- Gottlob Frege
- Bertrand Russell
- P. F. Strawson
- Robert Stalnaker
- Van der Sandt
- Beispiel einer pragmatischen Analyse von „Ja, noch bin ich nicht ausgetreten. Und das habe ich auch nicht vor“ (Interview-Antwort von SPD-Politiker Saalfrank)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay befasst sich mit dem Konzept der Präsuppositionen in der Linguistik. Das Ziel ist es, die verschiedenen Theorien und Ansätze zu Präsuppositionen zu beleuchten und ihre Entwicklung aufzuzeigen.
- Die Definition und Eigenschaften von Präsuppositionen
- Die Unterscheidung zwischen semantischen und pragmatischen Präsuppositionen
- Die Rolle von Präsuppositionen in der Kommunikation
- Die Bedeutung von Kontext und gemeinsames Wissen (Common Ground) für Präsuppositionen
- Die Analyse von Präsuppositionen in Beispielen
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Essay beginnt mit einer grundlegenden Definition von Präsuppositionen als notwendigen Voraussetzungen für die sinnvolle Verwendung eines Satzes. Es werden auch die Eigenschaften von Präsuppositionen wie Konstanz unter Negation, Nicht-Kontextabhängigkeit und Bekräftigung besprochen.
- Im nächsten Abschnitt werden zwei Haupttheorien der Präsuppositionen, die semantische und die pragmatische Theorie, vorgestellt und ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten erläutert.
- Der dritte Abschnitt befasst sich mit der historischen Entwicklung des Konzepts der Präsuppositionen, wobei die Ansätze von Frege, Russell, Strawson und Stalnaker erläutert werden.
- Der vierte Abschnitt führt den Leser in das Präsuppositionsmodell von Van der Sandt ein, das Präsuppositionen als Anaphern betrachtet und die Konzepte von Akkomodation und Bindung einführt.
- Im fünften Abschnitt wird die pragmatische Analyse eines konkreten Beispiels, der Interview-Antwort des SPD-Politikers Saalfrank, durchgeführt, um die Anwendung von Präsuppositionsanalyse in realen Situationen zu demonstrieren.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieses Essays sind Präsuppositionen, semantische Präsuppositionen, pragmatische Präsuppositionen, Gottlob Frege, Bertrand Russell, P. F. Strawson, Robert Stalnaker, Van der Sandt, Common Ground, Akkomodation, Bindung, Negationstest, Implikatur, Kooperationsprinzip.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Präsupposition in der Linguistik?
Präsuppositionen sind notwendige Voraussetzungen einer Äußerung, die vom Sprecher als gegeben vorausgesetzt werden, damit ein Satz sinnvoll verwendet werden kann.
Was sind typische Präsuppositionstrigger?
Dazu gehören faktive Verben (z.B. wissen, bereuen), definite Beschreibungen (z.B. "der König von Frankreich"), Fokuspartikeln und Spaltsätze.
Wie verhalten sich Präsuppositionen bei einer Negation?
Präsuppositionen bleiben unter Negation konstant. Wenn man sagt "Ich bereue es nicht", bleibt die Voraussetzung, dass etwas geschehen ist, dennoch bestehen.
Was ist der Unterschied zwischen semantischen und pragmatischen Theorien?
Semantische Theorien basieren auf Wahrheitswerten und Negationskonstanz, während pragmatische Theorien den Kontext und das gemeinsame Wissen (Common Ground) betonen.
Welche Rolle spielt Van der Sandt in der Präsuppositionsforschung?
Er betrachtet Präsuppositionen als Anaphern und führt wichtige Konzepte wie Akkomodation (Einfügen neuer Infos in den Kontext) und Bindung ein.
Was versteht man unter dem "Common Ground"?
Es bezeichnet das gemeinsame Hintergrundwissen zwischen Sprecher und Hörer, das für das Verständnis von Präsuppositionen essenziell ist.
- Quote paper
- Stud. phil. Jan Schultheiß (Author), 2009, Präsuppositionen nach Stalnaker, Strawson, Russell, van der Sandt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167205