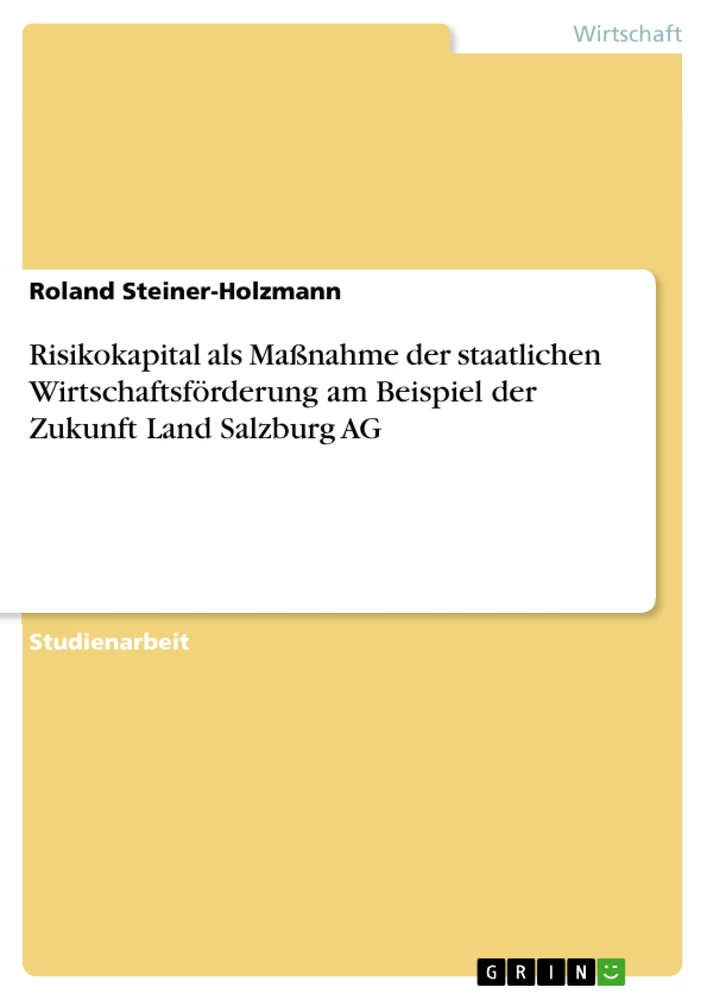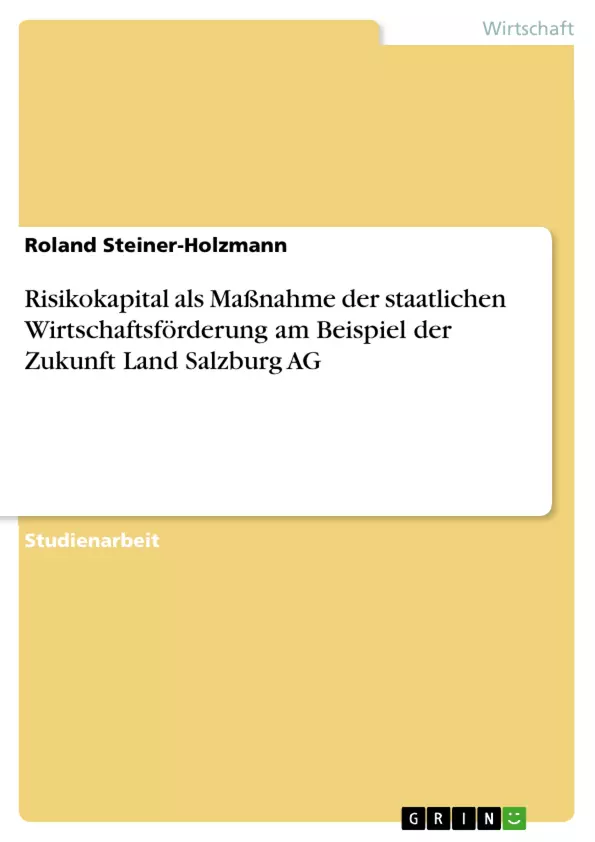In der Makroökonomie werden zur Stabilisierung der Wirtschaft ein stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum, ein hoher Beschäftigungsgrad, ein stabiles Preisniveau sowie ein
außenwirtschaftliches Gleichgewicht angestrebt. Doch wie gilt es diese Ziele zu erreichen? Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Politiker bei Markteingriffen nicht primär daran interessiert waren, einen gesamtwirtschaftlichen Nutzen zu generieren. Im Gegenteil, sie versuchten durch Korruption und vor allem Lobbying den eigenen Stellenwert zu erhöhen.
Im vorliegenden Fall des Landes Salzburg wurde eine Beteiligungsgesellschaft, namens Zukunft Land Salzburg AG, auf Initiative der Salzburger Volkspartei in der Legislaturperiode
1999 – 2004 als Maßnahme der Wirtschaftsförderung gegründet. Die Ziele bestanden hauptsächlich darin, neue Arbeitsplätze zu schaffen und den innovativen sowie technologieorientierten Unternehmen die Ansiedelung in Salzburg schmackhaft zu machen. Das Land Salzburg
zog sich hingegen bereits nach drei Jahren als Hauptaktionär zurück.
Ziel der Seminararbeit ist, die wirtschaftlichen und politischen Umstände zu ermitteln, die zum Scheitern der Zukunft Land Salzburg AG geführt haben. Hierzu erfolgt im Kapitel 2 ein Rückblick auf die Gründung, die ersten Beteiligungserwerbe und die Probleme der Gesellschaft. Kapitel 3 behandelt die involvierten wirtschaftlichen und politischen Akteure und deren Interessen. Im vorletzten Kapitel werden die Ereignisse und Zusammenhänge analysiert und basierend auf den vorliegenden Informationen Schlüsse gezogen. Abschließend gibt Kapital 6 eine Schlussbetrachtung und einen Ausblick der behandelten Problematik wieder.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- RÜCKBLICK DER ZUKUNFT LAND SALZBURG AG (ZLS)
- WIE ALLES BEGANN
- DIE ERSTEN GEHVERSUCHE
- WIDERSPRÜCHE TUN SICH AUF
- DER RÜCKZUG
- DIE ROLLE DER DMT TECHNOLOGY GMBH
- AKTEURE UND DEREN INTERESSEN
- WIRTSCHAFT
- Zukunft Land Salzburg AG
- DMT Technology GmbH
- POLITIK
- Ex-LHStv. Wolfgang Eisl (ehem. Wirtschafts- und Finanzreferent)
- LAbg. Cyriak Schwaighofer (Die Grünen-Fraktionsvorsitzender)
- Andere
- WENN POLITIK UND WIRTSCHAFT AUFEINANDERTREFFEN
- ANALYSE UND VERKETTUNG DER EREIGNISSE
- SCHLUSSFOLGERUNG & AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Scheitern der Zukunft Land Salzburg AG, einer Beteiligungsgesellschaft, die auf Initiative der Salzburger Volkspartei als Maßnahme der Wirtschaftsförderung gegründet wurde. Sie analysiert die wirtschaftlichen und politischen Umstände, die zum Scheitern der Gesellschaft geführt haben.
- Politische und wirtschaftliche Motivationen zur Gründung der Zukunft Land Salzburg AG
- Die Rolle der involvierten Akteure und deren Interessen
- Analyse der Ereignisse und Zusammenhänge, die zum Scheitern der Gesellschaft geführt haben
- Schlussfolgerungen und Ausblick auf die behandelte Problematik
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 bietet einen Rückblick auf die Gründung, die ersten Beteiligungen und die Probleme der Zukunft Land Salzburg AG. Es zeigt die anfänglichen Pläne und Ziele der Gesellschaft sowie die Herausforderungen und Widerstände, denen sie begegnete. Kapitel 3 beleuchtet die involvierten wirtschaftlichen und politischen Akteure und deren Interessen. Es wird die Motivation und das Engagement der verschiedenen Parteien dargestellt, die an der Gründung und dem Betrieb der ZLS beteiligt waren. Schließlich analysiert Kapitel 4 die Ereignisse und Zusammenhänge, die zum Scheitern der Zukunft Land Salzburg AG geführt haben.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit den Themen Wirtschaftsförderung, Risikokapital, Beteiligungsgesellschaft, politische Interventionen, Interessenkonflikte, Scheitern von Wirtschaftsprojekten und dem Zusammenspiel von Politik und Wirtschaft am Beispiel der Zukunft Land Salzburg AG.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Aufgabe der Zukunft Land Salzburg AG?
Die Gesellschaft wurde als Maßnahme der Wirtschaftsförderung gegründet, um neue Arbeitsplätze zu schaffen und innovative, technologieorientierte Unternehmen zur Ansiedlung in Salzburg zu bewegen.
Warum scheiterte die Zukunft Land Salzburg AG?
Die Arbeit analysiert wirtschaftliche und politische Umstände, darunter politische Interventionen, mangelnde wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Beteiligungen und Interessenkonflikte zwischen den Akteuren.
Welche Rolle spielten politische Akteure bei dem Projekt?
Die Initiative ging von der Salzburger Volkspartei aus. Kritiker wie die Grünen hinterfragten die Verflechtungen zwischen Politik und Wirtschaft, insbesondere im Fall der DMT Technology GmbH.
Wie lange war das Land Salzburg Hauptaktionär?
Das Land Salzburg zog sich bereits nach drei Jahren als Hauptaktionär aus der Beteiligungsgesellschaft zurück.
Was lehrt dieser Fall über staatliche Wirtschaftsförderung?
Die Seminararbeit zeigt die Risiken auf, wenn politische Motivationen über ökonomische Vernunft gestellt werden und wie Lobbying den gesamtwirtschaftlichen Nutzen gefährden kann.
- Citar trabajo
- Roland Steiner-Holzmann (Autor), 2011, Risikokapital als Maßnahme der staatlichen Wirtschaftsförderung am Beispiel der Zukunft Land Salzburg AG, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167226