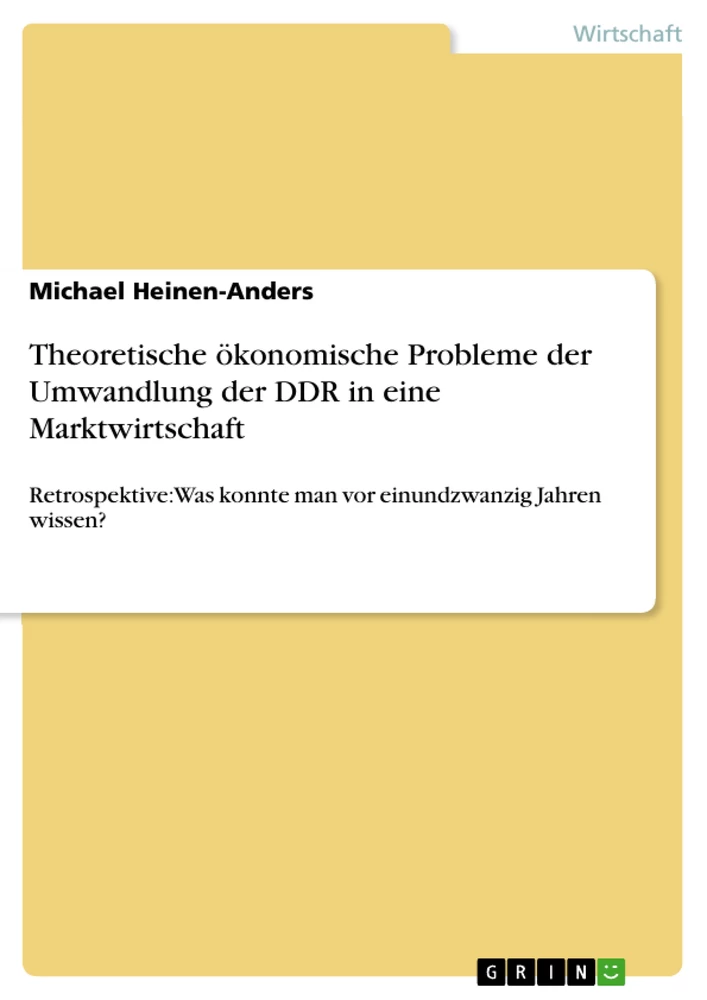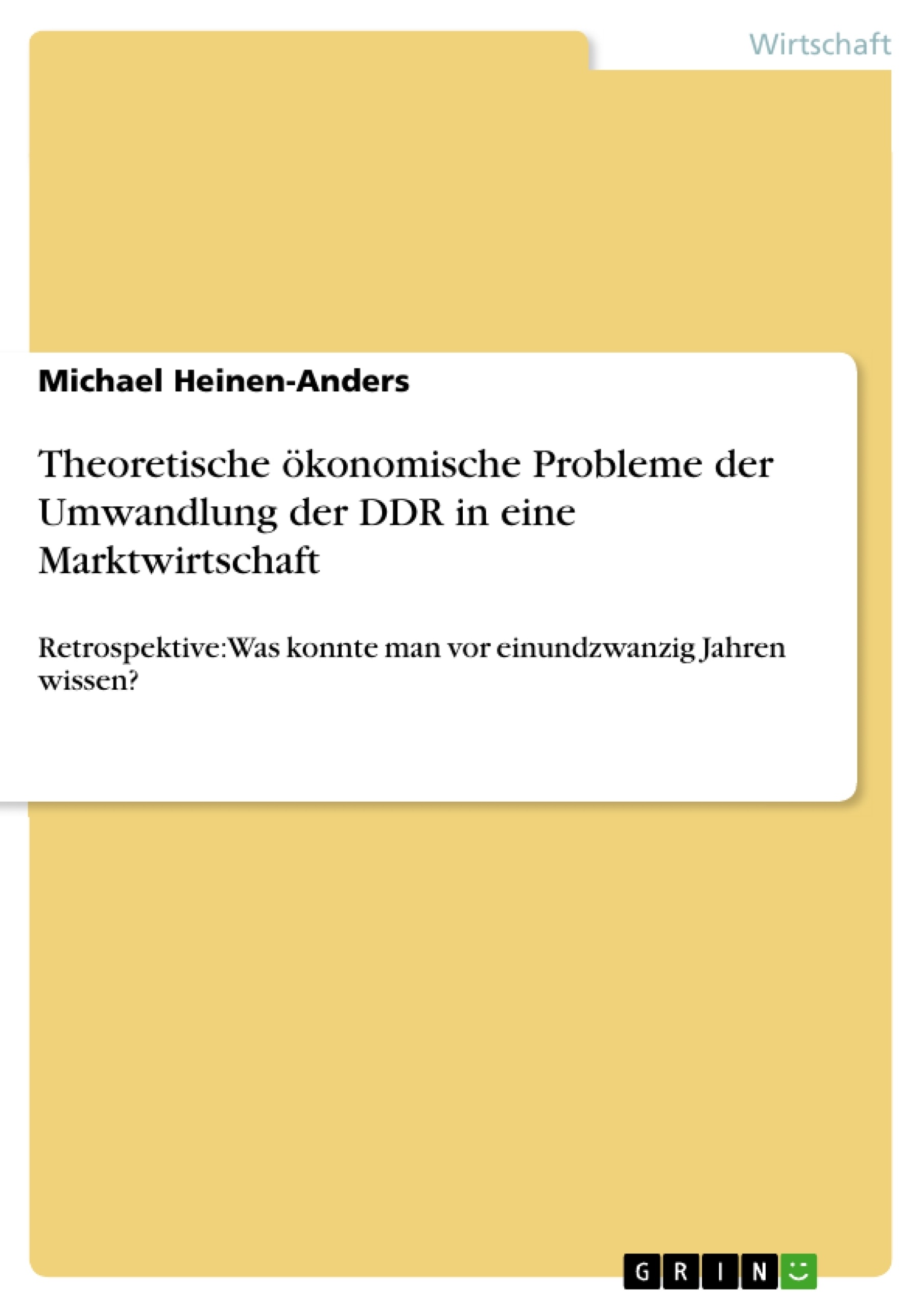Vor mehr als einundzwanzig Jahren brach das politische und schließlich auch das wirtschaftliche System der DDR zusammen. In der Folge warf die Wiedervereinigung und der Abschluss einer Wirtschafts- und Währungsunion die Frage nach den Theoretischen ökonomischen Problemen der Umwandlung der DDR in eine Marktwirtschaft auf.
In der Retrospektive wird deutlich, was man damals alles wissen und auch, was man nicht wissen konnte.
Diese wissenschaftliche Arbeit ist daher zugleich eine Antwort auf die Frage, inwieweit das wirtschaftliche Handeln der damaligen Bundesregierung im Rahmen der Wiedervereinigung angemessen war.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Überlegenheit des marktwirtschaftlich-kapitalistischen Syxtems
- Theoretische Begründung der Überlegenheit
- Probleme und Funktionsdefizite beim Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft
- Private Planungsautonomie
- Dezentralisierung
- Autonome Geld-/Kreditmittelversorgung
- Stetiges Verhalten und Ausbildung stabiler rationaler Erwartungen
- Hinreichendes Qualifikationsniveau
- Folgen der Funktionsdefizite
- Folgerung und Handlungsempfehlung
- Ausblick aus heutiger Sicht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Referat untersucht die theoretischen ökonomischen Herausforderungen der Transformation der DDR in eine Marktwirtschaft. Es analysiert die Überlegenheit des marktwirtschaftlichen Systems gegenüber der Planwirtschaft und beleuchtet die spezifischen Probleme und Funktionsdefizite, die während des Übergangs auftreten. Das Referat befasst sich zudem mit den Folgen dieser Defizite und formuliert Handlungsempfehlungen für einen erfolgreichen Übergangsprozess.
- Die Überlegenheit des marktwirtschaftlich-kapitalistischen Systems
- Die Probleme und Funktionsdefizite beim Übergang zur Marktwirtschaft
- Die Folgen dieser Funktionsdefizite für die Wirtschaft
- Die Handlungsempfehlungen für einen erfolgreichen Übergang
- Der Ausblick auf die aktuelle Situation in den neuen Bundesländern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung des Referats beschreibt die Ineffizienz des zentralplanwirtschaftlichen Systems und die Überlegenheit des marktwirtschaftlichen Systems. Kapitel 2 beleuchtet die theoretische Begründung der Überlegenheit des marktwirtschaftlichen Systems, die auf der Koordination von Angebot und Nachfrage über den Marktmechanismus basiert. Kapitel 3 stellt die fünf zentralen Voraussetzungen für ein effizientes marktwirtschaftliches System dar, die zugleich die Probleme und Funktionsdefizite beim Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft darstellen. Die Kapitel 4.1 bis 4.5 gehen auf diese Problemfelder im Detail ein. Kapitel 5 erläutert die Folgen der Funktionsdefizite, die zu Ungleichgewichtssituationen auf Teilmärkten führen können. Das Referat schließt mit einer Handlungsempfehlung für einen zügigen Übergang und einem Ausblick auf die aktuelle Situation in den neuen Bundesländern.
Schlüsselwörter
Marktwirtschaft, Planwirtschaft, Transformation, DDR, Überlegenheit, Funktionsdefizite, Dezentralisierung, Planungsautonomie, Geld-/Kreditmittelversorgung, Qualifikationsniveau, Arbeitsmarkt, Ungleichgewichte, Handlungsempfehlung, neue Bundesländer.
Häufig gestellte Fragen
Warum war die Umwandlung der DDR-Wirtschaft so schwierig?
Der Übergang von einer zentralen Planwirtschaft zu einer dezentralen Marktwirtschaft erforderte radikale strukturelle Änderungen, für die es kaum historische Vorbilder gab.
Was sind die zentralen Funktionsdefizite beim Übergang zur Marktwirtschaft?
Dazu zählen mangelnde private Planungsautonomie, fehlende dezentrale Strukturen und Probleme bei der autonomen Kreditmittelversorgung.
War das Handeln der Bundesregierung bei der Wiedervereinigung angemessen?
Die Arbeit analysiert kritisch, inwieweit die wirtschaftspolitischen Entscheidungen den theoretischen Anforderungen einer Systemtransformation entsprachen.
Welche Rolle spielt das Qualifikationsniveau der Arbeitskräfte?
Ein hinreichendes Qualifikationsniveau ist entscheidend, um den Anforderungen des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs und moderner Produktionstechniken gerecht zu werden.
Was bedeutet „dezentrale Koordination“ in einer Marktwirtschaft?
Es bedeutet, dass wirtschaftliche Entscheidungen nicht von einer staatlichen Stelle, sondern von Millionen Individuen und Unternehmen über den Preismechanismus getroffen werden.
- Quote paper
- Diplom-Ökonom Michael Heinen-Anders (Author), 1990, Theoretische ökonomische Probleme der Umwandlung der DDR in eine Marktwirtschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167275