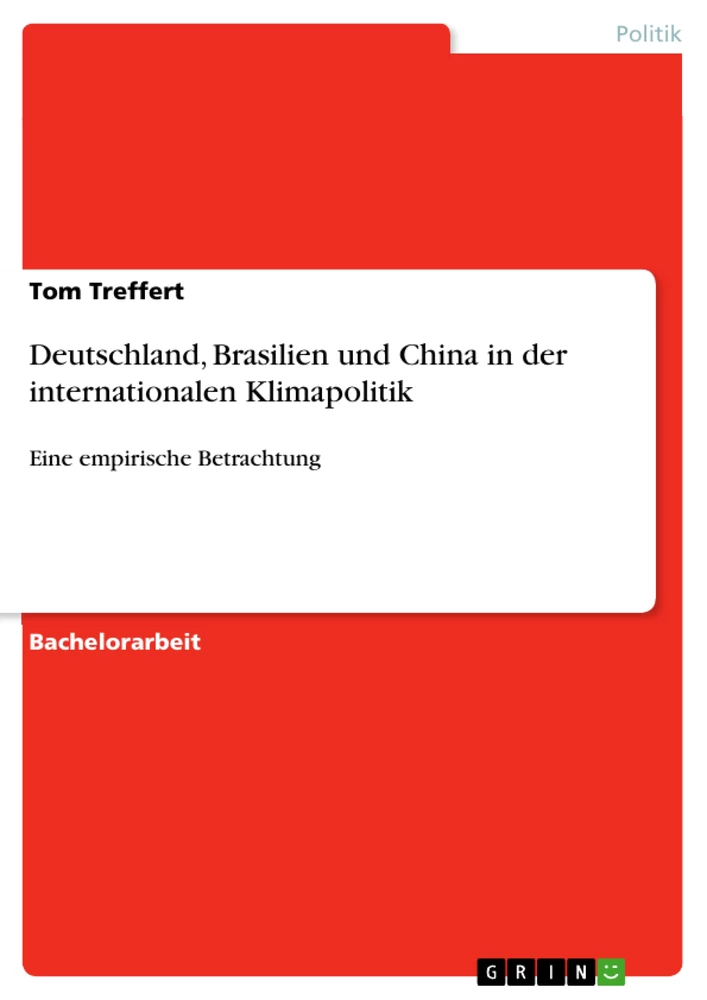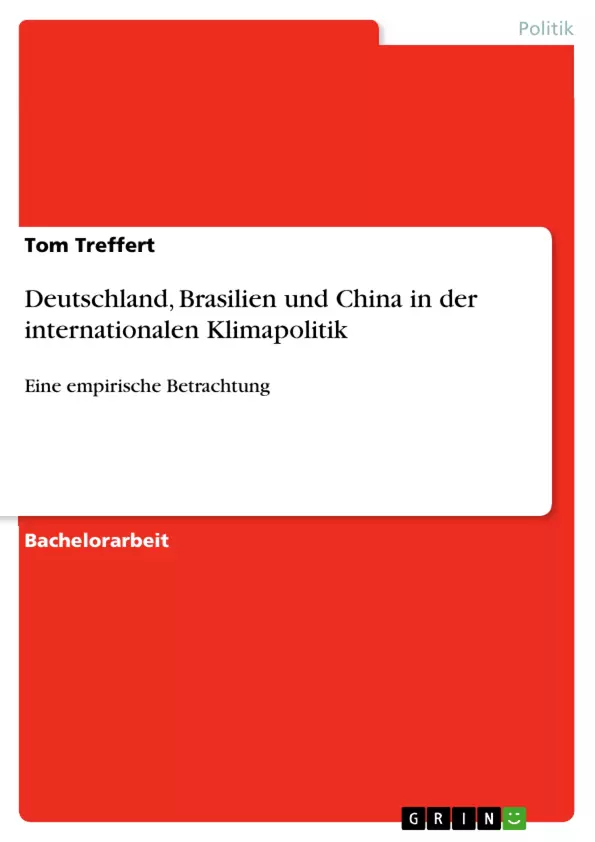Wie bereits erwähnt, stellt sich die Frage, wie eine Begrenzung des CO²-Gehaltes und somit der Erderwärmung gewährleistet werden kann. Dafür sind verschiedene Abkommen und Handlungen nötig. Da jedes Land andere Gegebenheiten aufweist, ob hinsichtlich der politischen und gesellschaftlichen Ordnung, hinsichtlich der wirtschaftlichen Stärke oder der Ausstattung mit Finanzmitteln, sind auch nicht alle Länder im gleichen Umfang in der Lage, dieser Herausforderung zu begegnen. Dementsprechend sind auch die Forderungen der Staaten unterschiedlich. Es ist ein Fakt, dass die ausgemachten Verursacher der Erderwärmung nicht die vorrangig Betroffenen sind. Hauptsächlich und am schwersten betroffen sind vor allem die Regionen, denen es nicht möglich ist, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, weil es zu kostenaufwendig ist oder die Nationen auch in der jetzigen Situation mit ungünstigen klimatischen Bedingungen leben müssen wie Wassermangel, hohen Temperaturen und verstärkten Umweltkatastrophen. Dabei stellt sich immer wieder die Frage: Warum gehen einige Nationen immer voran und versuchen, eine klimafreundlichere Politik zu betreiben und Kooperationen einzugehen, während andere Nationen sich immer wieder gegen jegliche Art der Kooperation im Bereich der Klimapolitik sperren?
Bereits seit einiger Zeit hat man dafür theoretische Modelle entwickelt, um das Verhalten der Akteure in den internationalen Beziehungen zu erklären und es auch voraussagen zu können. Dabei unterscheiden sich die theoretischen Modelle in Abhängigkeit vom betreffenden Sektor. So gibt es spezielle theoretische Ansätze für den Bereich der Sicherheit und wiederum andere Theorien für den Bereich der Umwelt- und Klimapolitik.
Ziel dieser Arbeit soll es sein, die Entwicklung von drei Staaten zu betrachten, die eine wesentliche Rolle in den Verhandlungen internationaler Klimaabkommen spielen. Anhand dieser drei Akteure soll überprüft werden, ob sich durch deren Verhalten die Theorien der internationalen Beziehungen bestätigen lassen oder widerlegt werden. Bei den betreffenden Staaten handelt es sich um Deutschland, China und Brasilien.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Fragestellung und Eingrenzung des Forschungsgegenstandes
- 2. Forschungsstand
- 3. Methodik
- 4. Theoretischer Hintergrund
- 4.1 Neoinstitutionalismus
- 4.2 Sozialkonstruktivismus
- II. Empirische Betrachtung
- 1. Veränderung des Weltklimas und dessen Folgen
- 2. Entwicklung der Klimapolitik seit 1992
- 3. Das Agieren der klimapolitischen Akteure
- 3.1 Deutschland
- 3.1.1 Entwicklung Deutschlands seit 1992
- 3.1.2 Entwicklung der Klimapolitischen Position
- 3.1.3 Überprüfung der theoretischen Ansätze am Beispiel Deutschland
- 3.2 Brasilien
- 3.2.1 Entwicklung Brasiliens seit 1992
- 3.2.2 Entwicklung der Klimapolitischen Position
- 3.2.3 Überprüfung der theoretischen Ansätze am Beispiel Brasilien
- 3.3 China
- 3.3.1 Entwicklung Chinas seit 1992
- 3.3.2 Entwicklung der Klimapolitischen Position
- 3.3.3 Überprüfung der theoretischen Ansätze am Beispiel China
- 3.1 Deutschland
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Rolle von Deutschland, Brasilien und China in der internationalen Klimapolitik. Sie untersucht, wie diese drei Staaten auf den Klimawandel reagieren und welche Faktoren ihre Klimapolitik beeinflussen. Ziel ist es, die theoretischen Ansätze des Neoinstitutionalismus und des Sozialkonstruktivismus anhand der empirischen Daten zu überprüfen.
- Entwicklung der internationalen Klimapolitik seit 1992
- Analyse des Verhaltens von Deutschland, Brasilien und China in der Klimapolitik
- Überprüfung der Gültigkeit von theoretischen Ansätzen in der Klimapolitik
- Identifizierung von Herausforderungen und Chancen in der internationalen Klimapolitik
- Bewertung des Einflusses von nationalen Interessen und globalen Herausforderungen auf die Klimapolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert den theoretischen Hintergrund. Sie skizziert die Bedeutung der internationalen Klimapolitik und die Rolle der drei untersuchten Staaten. Kapitel II analysiert die Entwicklung des Weltklimas und der Klimapolitik seit 1992. Es beleuchtet die wichtigsten internationalen Abkommen und die Herausforderungen der Klimapolitik. Kapitel III untersucht das Agieren der drei Staaten in der internationalen Klimapolitik. Es analysiert die jeweiligen nationalen Entwicklungen, die Klimapolitik und die Anwendung der theoretischen Ansätze.
Schlüsselwörter
Internationale Klimapolitik, Klimawandel, Treibhausgase, CO²-Emissionen, Neoinstitutionalismus, Sozialkonstruktivismus, Deutschland, Brasilien, China, Internationale Beziehungen, Umweltpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielen Deutschland, China und Brasilien in der Klimapolitik?
Diese drei Staaten sind zentrale Akteure in internationalen Verhandlungen, wobei sie aufgrund ihrer unterschiedlichen wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten oft konträre Forderungen stellen.
Was besagt der Neoinstitutionalismus in diesem Kontext?
Dieser theoretische Ansatz erklärt das Verhalten von Staaten durch das Streben nach Kooperation innerhalb internationaler Institutionen, um gemeinsame Vorteile zu erzielen.
Wie erklärt der Sozialkonstruktivismus die Klimapolitik?
Er fokussiert auf die Bedeutung von Identitäten, Werten und Normen, die das Handeln der Staaten über rein materielle Interessen hinaus beeinflussen.
Warum sperren sich einige Nationen gegen Klimakooperationen?
Oft liegt es an hohen Kosten für Klimaschutzmaßnahmen, nationalen wirtschaftlichen Interessen oder der Tatsache, dass sie selbst weniger stark von den Folgen betroffen sind.
Welche Staaten sind am stärksten vom Klimawandel betroffen?
Vor allem Regionen mit ungünstigen klimatischen Bedingungen (Wassermangel, Hitze) und geringen finanziellen Mitteln für Schutzmaßnahmen sind am schwersten betroffen.
- Arbeit zitieren
- Tom Treffert (Autor:in), 2010, Deutschland, Brasilien und China in der internationalen Klimapolitik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167284