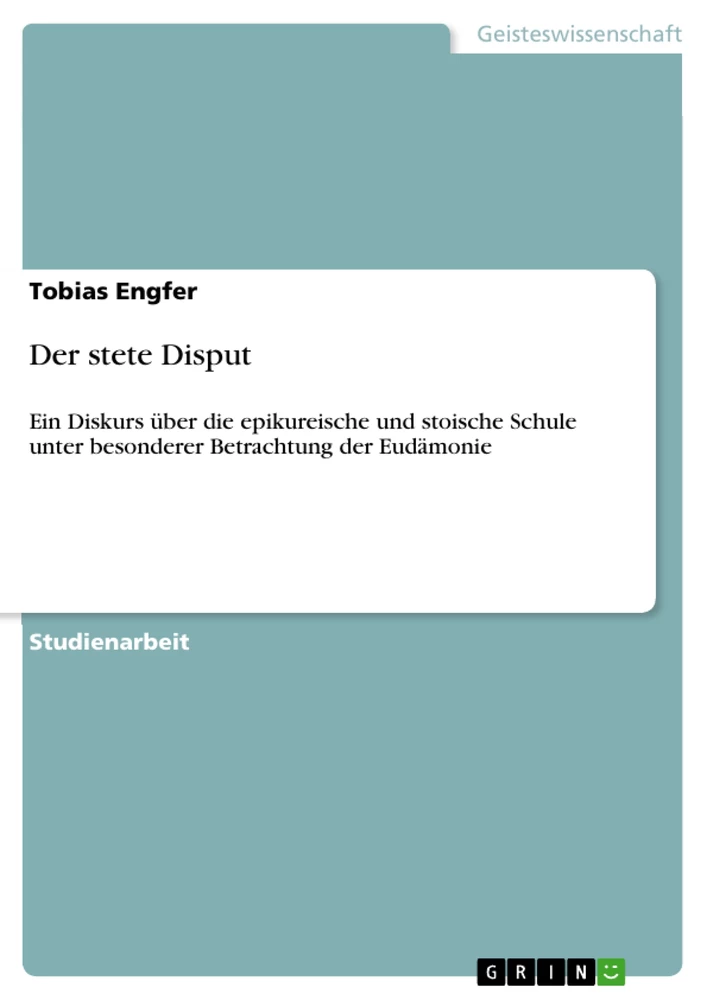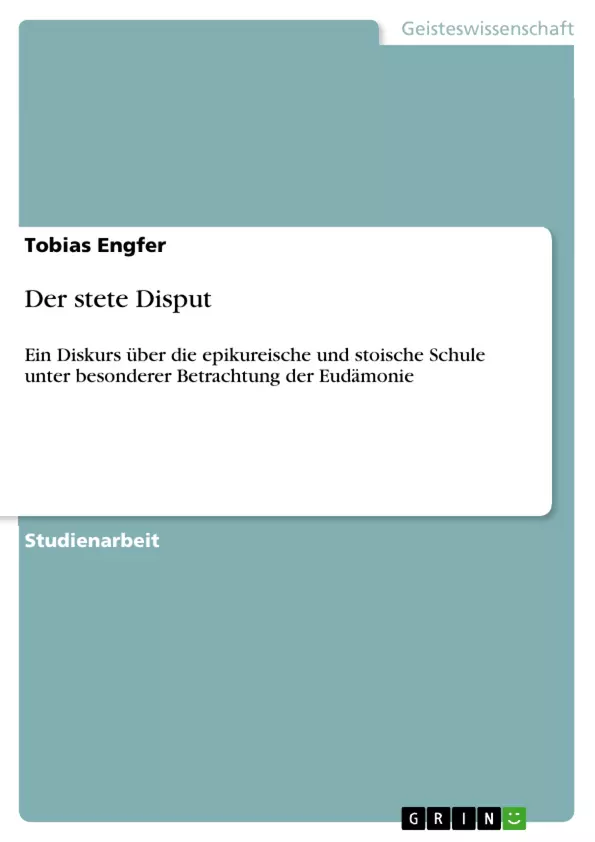Inhalt
1. Einleitung 2
2. Der Begriff des Hellenismus 3
3. Glück vs. Eudämonie 4
4. Stoa 5
4.1 Geschichte 5
4.2 Vertreter 7
4.2.1 Cicero 7
4.2.2 Seneca 8
4.2.3 Marc Aurel 9
4.3 Die Lehre 11
4.3.1 Logik 11
4.3.2 Physik 12
4.3.3 Ethik 13
5. Epikureismus 14
5.1 Geschichte/Vertreter 14
5.2 Die Lehre 17
5.2.1 Kanonik 17
5.2.2 Physik 19
5.2.3 Ethik 21
6. Der Epikureismus im Wandel der Zeit 24
7. Schlussbetrachtungen 27
8. Anhang 29
1. Einleitung
Viele Dispute hätten zu einer Randbemerkung zusammengefasst werden können, wenn die Disputanten gewagt hätten, ihre Begriffe klar zu definieren.
Aristoteles
So stellt sich nun schon zu Beginn die Frage, ob denn diese Auseinandersetzung zwischen den beiden hellenistischen Schulen, namentlich die der Epikureer und die der Stoiker, hätte vermieden werden können, wäre man mehr mit der klaren Differenzierung und Auskleidung von Begriffen verbunden oder ist es gar ein Sein, ein Disput der trotz mannigfaltiger bestehender Definitionen nicht so gänzlich einfach zu lösen ist, beziehungsweise gar unlöslich ist? Beide Lehren stützen sich auf die Natur des Menschen und verfolgen nur ein Ziel, nämlich das der Glückseligkeit – Eudämonie! Jedoch ist der Weg dahin für jede einzelne dieser Schulen, ein anderer. Während die Epikureer als ihr höchstes Gut, die Lust sehen, ist es für die Stoiker die Tugend. Diese Arbeit wirft einen Blick auf die beiden verschiedenen philosophischen Denkrichtungen in der Zeit des Hellenismus und im speziellen welche Einstellung sie hatten, bezüglich des eben angesprochenen Glücksbegriffes. „Hat man auch nichts Ganzes erreicht, so kamen doch zusammenhängende Strecken zum Vorschein …“ (Pörnbacher, 1988, S.261., zit. nach Kimmich, 1993, S. XIII). Ebenso stellt diese Ausarbeitung auch nicht den Anspruch, eine allumfassende Übersicht zu sein.
Das anschließende Kapitel wird, mit Blick auf die zeitliche Spanne in der unsere Betrachtungen verwurzelt sind, eine kurze Bestimmung des Wortes Hellenismus vornehmen. Daraufhin sollen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Zustände Eudämonie und Glückseligkeit herausgestellt werden und dabei noch die Funktion einer begriffserläuternden Instanz haben. Daraufhin folgen in Abschnitt vier die Ausführungen über die Stoa. Die Entwicklung dieser Schule, verschiedene Vertreter und ihre Denkansätze werden dabei beleuchtet. Das Gleiche passiert danach auch, wenn der Abschnitt über den Epikureismus in den Fokus der Betrachtungen rückt. Bei dem Punkt Ethik,...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff des Hellenismus
- Glück vs. Eudämonie
- Stoa
- Geschichte
- Vertreter
- Cicero
- Seneca
- Marc Aurel
- Die Lehre
- Logik
- Physik
- Ethik
- Epikureismus
- Geschichte/Vertreter
- Die Lehre
- Kanonik
- Physik
- Ethik
- Der Epikureismus im Wandel der Zeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den unterschiedlichen philosophischen Denkrichtungen der Epikureer und Stoiker in der Zeit des Hellenismus, insbesondere im Hinblick auf ihre Ansichten zum Glück. Ziel ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Schulen im Hinblick auf den Glücksbegriff und den Weg zur Glückseligkeit (Eudämonie) herauszuarbeiten.
- Der Begriff des Hellenismus und seine Bedeutung für die philosophischen Schulen
- Die Unterscheidung zwischen Glück und Eudämonie
- Die stoische Philosophie: Geschichte, Vertreter und zentrale Lehren
- Die epikureische Philosophie: Geschichte, Vertreter und zentrale Lehren
- Der Wandel der antiken philosophischen Ideen im Laufe der Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und erläutert die Relevanz der Auseinandersetzung mit den beiden philosophischen Schulen. Das zweite Kapitel definiert den Begriff des Hellenismus und seine Bedeutung für die Entstehung der stoischen und epikureischen Philosophie. Kapitel drei beleuchtet die Unterschiede zwischen den Begriffen Glück und Eudämonie und stellt deren Bedeutung für die beiden Schulen heraus. Kapitel vier widmet sich der stoischen Philosophie und präsentiert ihre Geschichte, wichtige Vertreter sowie zentrale Elemente ihrer Lehre. Der fünfte Abschnitt behandelt den Epikureismus, seine Geschichte, zentrale Vertreter und die wichtigsten Elemente seiner Lehre. Das sechste Kapitel untersucht den Wandel des Epikureismus im Laufe der Geschichte und stellt die Bedeutung der antiken philosophischen Ideen im Kontext des historischen Wandels heraus.
Schlüsselwörter
Hellenismus, Stoa, Epikureismus, Glück, Eudämonie, Tugend, Lust, Ethik, Philosophie, Antike.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Stoa und Epikureismus?
Die Stoiker sehen die Tugend als höchstes Gut, während die Epikureer die Lust (Ataraxie/Schmerzlosigkeit) als Ziel der Glückseligkeit betrachten.
Was bedeutet "Eudämonie"?
Eudämonie bezeichnet den Zustand der Glückseligkeit oder des gelingenden Lebens, der das Endziel beider hellenistischen Philosophien ist.
Wer sind wichtige Vertreter der Stoa?
Zu den bedeutendsten Vertretern zählen Cicero (als Vermittler), Seneca und der römische Kaiser Marc Aurel.
Was lehrt der Epikureismus über die Physik?
Die epikureische Physik basiert auf dem Atomismus (Demokrit), um den Menschen die Furcht vor Göttern und dem Tod zu nehmen.
Wann war die Zeit des Hellenismus?
Der Hellenismus umfasst die Epoche von 323 v. Chr. (Tod Alexanders des Großen) bis 30 v. Chr. (Einverleibung Ägyptens in das Römische Reich).
- Citar trabajo
- Tobias Engfer (Autor), 2011, Der stete Disput, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167508