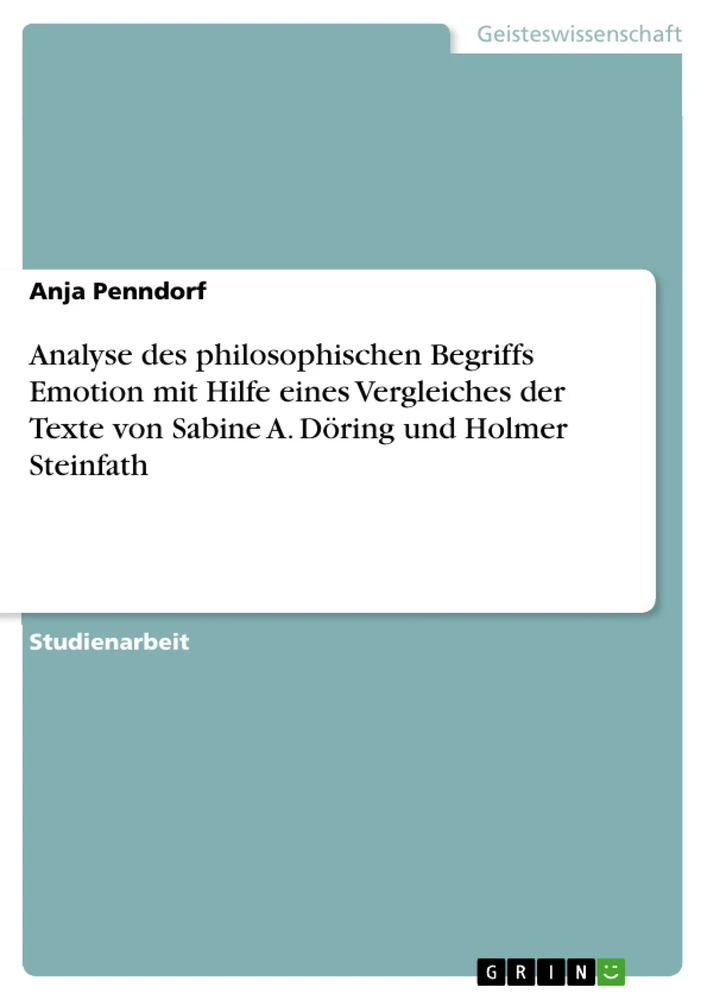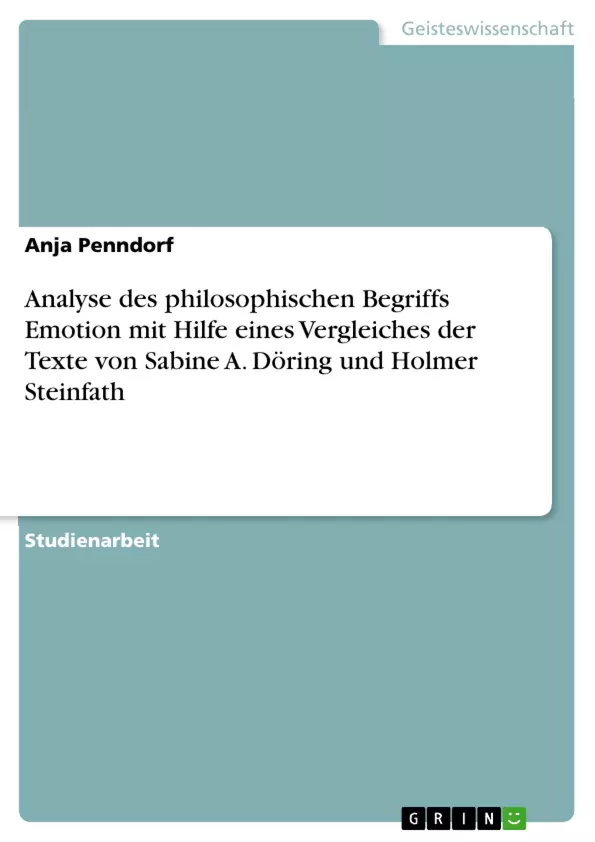Definieren lässt sich „[e]ine Emotion oder ein Gefühl [als] eine Erscheinungsform eines geistigen Phänomens“. So lautet der erste Satz Richard Wollheims in seinem Buch „Emotionen. Eine Philosophie der Gefühle“. Er merkt dabei an, dass von dem Begriff „Gefühl“ in seinem Text nicht weiter Gebrauch gemacht wird, sondern nur der Begriff „Emotion“ Verwendung findet. Er begründet dies damit, dass dadurch die Begriffe „Empfindung“ und „Sinneswahrnehmung“ deutlicher abgegrenzt werden. Zum anderen werden die beiden Begriffe „Emotion“ und „Gefühl“ aber auch in der deutschen Alltagssprache synonym verwendet, was ebenfalls in den Texten von Sabine A. Döring und Holmer Steinfath der Fall ist. Dies war mir zuerst unklar, denn meine Einstellung war es, bevor ich die Texte gelesen hatte, dass sich prinzipiell Unterscheidungsmerkmale zwischen Gefühl und Emotion finden lassen. Ich werde mich aber natürlich dem Verständnis der gleichen Bedeutung anschließen und in meiner Hausarbeit nur noch den Emotionsbegriff verwenden.
Die Philosophie setzt sich immer wieder intensiv mit dem Thema der Emotionen auseinander. Viele Philosophen haben Werke zu diesem Thema veröffentlicht und demzufolge enthält die Literatur auch die unterschiedlichsten Definitionen dieses Begriffs.
Ich möchte mich in meiner Hausarbeit zwei Begriffsverständnissen von Emotionen nähern und diese vergleichen. Einerseits dient mir der Text von Sabine A. Döring „Können Gefühle Gründe sein?“ als Grundlage, andererseits werde ich mich mit dem Text von Holmer Steinfath „Emotionen, Werte und Moral“ auseinandersetzen.
Zu Beginn möchte ich erst einmal kurz ein paar Sätze über die beiden Autoren Sabina A. Döring und Holmer Steinfath verlieren. Anschließend, um auf das eigentliche Thema einzugehen, soll geklärt werden, was Emotionen sind, was diese für die beiden Autoren darstellen. Folgend werden die jeweiligen Eigenschaftszuschreibungen analysiert und miteinander verglichen. Im fünften Abschnitt werden die Ansichten zur Angemessenheit von Emotionen thematisiert. Dabei findet wieder ein Vergleich von Dörings und Steinfaths Auffassungen statt. Und zum Schluss soll es noch um die Beziehung zwischen Werten und Emotionen gehen, die abermals unter beiden Gesichtspunkten betrachtet wird. Anhand der verschiedenen Ansätze, die die Philosophie bietet, besteht die Möglichkeit, dass es sich um zwei völlig verschiedene Begriffsverständnisse von Emotionen handelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Über die Autoren Sabine A. Döring und Holmer Steinfath und deren Wertegänge
- Sabine A. Döring
- Holmer Steinfath
- Gefühle bzw. Emotionen und ihre charakteristischen Merkmale
- Dörings Definition von Emotionen
- Steinfath im Vergleich zu Döring
- Die Bedeutung der Motivation von Emotionen für normative Handlungsgründe in der internalistischen Theorie nach Döring
- Die Bedeutung der affektiven und kognitiven Eigenschaftszuschreibung bei Steinfath und Döring
- Definitionen von Affektivität bzw. Affekt und Kognitivismus
- Dörings Verständnis von Affektivität in Bezug zum Kognitivismus
- Steinfaths Affektivitäts- und Kognitivitätsverständnis
- Zusammenfassender Vergleich Schlussfolgerung
- Angemessenheit von Emotionen im Vergleich von Steinfath und Döring
- Das Beziehungsverhältnis zwischen Werten und Emotionen
- Dörings Gedanke zum Beziehungsverständnis von Werten und Emotionen
- Die Werte nach Steinfath
- Die Beziehung zwischen Werten und Emotionen nach Steinfath
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit dem philosophischen Begriff der Emotion und analysiert diesen anhand eines Vergleichs der Texte von Sabine A. Döring und Holmer Steinfath. Ziel ist es, die unterschiedlichen Begriffsverständnisse der beiden Autoren herauszuarbeiten und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede in ihren Ansätzen zu beleuchten.
- Definition und Charakterisierung von Emotionen
- Bedeutung der Motivation von Emotionen für Handlungsgründe
- Affektivität und Kognitivität im Zusammenhang mit Emotionen
- Angemessenheit von Emotionen
- Beziehung zwischen Werten und Emotionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Emotionen ein und erläutert den Fokus der Arbeit. Die Kapitel 2 und 3 präsentieren die Autoren Sabine A. Döring und Holmer Steinfath sowie deren jeweilige Definition von Emotionen. Kapitel 4 analysiert die Rolle von Affektivität und Kognitivität in den Theorien beider Autoren. In Kapitel 5 werden die Ansichten zur Angemessenheit von Emotionen im Vergleich von Steinfath und Döring diskutiert. Kapitel 6 befasst sich mit dem Beziehungsverhältnis zwischen Werten und Emotionen.
Schlüsselwörter
Emotion, Gefühl, Philosophie, Sabine A. Döring, Holmer Steinfath, Motivation, Affektivität, Kognitivismus, Angemessenheit, Werte, Moral.
Häufig gestellte Fragen
Werden „Gefühl“ und „Emotion“ in der Philosophie unterschiedlich definiert?
Obwohl sie im Alltag oft synonym verwendet werden, grenzen Philosophen wie Richard Wollheim sie ab. In dieser Arbeit werden die Begriffe jedoch im Einklang mit Döring und Steinfath weitgehend synonym behandelt.
Was ist der Kern von Sabine A. Dörings Theorie zu Emotionen?
Döring untersucht unter anderem, ob Gefühle Gründe für Handlungen sein können und wie Motivation und normative Gründe in ihrer internalistischen Theorie zusammenhängen.
Wie stehen Emotionen laut Holmer Steinfath zu Werten?
Steinfath analysiert das Beziehungsverhältnis zwischen Emotionen, Werten und Moral und wie diese unsere Wahrnehmung prägen.
Was bedeuten Affektivität und Kognitivismus in diesem Zusammenhang?
Die Arbeit vergleicht, wie Döring und Steinfath die affektiven (gefühlsmäßigen) und kognitiven (gedanklichen) Bestandteile von Emotionen gewichten.
Wann gilt eine Emotion als „angemessen“?
Beide Autoren thematisieren die Angemessenheit von Emotionen, also die Frage, ob ein Gefühl in einer bestimmten Situation objektiv berechtigt oder rational nachvollziehbar ist.
- Quote paper
- Anja Penndorf (Author), 2010, Analyse des philosophischen Begriffs Emotion mit Hilfe eines Vergleiches der Texte von Sabine A. Döring und Holmer Steinfath, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167527