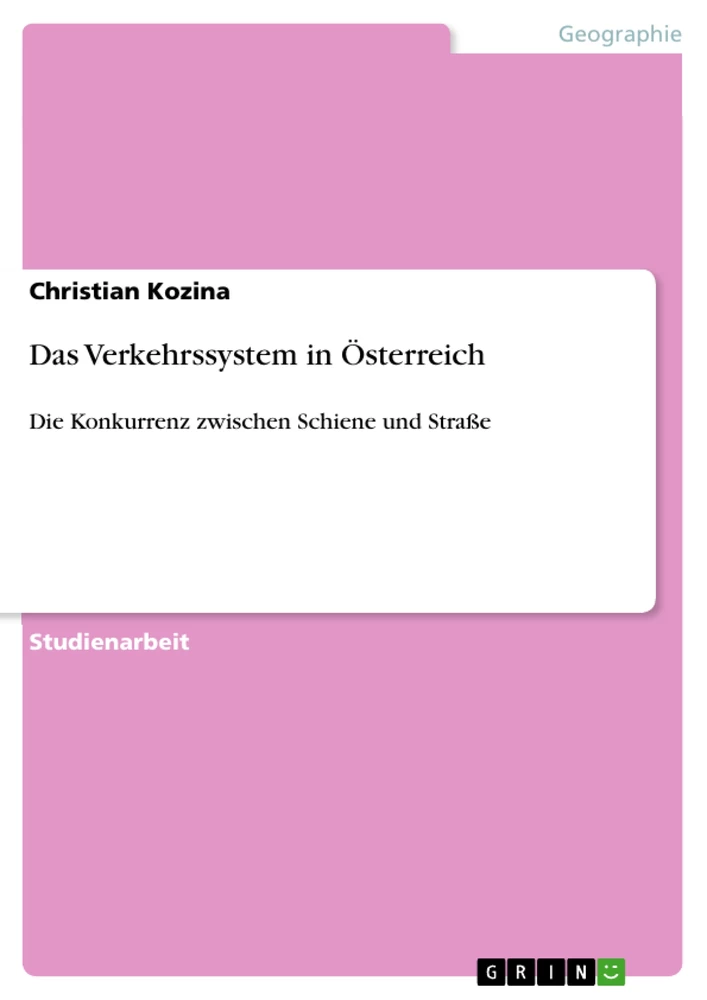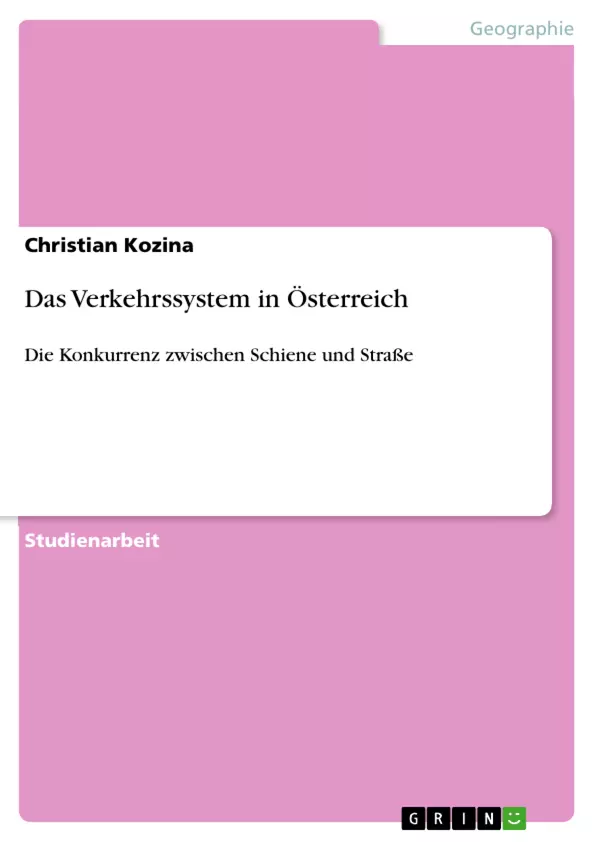Das Verkehrsaufkommen in Österreich steigt und steigt: Allein die CO2-Emissionen im Verkehrssektor stiegen von 1990 bis 2005 um über 90 % (vgl. Umweltbundesamt 2007). Vor allem der Straßenverkehr hat in den letzten Jahrzehnten enorme Zuwächse erlebt: Wurden 1970 noch 32,9 Mrd. km mit dem Auto zurückgelegt, ist dieser Wert bis 2003 um das Zweieinhalbfache auf 82,1 Mrd. km gestiegen. Die Eisenbahn konnte im selben Zeitraum zwar ebenfalls Zugewinne verbuchen, mit einem Zuwachs von 6,5 auf 8,5 Mrd. Personenkilometer fiel dieser aber eher bescheiden aus (vgl. BMVIT 2007). Aus dem Verhältnis 1:5 zwischen Straße und Schiene wurde im Personenverkehr 1:10.
In dieser Arbeit soll nun versucht werden zu klären, worin die Ursachen für diese Entwicklung liegen. Die zentrale These lautet: Durch verkehrspolitische Maßnahmen wurde die Konkurrenzfähigkeit des Schienenverkehrs gegenüber dem Straßenverkehr in den letzten Jahrzehnten in Österreich deutlich reduziert. Um diese zu verifizieren oder falsifizieren, wurden verschiedene Daten ausgewertet, beispielsweise vom Verkehrsministerium (BMVIT), von der ÖBB oder von Online-Routenplanern. Um die Hintergründe für die beobachteten Entwicklungen aufzuzeigen, wurde der Problemstellung entsprechende Literatur recherchiert. Die Recherche beschränkte sich dabei auf den Personenverkehr, da eine Einbeziehung des Güterverkehrs den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problemstellung und Arbeitsmethodik
- 2. Österreichs Verkehrssystem
- 3. Kriterien für die Verkehrsmittelwahl
- 4. Ursachen der Verkehrsmittelwahl in Österreich
- 5. Ursachen der Verkehrsentwicklung in Österreich
- 6. Schlussfolgerungen und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Ursachen der zunehmenden Dominanz des Straßenverkehrs gegenüber dem Schienenverkehr in Österreich. Die Arbeit analysiert verkehrspolitische Einflüsse und bewertet die Relevanz verschiedener Kriterien bei der Verkehrsmittelwahl.
- Entwicklung des Verkehrsaufkommens in Österreich
- Vergleich des Ausbaus von Schienen- und Straßennetz
- Kriterien der Verkehrsmittelwahl (Reisedauer, Komfort, Flexibilität, Kosten, Privatsphäre, Sicherheit)
- Einfluss verkehrspolitischer Maßnahmen
- Analyse der Konkurrenz zwischen Schiene und Straße
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problemstellung und Arbeitsmethodik: Dieses Kapitel legt die Grundlage der Arbeit dar, indem es das stark steigende Verkehrsaufkommen in Österreich, besonders im Straßenverkehr, beleuchtet und den Fokus auf die CO2-Emissionen und die wachsende Diskrepanz zwischen dem Straßen- und Schienenverkehr im Personenverkehr legt. Die zentrale These der Arbeit – die Reduktion der Konkurrenzfähigkeit des Schienenverkehrs durch verkehrspolitische Maßnahmen – wird vorgestellt. Die Methodik, basierend auf der Auswertung verschiedener Datenquellen und Literaturrecherche, wird erläutert, wobei der Fokus auf den Personenverkehr beschränkt bleibt.
2. Österreichs Verkehrssystem: Dieses Kapitel präsentiert eine Übersicht über das österreichische Verkehrsnetz, sowohl Schienen- als auch Straßennetz, mithilfe von Abbildungen und Statistiken. Der Vergleich mit anderen EU-Ländern wird angeführt, um die Situation Österreichs zu kontextualisieren. Es wird deutlich, dass obwohl beide Netze gut ausgebaut sind, ein deutliches Übergewicht des hochrangigen Straßennetzes, besonders im Südosten des Landes, besteht. Die Kapitel analysiert die Entwicklung der Netzlängen über die Jahre und zeigt die deutlich stärkere Expansion des Straßennetzes im Vergleich zum Schienennetz auf.
3. Kriterien für die Verkehrsmittelwahl: Dieses Kapitel beschreibt die Hauptfaktoren, die Personen bei der Wahl ihres Verkehrsmittels beeinflussen. Prioritäten werden in einer Liste dargestellt, beginnend mit der Reisedauer und gefolgt von Komfort, Flexibilität, Kosten, Privatsphäre, Sicherheit und Umweltverträglichkeit. Es wird herausgestellt, dass der Individualverkehr im Hinblick auf Flexibilität und Privatsphäre Vorteile bietet, während die Differenz zum öffentlichen Verkehr von der Netzqualität und der Verfügbarkeit abhängt.
Schlüsselwörter
Verkehrssystem Österreich, Schienenverkehr, Straßenverkehr, Verkehrsmittelwahl, Verkehrspolitik, CO2-Emissionen, Autobahn, Schnellstraße, Personenverkehr, Verkehrsentwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Seminararbeit: Ursachen der Dominanz des Straßenverkehrs in Österreich
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Ursachen der zunehmenden Dominanz des Straßenverkehrs gegenüber dem Schienenverkehr in Österreich. Sie analysiert verkehrspolitische Einflüsse und bewertet die Relevanz verschiedener Kriterien bei der Verkehrsmittelwahl.
Welche Aspekte werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Verkehrsaufkommens in Österreich, einen Vergleich des Ausbaus von Schienen- und Straßennetz, die Kriterien der Verkehrsmittelwahl (Reisedauer, Komfort, Flexibilität, Kosten, Privatsphäre, Sicherheit), den Einfluss verkehrspolitischer Maßnahmen und eine Analyse der Konkurrenz zwischen Schiene und Straße.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Problemstellung und Arbeitsmethodik, 2. Österreichs Verkehrssystem, 3. Kriterien für die Verkehrsmittelwahl, 4. Ursachen der Verkehrsmittelwahl in Österreich, 5. Ursachen der Verkehrsentwicklung in Österreich, 6. Schlussfolgerungen und Ausblick.
Was wird im Kapitel "Problemstellung und Arbeitsmethodik" behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet das stark steigende Verkehrsaufkommen in Österreich, insbesondere im Straßenverkehr, mit Fokus auf CO2-Emissionen und die wachsende Diskrepanz zwischen Straßen- und Schienenverkehr im Personenverkehr. Die zentrale These der Arbeit – die Reduktion der Konkurrenzfähigkeit des Schienenverkehrs durch verkehrspolitische Maßnahmen – wird vorgestellt. Die Methodik, basierend auf der Auswertung verschiedener Datenquellen und Literaturrecherche (fokussiert auf Personenverkehr), wird erläutert.
Was wird im Kapitel "Österreichs Verkehrssystem" behandelt?
Dieses Kapitel präsentiert eine Übersicht über das österreichische Verkehrsnetz (Schienen- und Straßennetz) mittels Abbildungen und Statistiken im Vergleich zu anderen EU-Ländern. Es zeigt das Übergewicht des hochrangigen Straßennetzes, besonders im Südosten, und analysiert die Entwicklung der Netzlängen über die Jahre, wobei die deutlich stärkere Expansion des Straßennetzes im Vergleich zum Schienennetz hervorgehoben wird.
Was wird im Kapitel "Kriterien für die Verkehrsmittelwahl" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die Hauptfaktoren, die Personen bei der Wahl ihres Verkehrsmittels beeinflussen (Reisedauer, Komfort, Flexibilität, Kosten, Privatsphäre, Sicherheit, Umweltverträglichkeit). Es wird der Vorteil des Individualverkehrs bezüglich Flexibilität und Privatsphäre hervorgehoben, während die Differenz zum öffentlichen Verkehr von Netzqualität und Verfügbarkeit abhängt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Verkehrssystem Österreich, Schienenverkehr, Straßenverkehr, Verkehrsmittelwahl, Verkehrspolitik, CO2-Emissionen, Autobahn, Schnellstraße, Personenverkehr, Verkehrsentwicklung.
Welche Methodik wurde in der Seminararbeit angewendet?
Die Methodik basiert auf der Auswertung verschiedener Datenquellen und Literaturrecherche, wobei der Fokus auf den Personenverkehr beschränkt bleibt.
Welche zentrale These wird in der Seminararbeit vertreten?
Die zentrale These ist, dass die Konkurrenzfähigkeit des Schienenverkehrs durch verkehrspolitische Maßnahmen reduziert wird.
- Arbeit zitieren
- Christian Kozina (Autor:in), 2009, Das Verkehrssystem in Österreich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167636