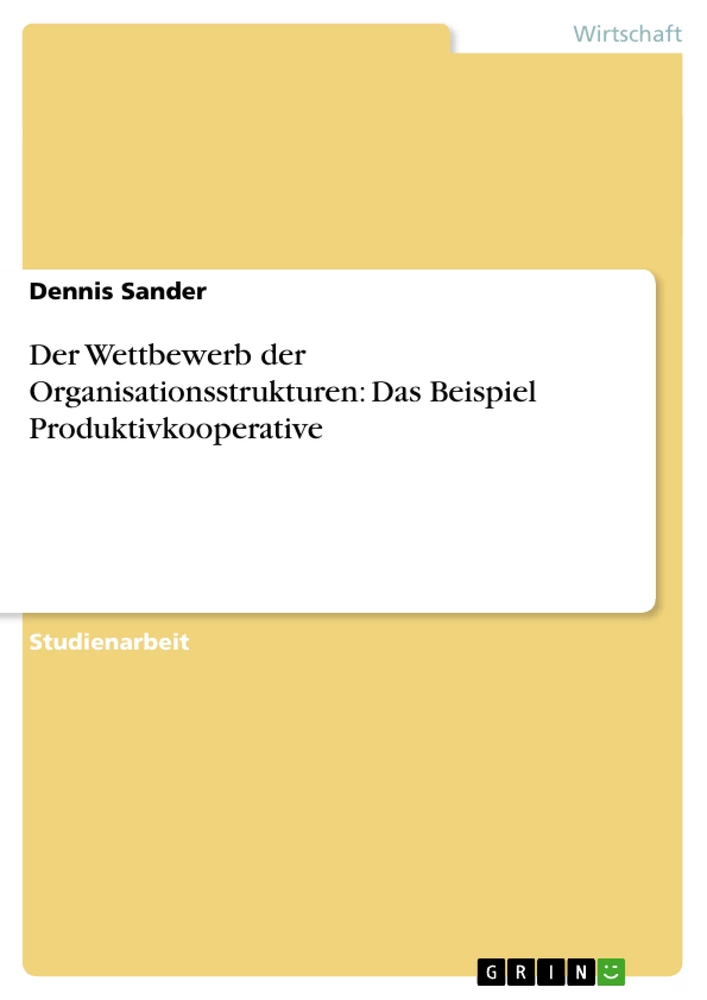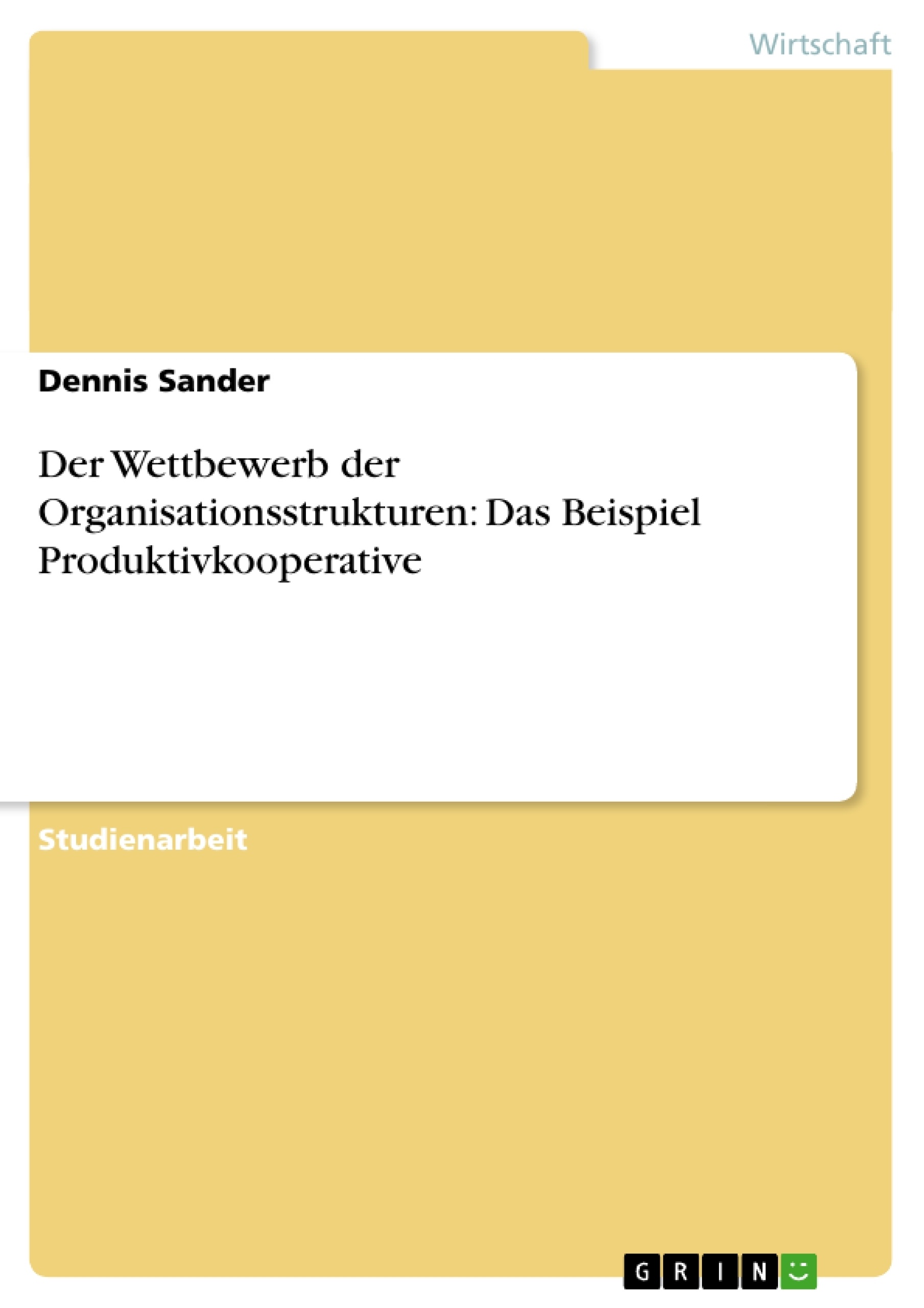1.1 Konzeption
Unter Produktivgenossenschaften versteht man Untenehmen landwirtschaftlicher
oder gewerblicher Art, bei denen die Genossen Mit-Unternehmer und
Arbeiternehmer zugleich sind. Sie bringen das Gesellschaftskapital auf und ihre
gesamte Arbeitskraft in die Genossenschaft ein1. Als Folge daraus ist auch jedes
Mitglied zu gleichen Teilen am erwirtschafteten Erfolg oder Verlust beteiligt. Sie,
die Produktivgenossenschaft, kennt also keine selbständigen Betriebe ihrer
Mitglieder, sondern lediglich den gemeinschaftlich getragenen Betrieb als solches.
Rechtlich ist sie eine Sonderform der genossenschaftlichen Rechtsform, wobei die
gesetzliche Definition (§ 1 Abs. 1 Nr.4 GenG) es nicht sofort vermuten lässt, da in
der Produktivgenossenschaft der Genosse sowohl Mit-Eigentümer als auch
Arbeitnehmer in einer Person ist.
1.2 Gründungsmotive
Die ursprüngliche und idealisierte Form der Produktivgenossenschaft macht sich zur
Aufgabe, die Mitgliederinteressen aller zu fördern und gleichzeitig eine optimale
Arbeitsleistung zu erreichen.
Neben der Gewinnerzielung sind auch sozialreformerische und sozialpolitische
Ziele relevant, bedingt durch die Ablehnung kapitalistisch orientierter
Unternehmerinteressen und entsprechender Wirtschafts- und Sozialpolitik.
Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung sollen die Arbeitsmoral und
Leistung der Mitglieder erhöhen und somit einen Wettbewerbsvorteil auf dem
Markt schaffen.
Aufgrund der aufgeführten Strukturmerkmale ist es nicht verwunderlich, dass es
keine einheitliche typologische Einordnung aller Erscheinungsformen von
Produktivgenossenschaften geben kann. Auf eine detaillierte Erklärung wird an
dieser Stelle verzichtet2.
1 Vgl. Höser, R. (1989); „Konkurrenzfähigkeit der Rechtsform Genossenschaft“; Idstein, S.28
2 Vgl. Villegas Velásque, R. (1975), « Die Funktionsfähigkeit von Produktivgenossenschaften »;
Tübingen, S. 12-23
Inhaltsverzeichnis
- Was sind Produktivgenossenschaften
- Konzeption
- Gründungsmotive
- Determinanten von Produktivgenossenschaften
- Richtlinien der „International Cooperative Alliance”
- Freier und freiwilliger Zugang
- Ein Mitglied – Eine Stimme
- Arbeiterkontrolle
- Partizipation an unternehmerischen Entscheidungsprozessen
- Gewinnteilung
- Identitätsprinzip
- Weitere Determinanten
- Ziele von Produktivgenossenschaften
- Realisierung des Demokratie-Prinzips
- Dividenden-Maximierung
- Optimale Förderung und Entwicklung der Mitglieder
- Probleme von Produktivgenossenschaften und entsprechende Lösungsansätze
- Finanzierungsprobleme
- Transformation
- Verteilung, Investition, Innovation
- Assoziation versus Hierarchie
- Externe Faktoren
- Der Stand der Produktivgenossenschaften heute am Beispiel United Kingdom
- Verschiedene Erklärungsansätze zur Entwicklung von Produktivgenossenschaften
- Transformation im Licht der neoklassischen Firmentheorie
- Transformation im Licht der Institutionenökonomik
- Degenerationsthese aus der Sicht von Meister
- Pfadabhängigkeitsthese von Institutionen nach Pagano
- Arten von Produktivgenossenschaften nach Cornforth
- Fazit
- Konzeption und Gründungsmotive von Produktivgenossenschaften
- Determinanten von Produktivgenossenschaften, insbesondere die „International Cooperative Alliance“ Richtlinien
- Ziele von Produktivgenossenschaften, wie die Realisierung des Demokratie-Prinzips, Dividenden-Maximierung und optimale Förderung der Mitglieder
- Probleme von Produktivgenossenschaften, wie Finanzierungsprobleme, Transformation, Verteilung, Investition, Innovation und externe Faktoren
- Verschiedene Erklärungsansätze zur Entwicklung von Produktivgenossenschaften
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema der Produktivgenossenschaften. Ziel ist es, die Funktionsweise, Determinanten, Ziele und Herausforderungen dieser Organisationsform zu untersuchen. Dabei wird die Analyse der Produktivgenossenschaften vor dem Hintergrund der „International Cooperative Alliance“ Richtlinien, neoklassischen Firmentheorie, Institutionenökonomik und Pfadabhängigkeitsthese erfolgen.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel definiert den Begriff der Produktivgenossenschaft und erläutert deren Konzeption und die relevanten Gründungsmotive. Das zweite Kapitel untersucht die Determinanten von Produktivgenossenschaften, wobei insbesondere die Richtlinien der „International Cooperative Alliance“ im Fokus stehen. Das dritte Kapitel befasst sich mit den Zielen von Produktivgenossenschaften, die Realisierung des Demokratie-Prinzips, Dividenden-Maximierung und die optimale Förderung der Mitglieder. Das vierte Kapitel analysiert die Probleme von Produktivgenossenschaften, wie Finanzierungsprobleme, Transformation, Verteilung, Investition, Innovation und externe Faktoren. Das fünfte Kapitel betrachtet den Stand der Produktivgenossenschaften heute am Beispiel des Vereinigten Königreichs. Das sechste Kapitel beleuchtet verschiedene Erklärungsansätze zur Entwicklung von Produktivgenossenschaften, darunter die Transformation im Licht der neoklassischen Firmentheorie, die Institutionenökonomik und die Pfadabhängigkeitsthese von Institutionen nach Pagano.
Schlüsselwörter
Produktivgenossenschaften, „International Cooperative Alliance“, Demokratie-Prinzip, Arbeiterkontrolle, Finanzierungsprobleme, Transformation, neoklassische Firmentheorie, Institutionenökonomik, Pfadabhängigkeitsthese, United Kingdom.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Produktivgenossenschaft?
Ein Unternehmen, bei dem die Mitglieder gleichzeitig Miteigentümer und Arbeitnehmer sind und gemeinsam das Kapital sowie die Arbeitskraft einbringen.
Was sind die Gründungsmotive für solche Kooperativen?
Neben wirtschaftlichem Erfolg stehen sozialpolitische Ziele wie Selbsthilfe, Selbstverwaltung und die Ablehnung rein kapitalistischer Interessen im Vordergrund.
Was besagt das Prinzip „Ein Mitglied – Eine Stimme“?
Es ist das demokratische Grundprinzip der Genossenschaft, wonach jedes Mitglied unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung das gleiche Stimmrecht hat.
Welche Probleme haben Produktivgenossenschaften oft?
Herausforderungen sind Finanzierungsschwierigkeiten, langsame Entscheidungsprozesse durch Partizipation und die Gefahr der Transformation in herkömmliche Firmen.
Was ist die Degenerationsthese?
Sie besagt, dass erfolgreiche Genossenschaften dazu neigen, ihre demokratischen Strukturen aufzugeben und sich im Laufe der Zeit in klassische kapitalistische Unternehmen zu verwandeln.
- Arbeit zitieren
- Dennis Sander (Autor:in), 2001, Der Wettbewerb der Organisationsstrukturen: Das Beispiel Produktivkooperative, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16773