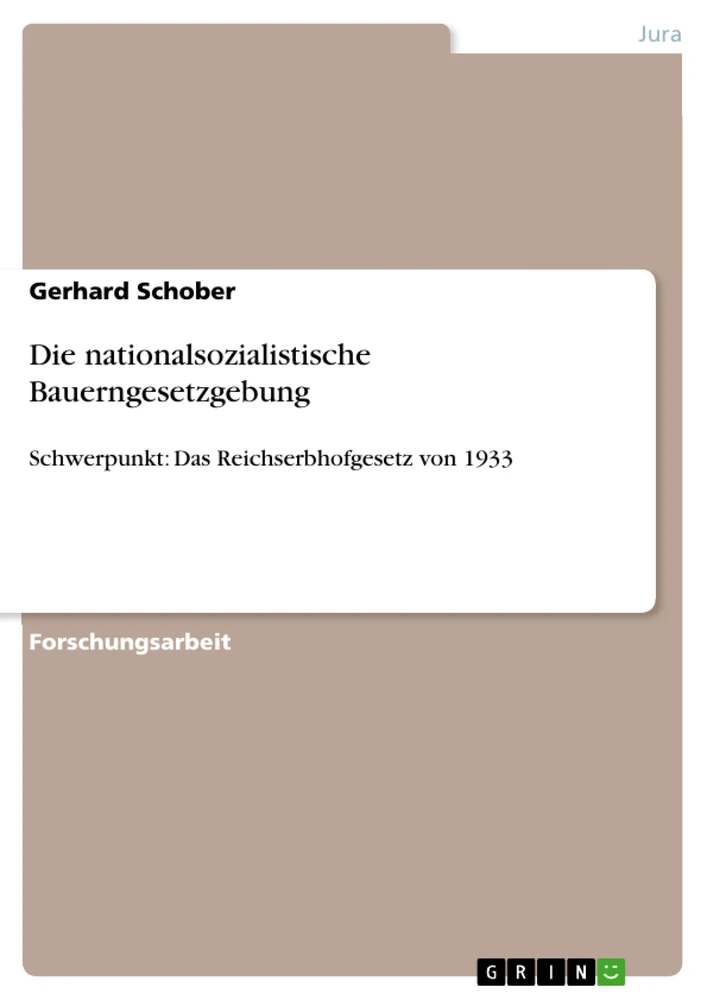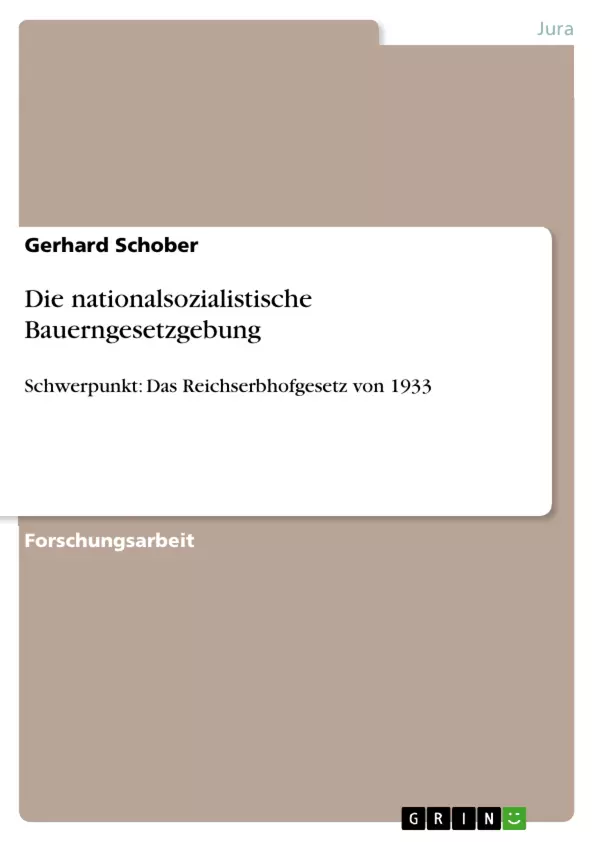Die unmittelbar nach dem Beginn der NS-Herrschaft einsetzende nationalsozialistische „Rassenpolitik” beruhte auf folgendem Gedankengang Hitlers: „Die Blutsmischung und das dadurch bedingte Senken des Rassenniveaus ist die alleinige Ursache des Absterbens alter Kulturen; denn die Menschen gehen nicht an verlorenen Kriegen zugrunde, sondern am Verlust jener Widerstandskraft, die nur dem reinen Blute zu eigen ist.“
Um die Qualität des deutschen Erbgutes zu verbessern, sollte deshalb das für “schädlich befundene fremdrassige Blut” aus der Volkgemeinschaft ausgeschieden werden. Den Auftakt hierfür bildete im April 1933 § 3 des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums (sog. “Arierparagraph”), der die Entlassung aller jüdischen Beamten, Angestellten und Arbeiter aus dem Staatsdienst anordnete. Mit diesem Gesetz, dem rund 3.000 antijüdische Gesetze und Verordnungen während der NS-Zeit folgten, wurde die nationalsozialistische Rassenlehre erstmals gesetzestechnisch wirksam.
Neben dem Ausschluss von „unreinem Blut” war eine Steigerung der eigenen Rassenqualität durch eine „Aufzüchtung” (bzw. „Aufnordung”) geplant. Für diese Aufgabe schien den Nationalsozialisten der geburtenstarke Bauernstand prädestiniert. Denn „die Bevölkerung auf dem Land ist...durchweg gesünder, kräftiger und noch kaum durch artfremdes Blut verdorben.“
Zur Umsetzung der Wiederaufzucht sollten die germanischen Bauern auf sog. Erbhöfen „erbgesunden” Nachwuchs aus ihrem „noch unbefleckten Erbgut“ hervorbringen, um ihn an die übrige Bevölkerung abzugeben und so der angestrebten „Aufnordung” Schritt für Schritt näher zu kommen.
Seine rechtliche Grundlage fand dieses Vorhaben in dem bereits Ende September 1933 verabschiedeten Reichserbhofgesetz. Wegen seiner Ausrichtung verwundert es nicht, dass es unter allen agrarpolitischen Maßnahmen des NS-Staates als das am stärksten ideologisch geprägte Gesetz gilt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kapitel I: Die NSDAP auf „Bauernfang”
- 1. Die große Krise der deutschen Landwirtschaft am Ende der Weimarer Republik
- 2. Die nationalsozialistische Bauernpolitik bis zur „Machtergreifung”
- Kapitel II: Durchsetzung nationalsozialistischer Agrarpolitik: Entschuldung, Reichsnährstand und Reichserbhofgesetz
- 1. Das Gesetz zur Regelung der landwirtschaftlichen Schuldverhältnisse (Schuldenregelungsgesetz)
- 2. Der Reichsnährstand
- 3. Die ideengeschichtlichen Hintergründe des Erbhofkonzeptes
- 3.1 Das Anerbenrecht und die bäuerliche Erbsitte
- 3.1.1 Die Entwicklung des Anerbenrechts bis 1933
- 3.2 Die Blut-und-Boden-Ideologie
- 3.1 Das Anerbenrecht und die bäuerliche Erbsitte
- 4. Das Reichserbhofgesetz
- 4.1 Das preußische Erbhofrecht als Vorläufer
- 4.2 Das Reichserbhofgesetz vom 29. September 1933
- 4.3 Das Reichserbhofgesetz im Verhältnis zum Bürgerlichen Gesetzbuch
- 4.3.1 Das Reichserbhofgesetz als Kern eines neuen völkischen Privatrechts
- 4.3.2 Der Erbhof als Teil des konkreten Ordnungsdenkens
- 4.4 Die „Fortbildung“ des Reichserbhofgesetzes
- 5. Das Anerbenrecht in Deutschland nach 1945
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die nationalsozialistische Bauernpolitik, insbesondere das Reichserbhofgesetz, im Kontext der wirtschaftlichen und ideologischen Bedingungen der Zeit. Sie beleuchtet den Weg der NSDAP zur Erlangung der Unterstützung der ländlichen Bevölkerung und analysiert die ideologische Grundlage und die praktische Umsetzung des Reichserbhofgesetzes.
- Die wirtschaftliche Krise der deutschen Landwirtschaft in der Weimarer Republik
- Die Strategie der NSDAP zur Gewinnung der Bauern als Wähler
- Die ideologische Grundlage des Reichserbhofgesetzes (Blut und Boden)
- Die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte des Reichserbhofgesetzes
- Die Entwicklung des Anerbenrechts in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I: Die NSDAP auf „Bauernfang”: Dieses Kapitel beschreibt die schwere Krise der deutschen Landwirtschaft Ende der Weimarer Republik, gekennzeichnet durch Überproduktion, Preisstürze und die Folgen des Ersten Weltkriegs. Es analysiert, wie die NSDAP diese Misere für ihre Propaganda nutzte und ihre anfänglich wenig attraktive sozialistische Programmatik für die konservativ eingestellten Bauern umdeutete, um deren Stimmen zu gewinnen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der nationalsozialistischen Agrarpolitik vor der „Machtergreifung“ und dem Wandel der Parteipolitik im Hinblick auf die ländliche Bevölkerung.
Kapitel II: Durchsetzung nationalsozialistischer Agrarpolitik: Entschuldung, Reichsnährstand und Reichserbhofgesetz: Dieses Kapitel beleuchtet die Durchsetzung der nationalsozialistischen Agrarpolitik nach der „Machtergreifung“. Es erklärt die landwirtschaftliche Entschuldung, die Gründung des Reichsnährstandes und die ideengeschichtlichen Wurzeln des Erbhofkonzeptes, einschließlich des traditionellen Anerbenrechts und der „Blut und Boden“-Ideologie. Der Kern des Kapitels ist eine detaillierte Erläuterung des Reichserbhofgesetzes selbst, seiner rechtlichen Grundlagen und seines Verhältnisses zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Die Entwicklung des Anerbenrechts nach 1945 wird ebenfalls angesprochen.
Schlüsselwörter
Reichserbhofgesetz, nationalsozialistische Agrarpolitik, Blut und Boden-Ideologie, Anerbenrecht, landwirtschaftliche Krise, Weimarer Republik, NSDAP, Reichsnährstand, Entschuldung, völkische Ideologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Nationalsozialistische Agrarpolitik und das Reichserbhofgesetz
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die nationalsozialistische Agrarpolitik, insbesondere das Reichserbhofgesetz. Es analysiert die wirtschaftlichen und ideologischen Hintergründe dieser Politik, die Strategien der NSDAP zur Gewinnung der Bauern und die praktische Umsetzung des Gesetzes.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in zwei Hauptkapitel: Kapitel I befasst sich mit der Situation der deutschen Landwirtschaft in der Weimarer Republik und der Strategie der NSDAP zur Gewinnung der Bauern. Kapitel II analysiert die Durchsetzung der nationalsozialistischen Agrarpolitik nach der Machtergreifung, insbesondere die landwirtschaftliche Entschuldung, den Reichsnährstand und das Reichserbhofgesetz, inklusive seiner rechtlichen und ideologischen Grundlagen sowie seiner Entwicklung nach 1945.
Was sind die wichtigsten Themenschwerpunkte?
Die wichtigsten Themen sind die wirtschaftliche Krise der deutschen Landwirtschaft in der Weimarer Republik, die Strategien der NSDAP zur Gewinnung der Bauern, die ideologische Grundlage des Reichserbhofgesetzes ("Blut und Boden"), die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte des Gesetzes, die Entwicklung des Anerbenrechts in Deutschland und der Vergleich mit dem BGB.
Welche Ziele verfolgt das Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, die nationalsozialistische Bauernpolitik und das Reichserbhofgesetz im Kontext der wirtschaftlichen und ideologischen Bedingungen der Zeit zu untersuchen. Es beleuchtet den Weg der NSDAP zur Erlangung der Unterstützung der ländlichen Bevölkerung und analysiert die ideologische Grundlage und die praktische Umsetzung des Reichserbhofgesetzes.
Was ist das Reichserbhofgesetz und welche Bedeutung hat es?
Das Reichserbhofgesetz war ein zentrales Element der nationalsozialistischen Agrarpolitik. Es zielte darauf ab, den bäuerlichen Besitz zu sichern und zu vererben, um ein "gesundes" Bauerntum zu schaffen, das im Einklang mit der "Blut und Boden"-Ideologie stand. Es hatte tiefgreifende Auswirkungen auf das deutsche Landwirtschaftsrecht und das Familienrecht.
Welche Rolle spielt die "Blut und Boden"-Ideologie?
Die "Blut und Boden"-Ideologie war eine zentrale ideologische Grundlage des Reichserbhofgesetzes. Sie verband die Idee einer starken, ländlichen Bevölkerung mit der Vorstellung einer natürlichen Verbundenheit von Volk und Land. Diese Ideologie wurde genutzt, um die Bauern für die nationalsozialistische Politik zu gewinnen.
Wie wird die wirtschaftliche Situation der Landwirtschaft in der Weimarer Republik dargestellt?
Das Dokument beschreibt die schwere Krise der deutschen Landwirtschaft am Ende der Weimarer Republik, gekennzeichnet durch Überproduktion, Preisstürze und die Folgen des Ersten Weltkriegs. Diese Krise wurde von der NSDAP propagandistisch genutzt, um die Bauern für ihre Politik zu gewinnen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Verständnis des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: Reichserbhofgesetz, nationalsozialistische Agrarpolitik, Blut und Boden-Ideologie, Anerbenrecht, landwirtschaftliche Krise, Weimarer Republik, NSDAP, Reichsnährstand, Entschuldung, völkische Ideologie.
- Quote paper
- Dr. jur. Gerhard Schober (Author), 2007, Die nationalsozialistische Bauerngesetzgebung , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167745