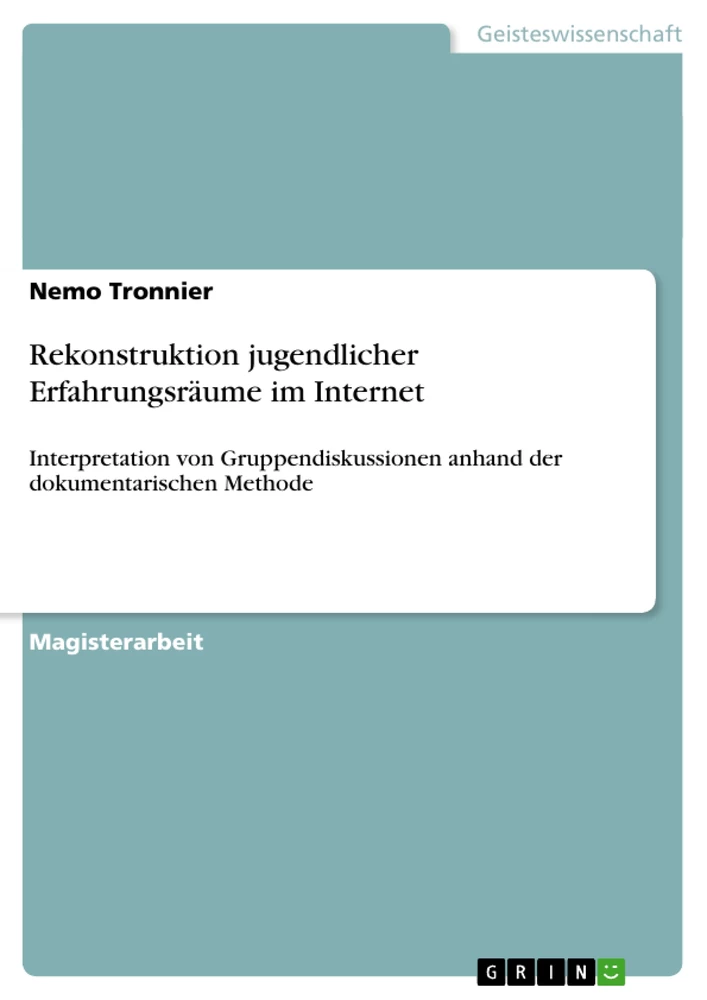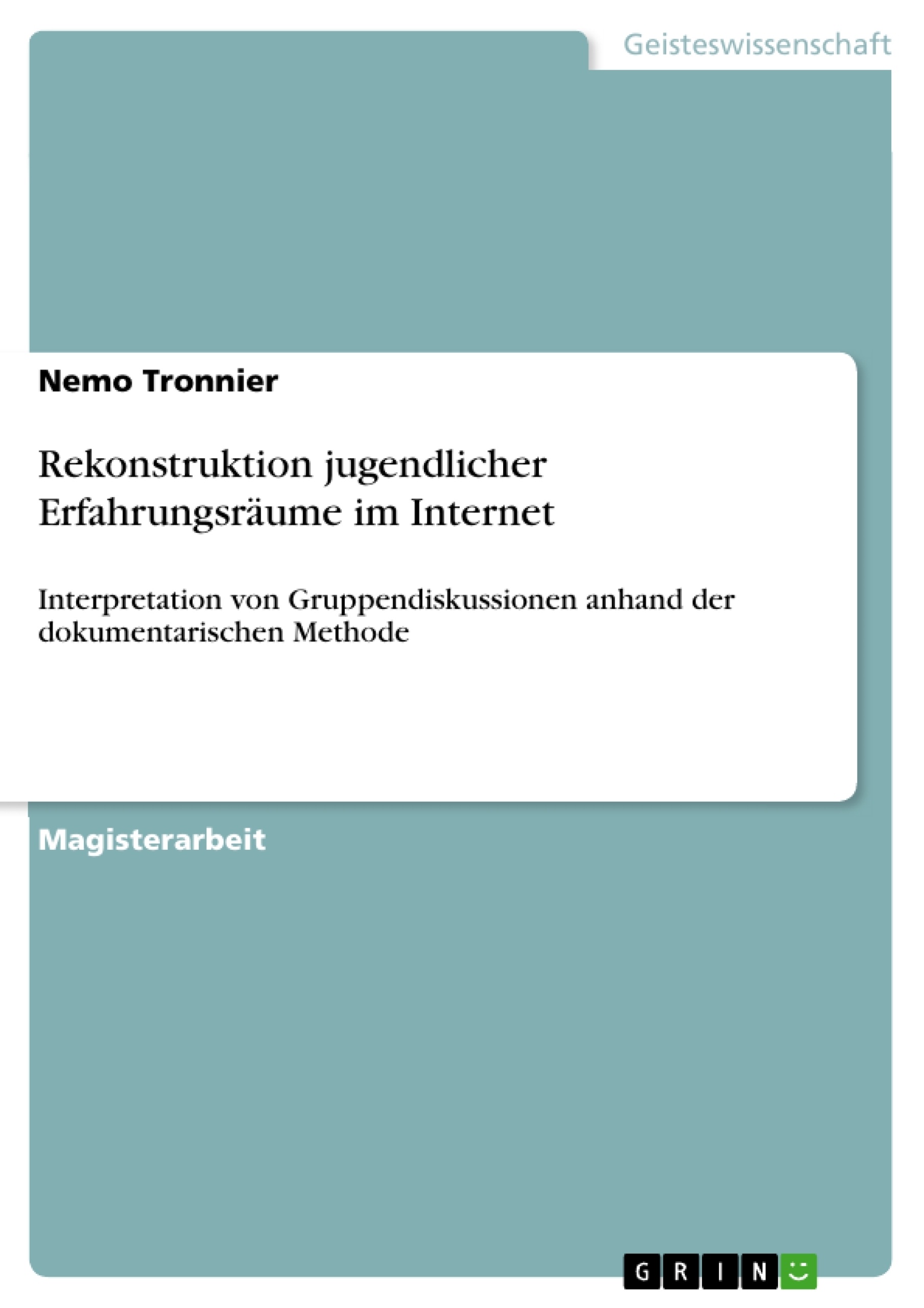Ausgehend von der kritischen Diskussion um die Unterscheidung von „digital natives“ und „digital immigrants“ (Prensky) wird in dieser Magisterarbeit nach dem empirischen Gehalt generationsspezifischer Typisierungen mit Bezug auf das Internet und die neuen digitalen Medien gefragt. Um dieser Diskussion mehr Substanz zu verleihen, als es die bisherigen, vor allem quantitativ ausgerichteten Erhebungen vermögen, wird die von Ralf Bohnsack auf der Grundlage von Gruppen-diskussionen ausgearbeitete Dokumentarische Methode auf das Problem angewendet. Dieser an Mannheims Unterscheidung verschiedener Sinnschichten (objektiver Sinn, intentionaler Ausdrucks-sinn und Dokumentsinn) ausgerichteten Interpretationsansatz wird in einem methodologischen Teil ausführlich vorgestellt, um zunächst theoretisch zu plausibilisieren, warum dieses Vorgehen begründet und vielversprechend ist. Nicht zuletzt die Tatsache, dass Mannheim eine der elaboriertesten Reflexionen zum Konzept der Generationen vorgelegt hat, kommt diesem Anliegen entgegen. Mit diesem Forschungsdesign wird die Frage nach dem Generationenunterschied der vor bzw. nach 1980 geborenen Jahrgänge mit Blick auf die Internetnutzung anhand der Spuren ihrer „konjunktiven Erfahrungsräume“ deutlich, die sich an den transkribierten Gesprächsprotokollen sichtbar machen lassen. Diese konjunktiven Erfahrungen können sich (müssen sich aber nicht) abhängig von der Generationenlagerung tiefgreifend unterscheiden, ebenso wie sie nach Geschlechts- oder Milieuzugehörigkeit variieren können. Die Fragestellung wird also in einen empirisch offenen Prozess der Hypothesengenerierung mittels formulierender und reflektierender Interpretation der Diskussionen zum digitalen Alltag minimal bzw. maximal kontrastierender Gruppen (einer Gesamtschulgruppe am Ende der Mittelstufe, einer Abiturientinnengruppe und einer Gruppe 40+) überführt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- EINLEITUNG
- THEORETISCHER TEIL
- Digital Natives
- Marc Prensky: Digital Natives, Digital Immigrants
- Rolf Schulmeister: Gibt es eine >>Net Generation<
- Peter Kruse: Digital Visitors und Digital Residents
- John Palfrey und Urs Gasser: Generation Internet
- Jugendstudien
- Shell Jugendstudie 2010
- „Jugend, Information und (Multi-)Media\"-Studie 2009
- ARD/ZDF-Onlinestudie 2010
- Zwischenfazit
- METHODISCH-METHODOLOGISCHER TEIL
- Karl Mannheim
- Beiträge zur Theorie der Weltanschauungs-Interpretation
- Das Problem der Generationen
- Dokumentarische Methode
- Entstehung des Gruppendiskussionsverfahrens
- Formalien des Gruppendiskussionsverfahrens
- Konkrete Auswertungsschritte des Gruppendiskussionsverfahrens mit der dokumentarischen Methode
- Exkurs Akteur-Netzwerk-Theorie
- Methodische Parallelen zwischen der dokumentarischen Methode und der Akteur-Netzwerk-Theorie
- Mögliche Beiträge der Akteur-Netzwerk-Theorie zur Erfassung jugendlicher Erfahrungsräume im Internet
- Zwischenfazit
- EMPIRISCHER TEIL
- Forschungszugang
- Die Gruppe ,,Schüler"
- Diskursbeschreibung
- Die Gruppe ,,Abiturientinnen"
- Diskursbeschreibung
- Die Gruppe „Generation 40+"
- Diskursbeschreibung
- Gegenüberstellung der Gruppendiskussionen
- SPANNUNGSFELDER JUGENDLICHER ERLEBNISWELTEN
- Experimentieren versus Reglementieren
- Fake-Accounts im Internet als generationstypische Form des Identitätsspiels
- Computerspiele als Symbol der Spannung zwischen den Dimensionen Experimentieren und Reglementieren
- Probleme der Reglementierung
- Sexualisierte Erlebniswelt Internet
- Intimität versus Fremdheit
- Orientierungen bezüglich des Umgangs mit privaten Daten in den sozialen Netzwerken der Schüler im Internet
- Fokussierungsmetapher: SchülerVZ - ein Raum nur für Schüler?
- Indexikale Wörter: „Stalken\" als positive Praxis
- Selbstdarstellungspraktiken in Social Network Sites
- Exkurs Akteur-Netzwerk-Theorie: Die ICQ-Funktion „, Unsichtbarkeit\" als determinierender Faktor des Internetgebrauchs
- VERGLEICH DER ERGEBNISSE MIT DEM AKTUELLEN STAND DER FORSCHUNG
- Identitätsspiel
- Computerspielsucht
- Geschlechtlichkeit und Pornographie
- Privatheit
- Kommunikation und Selbstdarstellung
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Magisterarbeit befasst sich mit der Rekonstruktion jugendlicher Erfahrungsräume im Internet. Ziel ist es, die digitalen Erfahrungen von Jugendlichen mithilfe der dokumentarischen Methode und Gruppendiskussionen zu erforschen.
- Die Bedeutung der digitalen Medien für die Generation der "Digital Natives"
- Der Einfluss des Internets auf die Identität und Selbstdarstellung von Jugendlichen
- Spannungsfelder zwischen Experimentieren und Reglementieren im Internet
- Der Umgang mit Privatsphäre und Intimität in sozialen Netzwerken
- Kommunikations- und Selbstdarstellungspraktiken im digitalen Raum
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz der Arbeit vor.
- Der theoretische Teil beleuchtet den Diskurs um die "Digital Natives" und die Ergebnisse relevanter Jugendstudien.
- Der methodisch-methodologische Teil erläutert die dokumentarische Methode und ihre Anwendung auf Gruppendiskussionen. Ein Exkurs zur Akteur-Netzwerk-Theorie wird vorgestellt.
- Der empirische Teil präsentiert die Ergebnisse der drei Gruppendiskussionen mit Jugendlichen und Erwachsenen.
- Das Kapitel "Spannungsfelder jugendlicher Erlebniswelten" analysiert zentrale Themen wie Experimentieren vs. Reglementieren, Intimität vs. Fremdheit und die Bedeutung von Selbstdarstellung im Internet.
- Der Vergleich der Ergebnisse mit dem aktuellen Stand der Forschung beleuchtet Themen wie Identitätsspiel, Computerspielsucht, Geschlechtlichkeit, Privatheit und Kommunikation.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit fokussiert auf die Themen "Digital Natives", "Jugendliche Erfahrungen im Internet", "Dokumentarische Methode", "Gruppendiskussionen", "Identitätsspiel", "Selbstdarstellung", "Privatsphäre", "Intimität", "Experimentieren", "Reglementieren", "Soziale Netzwerke", "Computerspielsucht", "Geschlechtlichkeit" und "Pornographie".
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet „Digital Natives“ von „Digital Immigrants“?
Der Begriff nach Prensky unterscheidet Generationen, die mit digitalen Medien aufgewachsen sind (Natives), von jenen, die sie erst im Erwachsenenalter erlernt haben (Immigrants).
Was ist die dokumentarische Methode nach Ralf Bohnsack?
Es ist ein Interpretationsansatz für Gruppendiskussionen, der nach dem „Dokumentsinn“ sucht, um konjunktive Erfahrungsräume und Orientierungsmuster einer Gruppe freizulegen.
Wie gehen Jugendliche mit Privatsphäre im Internet um?
Die Arbeit untersucht Spannungsfelder wie „Intimität versus Fremdheit“ und zeigt, wie Jugendliche soziale Netzwerke zur Selbstdarstellung nutzen, während sie gleichzeitig Reglementierungen umgehen.
Welche Rolle spielen „Fake-Accounts“ für Jugendliche?
Fake-Accounts werden als generationstypische Form des Identitätsspiels analysiert, die es ermöglichen, in geschützten Räumen zu experimentieren.
Was bedeutet „Stalken“ im jugendlichen Sprachgebrauch?
Im untersuchten Kontext wird „Stalken“ oft als positive Praxis der Informationsbeschaffung über Gleichaltrige in sozialen Netzwerken (wie SchülerVZ) verstanden.
Gibt es tatsächlich einen tiefgreifenden Generationenunterschied?
Die Arbeit hinterfragt dies empirisch durch den Vergleich von Schülern, Abiturienten und der Gruppe 40+, um zu sehen, ob die Internetnutzung tatsächlich milieuspezifisch oder generationsspezifisch variiert.
- Quote paper
- Nemo Tronnier (Author), 2011, Rekonstruktion jugendlicher Erfahrungsräume im Internet, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167786