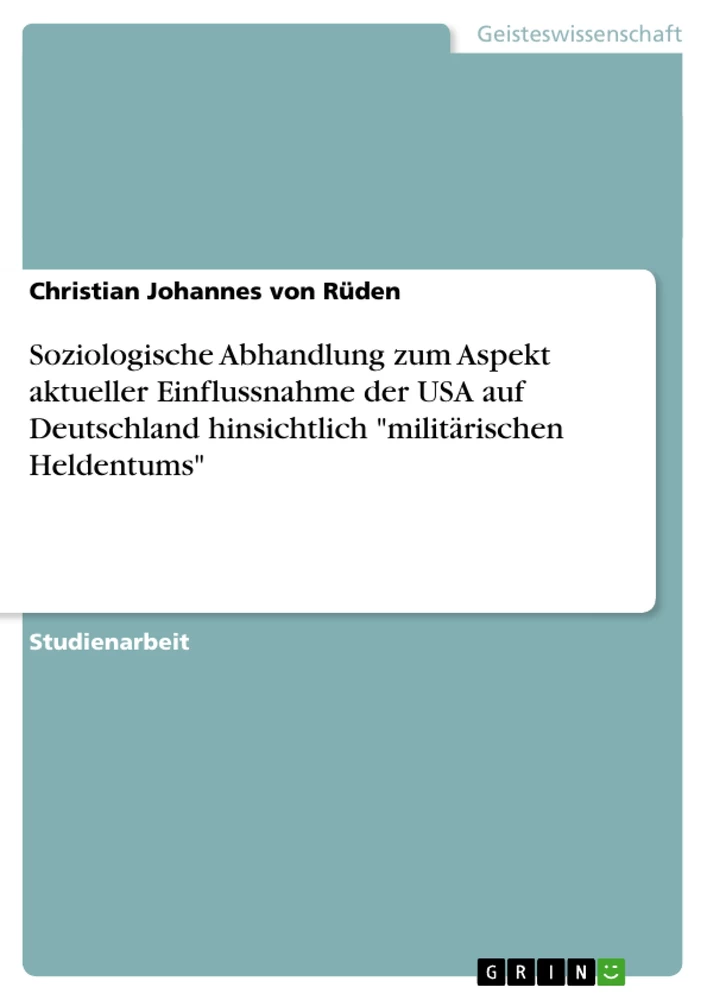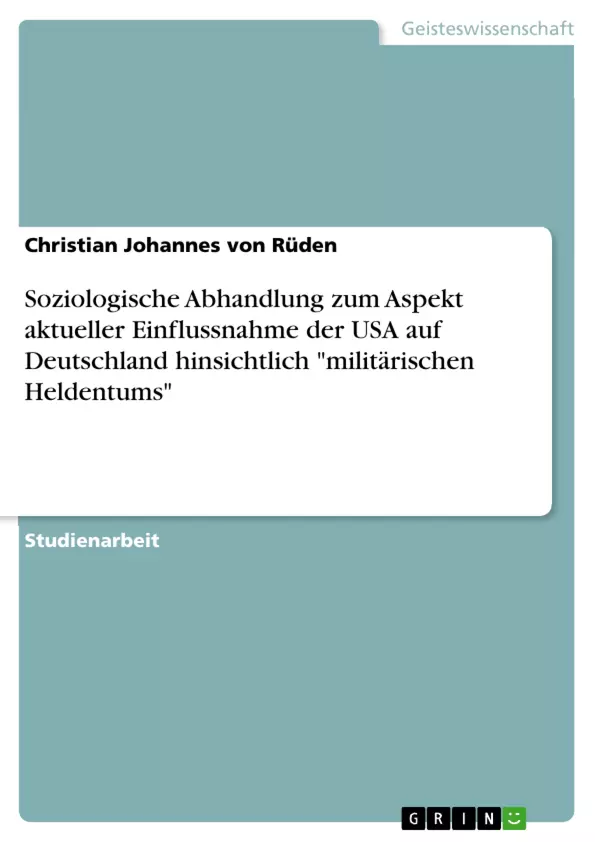1. Einleitung und Fragestellung
In der zweiten Sitzung zum Seminar „Männer oder Memmen: Heldentum in
der postheroischen Gesellschaft“ wurde unter anderem, vom Dozenten [anonymisiert], der in jüngster Vergangenheit aufgetretene Aspekt der Einflussnahme der NATO-Partner Deutschlands, hier insbesondere der USA, auf die deutsche Beteiligungswilligkeit an militärischen Einsätzen heran gezogen. Hier bezog sich der Dozent insbesondere auf den zweiten Golfkrieg in den Neunziger Jahren, bei welchem die US-amerikanische Militärführung fälschlicherweise angenommen hatte, dass sich die „harten Deutschen Kämpfer“ anstandslos in Form von Truppenverbänden direkt am Kriegseinsatz an der Front beteiligen
würden.1 Als dies seitens der deutschen Politik abgelehnt wurde, entbrannte in den Vereinigten Staaten eine rege Diskussion über die Zuverlässigkeit von Verbündeten, insbesondere Deutschlands, bei militärischen Einsätzen mit dem Ergebnis, dass anscheinend in den folgenden Jahren, insbesondere seit den Geschehnissen des elften September ein stetig steigender Druck und Einfluss auf die deutsche Politik genommen werden sollte um diese zu einer größeren Anteilhabe an Militäreinsätzen zu bewegen. Ich stellte mir daher nach der Sitzung die Frage worin genau diese Einflussnahme
der USA gegenüber Deutschland soziologisch und gesellschaftsgeschichtlich begründet sein könnte und wo genau zwischen den beiden Staaten USA und Deutschland heutzutage der Perspektivenunterschied im Hinblick auf den „militärischen Helden“ festgelegt sein könnte.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung und Fragestellung
- Blick auf verfassungsrechtliche Regelungen im Grundgesetz zu den militärischen Möglichkeiten der Bundesrepublik Deutschland
- Ansichten des US-Militärs zum „militärischen Heldentum“ aufgrund der amerikanischen Verfassung
- Einsichten in die heutigen Militärpraxen beider Staaten: Richtlinien für deutsche Soldaten nach dem Soldatengesetz und die Fahneneide in den USA und Deutschland
- Abschließende Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Abhandlung zielt darauf ab, die soziologischen und gesellschaftsgeschichtlichen Hintergründe der vermeintlichen amerikanischen Einflussnahme auf die deutsche Beteiligung an Militäreinsätzen im Ausland zu analysieren. Dabei werden die unterschiedlichen Perspektiven auf „militärisches Heldentum“ in Deutschland und den USA im Kontext der jeweiligen Verfassungen und historischen Entwicklungen untersucht.
- Der Einfluss der USA auf die deutsche Militärpolitik im Nachkriegskontext
- Die Unterschiede in der Wahrnehmung von „militärischen Helden“ in Deutschland und den USA
- Die Rolle der Verfassung in der Gestaltung der Militärpolitik beider Länder
- Die historischen Hintergründe und die aktuelle Entwicklung der deutschen und amerikanischen Militärpraxen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Die Einleitung und Fragestellung befasst sich mit der Beobachtung des wachsenden amerikanischen Drucks auf die deutsche Politik, sich stärker an Militäreinsätzen zu beteiligen, ausgehend vom zweiten Golfkrieg.
- Das zweite Kapitel beleuchtet die verfassungsrechtlichen Grundlagen der deutschen Militärpolitik im Nachkriegskontext, insbesondere die Auswirkungen des „Morgenthau-Plans“ auf die Vorstellung eines militärischen Deutschlands.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Abhandlung fokussiert auf die Themen „militärisches Heldentum“, „Amerikanische Einflussnahme“, „deutsche Militärpolitik“, „Verfassungsrecht“, „Grundgesetz“, „Soldatengesetz“, „Fahneneid“, „historische Entwicklung“, „soziologische Analyse“ und „vergleichende Perspektive“.
Häufig gestellte Fragen
Warum üben die USA Druck auf die deutsche Militärpolitik aus?
Seit dem zweiten Golfkrieg und insbesondere seit dem 11. September erwarten die USA von ihren NATO-Partnern, insbesondere Deutschland, eine stärkere aktive Beteiligung an militärischen Einsätzen an der Front.
Wie unterscheidet sich das Heldenbild in den USA und Deutschland?
Während in den USA militärisches Heldentum oft kulturell tief verankert und positiv besetzt ist, gilt Deutschland als „postheroische Gesellschaft“, die militärischer Gewalt skeptisch gegenübersteht.
Welche verfassungsrechtlichen Schranken gibt es in Deutschland?
Das Grundgesetz setzt enge Grenzen für Auslandseinsätze der Bundeswehr. Historisch ist dies auch auf den Nachkriegskontext und Pläne zur Entmilitarisierung (wie den Morgenthau-Plan) zurückzuführen.
Was regelt das deutsche Soldatengesetz im Vergleich zum US-Fahneneid?
Das Soldatengesetz betont die Rolle des „Staatsbürgers in Uniform“ und die Bindung an Recht und Gesetz, während der US-Eid oft eine stärkere patriotische und verfassungstreue Symbolik aufweist.
Was bedeutet „postheroische Gesellschaft“?
Es beschreibt eine Gesellschaft, in der das Opfern des eigenen Lebens für nationale Ziele oder militärischen Ruhm nicht mehr als gesellschaftlicher Idealwert angesehen wird.
- Arbeit zitieren
- Christian Johannes von Rüden (Autor:in), 2010, Soziologische Abhandlung zum Aspekt aktueller Einflussnahme der USA auf Deutschland hinsichtlich "militärischen Heldentums", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167823