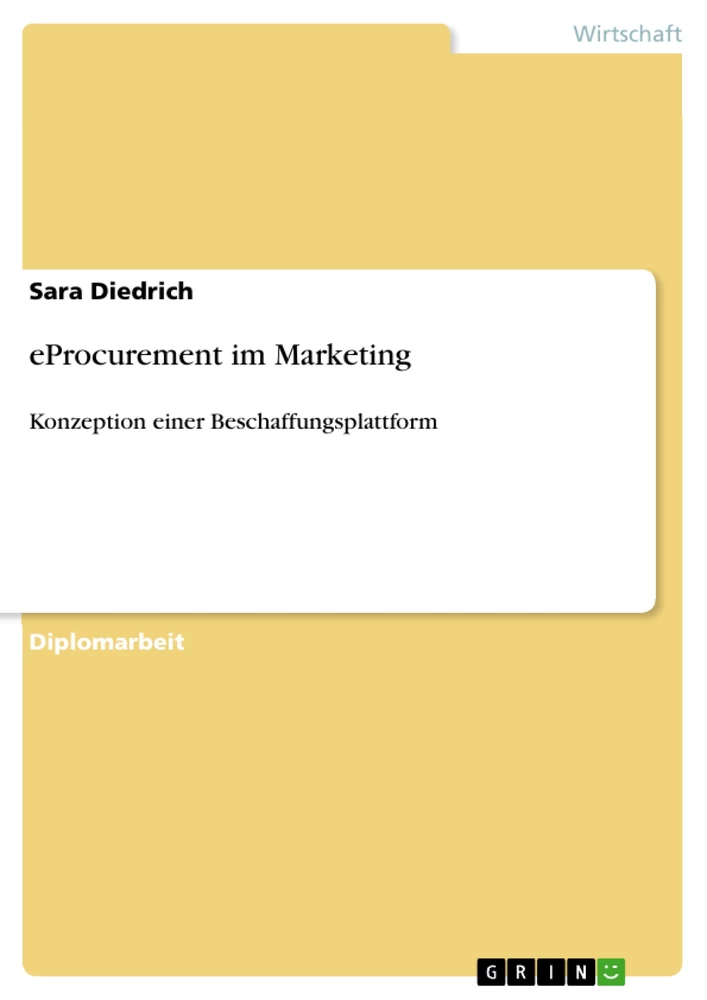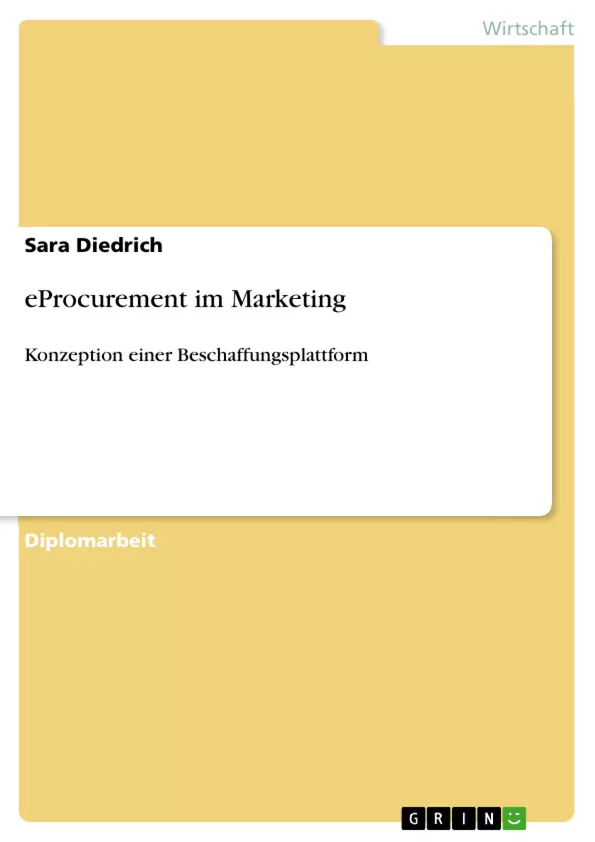eProcurement im Marketing - Konzeption einer Beschaffungsplattform
Zieldefinition
[...]Ziel dieser Arbeit ist im ersten Schritt die Analyse der gegenwärtigen Beschaffungsmodalitäten für den Einkauf von Marketingdienstleistungen. Hierbei geht es um die Frage, ob Grenzen für die Marketingbeschaffung bestehen und wenn ja, wo diese liegen. Aufbauend auf den Ergebnissen, wird die Entwicklung eines Konzeptes für die effiziente Unterstützung des Marketingeinkaufs über eine eProcurement-Anwendung angestrebt.
Als Grundlage für die Ausführungen dieser Arbeit werden zuerst die erforderlichen Begriffsdefinitionen zu den Themen eProcurement und Marketing vorgenommen sowie deren Wirkungsbereiche im Unternehmensgeschehen erörtert. Nachfolgend wird die Beschaffung von Marketingleistungen dargelegt, und Grenzen im Bezug auf die elektronische Unterstützung im Beschaffungsprozess werden herausgearbeitet. Mit der Identifikation der Optimierungspotenziale im Einkaufsprozess wird der Grundstein für die anschließende Konzeptionsarbeit gesetzt.
Der praktische Teil dieser Arbeit beginnt mit der Untersuchung vorhandener Beschaffungssysteme im Hinblick auf den Dienstleistungseinkauf. Die Ausarbeitung eines Konzeptes zur Entwicklung einer Software-Anwendung, die den Einkauf komplexer
Marketingdienstleistungen sinnvoll unterstützen kann, wird im letzten Teil vorgenommen. Abschließend wird werden die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und ein Fazit gezogen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 Einleitung und Zieldefinition
- 2 Grundlagen
- 2.1 Grundlagen des eProcurements
- 2.1.1 Verständnis des Begriffs „Beschaffung“ in der Betriebswirtschaftslehre
- 2.1.2 Definition und Abgrenzung des Begriffs „eProcurement“
- 2.1.3 Einsatzbereiche des eProcurements
- 2.2 Grundlagen des Marketings
- 2.2.1 Definition und Abgrenzung des Begriffs Marketing
- 2.2.2 Die Instrumente der absatzfördernden Kommunikation im Marketing
- 3 Die Beschaffung im Marketing
- 3.1 Die Marketingdienstleistung als Beschaffungsgut
- 3.2 Der klassische Beschaffungsweg für Marketingleistungen
- 3.3 Beschaffung von Marketingleistungen in ihrer Eigenschaft als Dienstleistung im Vergleich zur Beschaffung materieller Güter
- 3.4 Identifikation möglicher Problembereiche und Grenzen bei der elektronischen Beschaffung
- 3.5 Beurteilung des klassischen Beschaffungsweges mit Identifikation möglicher Optimierungspotenziale
- 4 Konzeption einer eProcurement-Plattform für die Beschaffung im Marketing
- 4.1 Vorüberlegungen zur Beschaffungsplattform
- 4.1.1 Markt-/Wettbewerbsanalyse bestehender Plattformen
- 4.1.2 Anforderungsprofil der Marketing-Beschaffungsplattform
- 4.2 Konzept der Marketing-Beschaffungsplattform
- 4.2.1 Aufbau und Funktionen des Projektmanagers
- 4.2.2 Aufbau und Funktionen des Budgetmanagers
- 4.2.3 Datenbank der Marketing-Beschaffungsplattform
- 4.2.4 Analysen und Abfragen
- 4.2.5 Das Rollen-/Rechtesystem
- 5 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Konzeption einer eProcurement-Plattform für die Beschaffung im Marketing. Ziel ist es, die Herausforderungen und Möglichkeiten der elektronischen Beschaffung von Marketingdienstleistungen zu analysieren und ein praxistaugliches Konzept für eine Plattform zu entwickeln, die den Beschaffungsprozess effizienter und transparenter gestaltet.
- Analyse der Grundlagen des eProcurements und des Marketings
- Identifikation der spezifischen Herausforderungen der Beschaffung von Marketingdienstleistungen
- Entwicklung eines Konzepts für eine eProcurement-Plattform, die auf die besonderen Bedürfnisse der Marketingbeschaffung zugeschnitten ist
- Bewertung der Vorteile und Herausforderungen der Implementierung einer solchen Plattform
- Diskussion der zukünftigen Entwicklungen und Trends im Bereich des eProcurements im Marketing
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel 1 führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und definiert die Ziele der Arbeit. Kapitel 2 behandelt die Grundlagen des eProcurements und des Marketings. Hier werden die wichtigsten Begriffe und Konzepte erläutert, die für die weitere Analyse relevant sind. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Beschaffung im Marketing. Es wird die Marketingdienstleistung als Beschaffungsgut betrachtet, der klassische Beschaffungsweg analysiert und die spezifischen Herausforderungen der Beschaffung von Dienstleistungen im Vergleich zur Beschaffung materieller Güter dargestellt. Kapitel 4 präsentiert die Konzeption einer eProcurement-Plattform für die Beschaffung im Marketing. Dieses Kapitel erläutert die Vorüberlegungen zur Plattform, das Konzept der Marketing-Beschaffungsplattform sowie den Aufbau und die Funktionen der Plattform. Kapitel 5 enthält eine Schlussbetrachtung, die die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammenfasst und einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen gibt.
Schlüsselwörter (Keywords)
eProcurement, Marketing, Beschaffung, Marketingdienstleistungen, Plattform, Beschaffungsprozess, Effizienz, Transparenz, Online-Beschaffung, Digitalisierung, Marketingkommunikation, digitale Medien, Marktanalyse, Wettbewerbsanalyse, Budgetverwaltung, Projektmanagement, Rollen- und Rechtesystem
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Diplomarbeit zum eProcurement?
Ziel ist die Analyse der Beschaffung von Marketingdienstleistungen und die Konzeption einer effizienten eProcurement-Plattform zur Unterstützung dieses Prozesses.
Warum ist die Beschaffung im Marketing speziell?
Im Gegensatz zu materiellen Gütern sind Marketingdienstleistungen komplex und oft schwer standardisierbar, was die elektronische Beschaffung vor besondere Herausforderungen stellt.
Welche Optimierungspotenziale bietet eProcurement im Marketing?
Es ermöglicht eine höhere Transparenz, effizientere Budgetverwaltung und eine bessere Steuerung von Projekten und Agenturleistungen.
Welche Funktionen sollte eine Marketing-Beschaffungsplattform haben?
Das Konzept sieht unter anderem einen Projektmanager, einen Budgetmanager, eine Datenbank für Dienstleister sowie ein detailliertes Rollen- und Rechtesystem vor.
Was sind die Grenzen der elektronischen Unterstützung in diesem Bereich?
Die Arbeit identifiziert Problembereiche wie die Schwierigkeit, kreative Leistungen rein über automatisierte Systeme zu bewerten oder zu vergleichen.
Welche Instrumente der Kommunikation werden berücksichtigt?
Es werden verschiedene Instrumente der absatzfördernden Kommunikation betrachtet, deren Beschaffung über die Plattform koordiniert werden soll.
- Quote paper
- Sara Diedrich (Author), 2010, eProcurement im Marketing, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167832