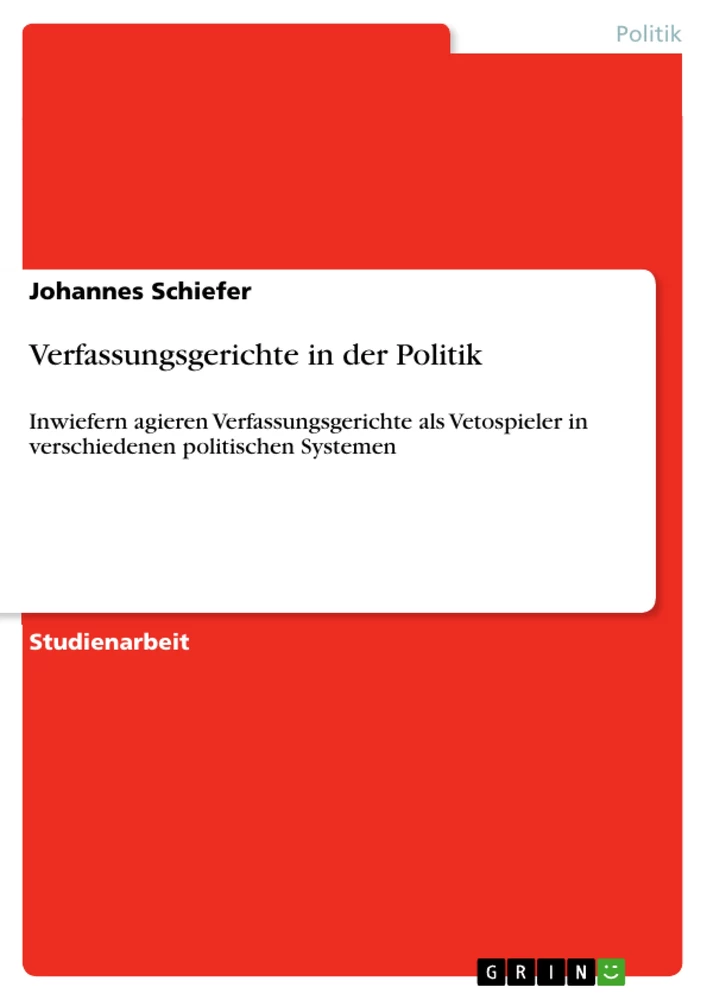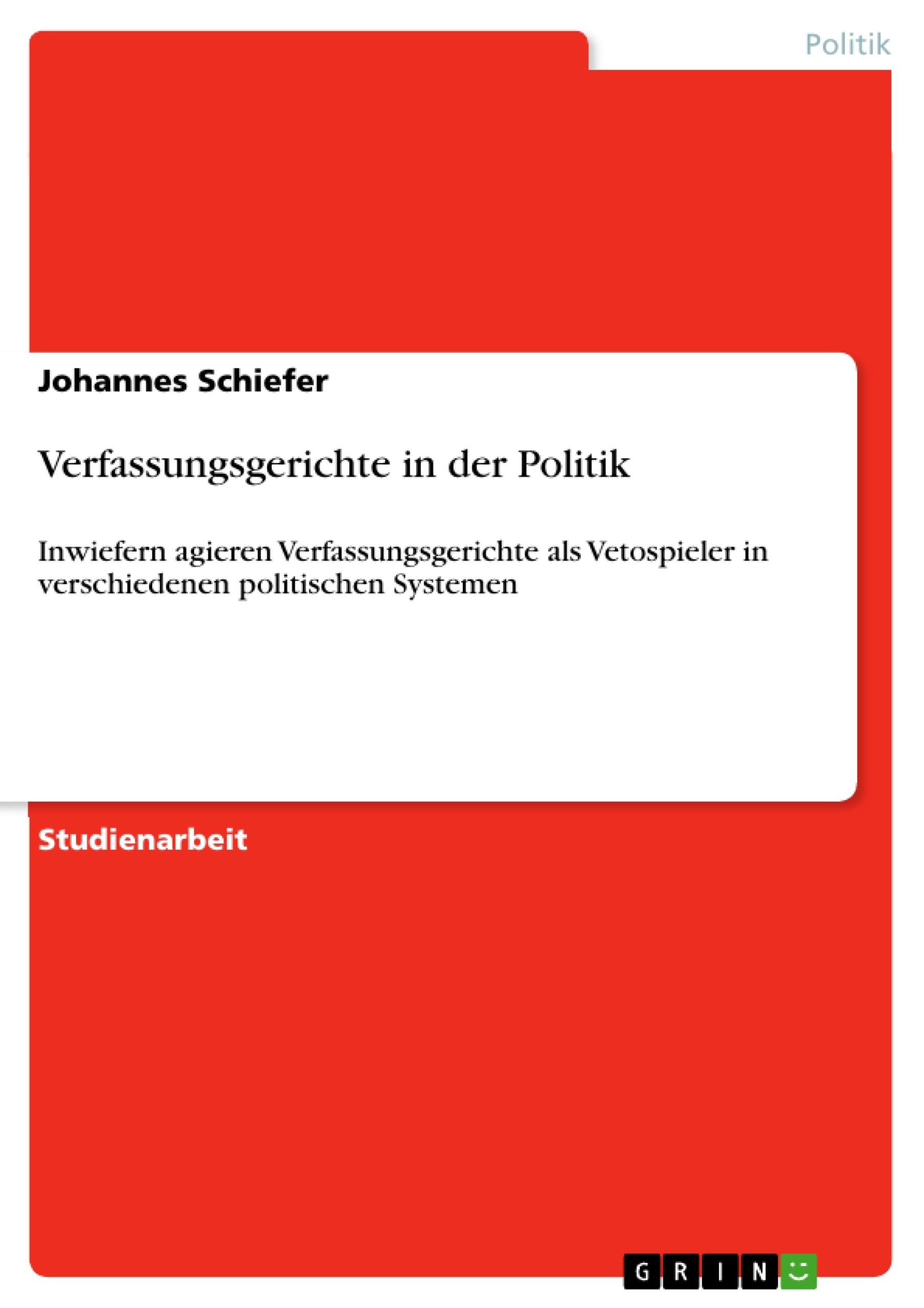In demokratischen Staaten gibt es bereits seit deren Gründung ein Gegengewicht zum Parlament. Da sich jedes Gesetz an die jeweilige Verfassung halten muss, müssen viele auf ihre Rechtmäßigkeit von Verfassungsgerichten überprüft werden.
Die Verfassungsgerichte stehen in der Gerichtsbarkeit der meisten demokratischen Staaten ganz oben. Ihre Urteile können nicht revidiert werden und sie können auch Gesetze außer Kraft treten lassen. Doch inwieweit die Normenkontrolle in Deutschland das Bundesverfassungsgericht befähigt Politik zu betreiben, will ich hier genauer erläutern.
Neben der Normenkontrolle gibt es auch noch andere Möglichkeiten inwieweit sich die, durch die Gewaltenteilungslehre Montesquieus getrennte, Legislative und die Judikative nicht nur kontrollieren, sondern auch in die Kompetenzen der anderen Staatsgewalt eingreifen. Inwiefern agieren Verfassungsgerichte als Vetomacht? Und greift auch die Politik in das Tagesgeschäft der Verfassungsgerichte ein?
Über einen Teil dieser Fragen will ich einen kleinen Überblick schaffen und versuchen Klarheit in diese Verstrickungen zu bringen. In den meisten Bereichen dieser Arbeit wird der Schwerpunkt auf das Bundesverfassungsgericht gelegt, da es oft exemplarisch für andere Gerichte stehen kann und zentraler Bestandteil dieser Arbeit sein soll.
Desweitern will ich eine Übersicht über die Handlungsanreize geben, welche Richter bei ihren Entscheidungen haben beziehungsweise nicht haben.
Einen genauerer Blick an die Grenzen der Gesetze und was darüber hinausgeht soll Abschnitt 4. verschaffen.
In welcher Spannung die Parteien, ob als Regierungs- oder als Oppositionspartei, mit dem Bundesverfassungsgericht stehen und inwieweit diese beiden Akteure sich gegenseitig beeinflussen und/oder beschränken, werden im nächsten Abschnitt, Teil 5, aufgezeigt.
Der sechste Teil zieht den Vergleich der beiden Verfassungsgerichtsmodelle in den USA und in Deutschland. Es soll beleuchtet werden, worum es sich bei einem „diffusen“ und bei einem „konzentrierten“ Verfassungsgerichtsmodell nach Schlaich/Korioth handelt.
Im letzten Abschnitt, will ich zeigen, dass es in Europa im Richterwahlverfahren erhebliche Unterschiede gibt, da dieses eine erhebliche Rolle für die Politik spielt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsklärung
- 2.1 Verfassungsgericht
- 2.2 Vetospieler
- 3. Aufgaben des Bundesverfassungsgericht
- 3.1 konkrete Normenkontrolle
- 3.2 abstrakte Normenkontrolle
- 4. Handlungsmotive von Richtern
- 4.1 legale Handlungsmotive
- 4.2 extralegale Handlungsmotive
- 5. Spannungsdreieck Regierung, Opposition und Verfassungsgericht
- 6. Vergleich der verfassungsgerichtlichen Modelle der USA und der BRD
- 7. Richterwahlverfahren der europäischen Verfassungsgerichte
- 8. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit Verfassungsgerichte als Vetospieler in verschiedenen politischen Systemen agieren. Sie untersucht die Rolle des Bundesverfassungsgerichts im deutschen politischen System, insbesondere im Kontext der Normenkontrolle. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Interaktion zwischen Verfassungsgericht, Regierung und Opposition zu gewinnen und die Grenzen der Gesetzgebung im Verhältnis zur Judikative zu beleuchten.
- Die Rolle des Bundesverfassungsgerichts in der deutschen Politik
- Die Unterscheidung zwischen „konzentrierten“ und „diffusen“ Verfassungsgerichtsmodellen
- Die Handlungsmotive von Richtern
- Das Spannungsverhältnis zwischen Regierung, Opposition und Verfassungsgericht
- Die Bedeutung des Richterwahlverfahrens für die politische Einflussnahme
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in das Thema der Verfassungsgerichte als Vetospieler ein und stellt die Bedeutung der Normenkontrolle für das politische System heraus. Abschnitt 2 klärt die Begriffe „Verfassungsgericht“ und „Vetospieler“ und erläutert die Unterschiede zwischen dem Supreme Court Modell und dem österreichisch-deutschen Modell. Abschnitt 3 gibt einen Überblick über die Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland, insbesondere über die konkrete und abstrakte Normenkontrolle. Abschnitt 4 diskutiert die Handlungsmotive von Richtern, sowohl legale als auch extralegale Motive. Abschnitt 5 beleuchtet das Spannungsdreieck zwischen Regierung, Opposition und Verfassungsgericht.
Abschnitte 6 und 7 befassen sich mit dem Vergleich der Verfassungsgerichtsmodelle in den USA und der BRD und dem Richterwahlverfahren in europäischen Verfassungsgerichten.
Schlüsselwörter (Keywords)
Verfassungsgericht, Vetospieler, Normenkontrolle, Bundesverfassungsgericht, Supreme Court Modell, österreichisch-deutsches Modell, Handlungsmotive, Richterwahlverfahren, politische Systeme, Gewaltenteilung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielen Verfassungsgerichte in der Politik?
Verfassungsgerichte fungieren als Gegengewicht zum Parlament, indem sie Gesetze auf ihre Rechtmäßigkeit prüfen und gegebenenfalls außer Kraft setzen.
Was ist der Unterschied zwischen konkreter und abstrakter Normenkontrolle?
Die Arbeit erläutert diese Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts als zentrale Instrumente zur Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen.
Inwiefern agieren Verfassungsgerichte als Vetomacht?
Sie können politische Entscheidungen blockieren, wenn diese gegen die Verfassung verstoßen, und greifen somit aktiv in das politische Geschehen ein.
Was unterscheidet das US-Verfassungsmodell vom deutschen Modell?
Die Arbeit vergleicht das „diffuse“ Modell der USA mit dem „konzentrierten“ Verfassungsgerichtsmodell Deutschlands nach Schlaich/Korioth.
Welche Handlungsmotive haben Verfassungsrichter?
Es wird zwischen legalen Motiven (Gesetzestexte) und extralegalen Motiven (persönliche oder politische Überzeugungen) unterschieden.
- Quote paper
- Johannes Schiefer (Author), 2008, Verfassungsgerichte in der Politik , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167866