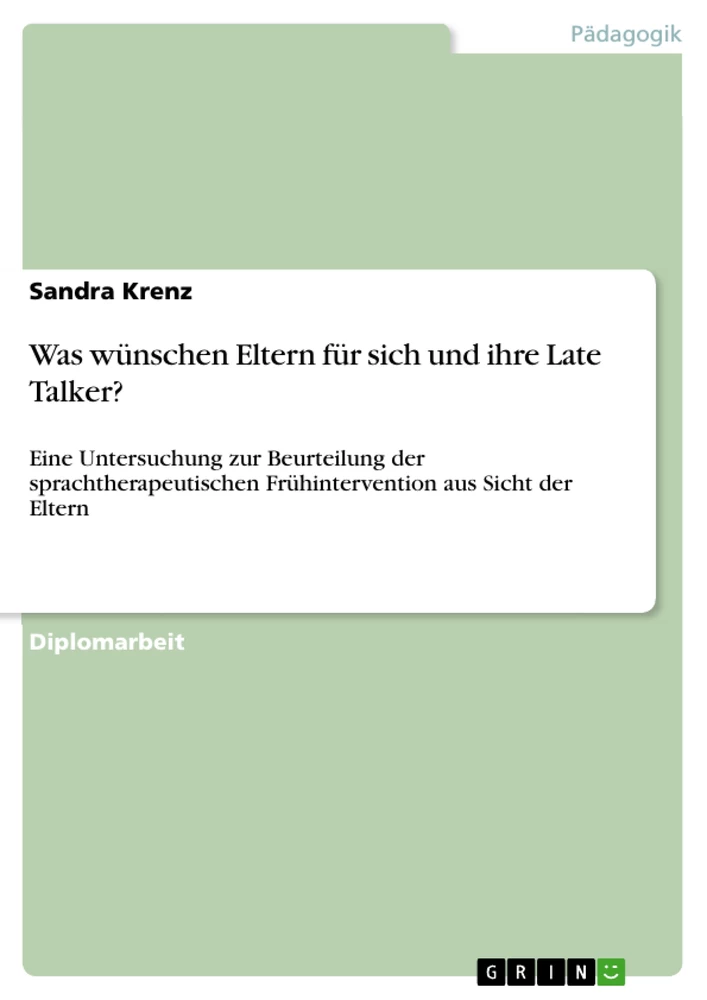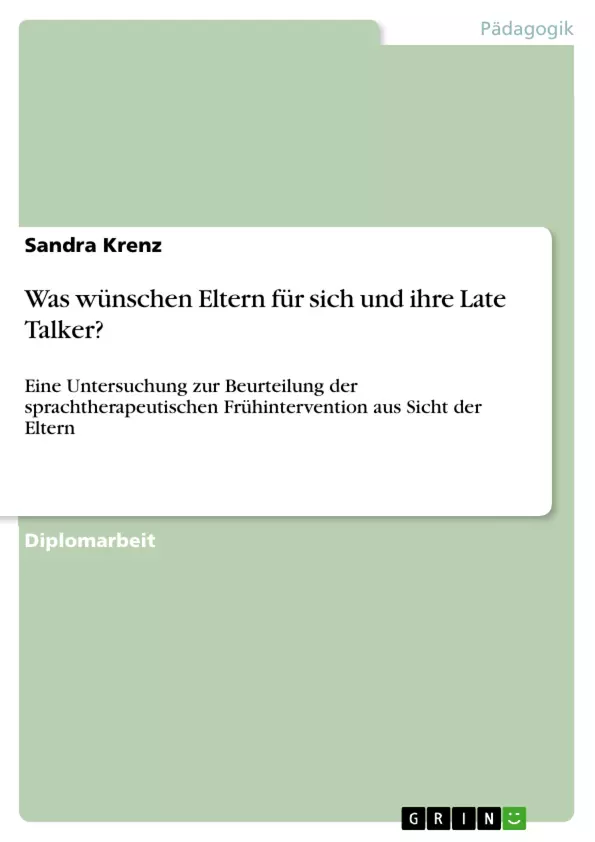Die Erziehung der Kinder zur maximalen Selbstständigkeit, Identitätsbildung, Sozialkompetenz und Leistungsfähigkeit sind Ziele der heutigen Gesellschaftsform. Eltern von Kindern mit Spracherwerbsstörungen sind doppelt belastet. Sie wollen zum einen den gesellschaftlichen Rollenerwartungen bezüglich der Kindererziehung entsprechen und zum anderen sind Sorgen aufgrund der spät einsetzenden Sprache und der Zukunft ihres Kindes allgegenwärtig. Die Eltern befinden sich in einem Dilemma. Einerseits wird ihnen mit den Worten „das wächst sich aus“ zum Abwarten geraten. Andererseits nehmen Eltern intuitiv Auffälligkeiten wahr und hören aus dem Verwandten- oder Bekanntenkreis: „Spricht Dein Kind immer noch nicht?“
Die Berücksichtigung der Bedürfnisse von Eltern sprachauffälliger Kinder und die Zufriedenheit der Eltern mit der Betreuung ihrer Kinder ist ein wichtiges Qualitätskriterium jeder sprachtherapeutischen Intervention. Im Bereich der sprachtherapeutischen Frühintervention bei zweijährigen Late Talkern gibt es bislang nur wenige empirische Untersuchungen, die die Bedürfnisse der Eltern und Elternpartizipation evaluieren. Die Studie soll diese Forschungslücke kleiner werden lassen, indem die Sichtweisen der Eltern betrachtet werden, deren zwei- bis dreijährige spät sprechende Kinder am Late Talker-Forschungsprojekt der Technischen Universität Dortmund über die Dauer von einem Jahr teilnahmen.
Inhaltsverzeichnis
- Teil I: Einleitung
- 1 Einführung in die Thematik
- 2 Wissenschaftliche Einbettung sowie Inhalt und Schwerpunkt der Arbeit
- 2.1 Entwicklung der eigenen Forschungsfragen und ihre Relevanz
- 2.2 Darstellung der Arbeitshypothesen
- 3 Weiterer Aufbau der Arbeit
- Teil II: Theoretische Grundlagen
- 1 Ungestörter und gestörter Spracherwerb bei kleinen Kindern im Vergleich
- 1.1 Grundlegende Fähigkeiten für den ungestörten Spracherwerb
- 1.2 Früher ungestörter Spracherwerb
- 1.3 Früher gestörter Spracherwerb
- 1.3.1 Das Late-Talker-Phänomen – Definition, Symptomatik, Prävalenz, Diagnostik
- 1.3.2 Die Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES): Eine mögliche Prognose für Late Talker - Definition, Symptomatik, Prävalenz, Auswirkung
- 1.3.3 Ätiologische Faktoren für das Late-Talker-Phänomen bzw. für eine SSES
- 1.4 Notwendigkeit einer Sprachtherapie bei Late Talkern
- 1.5 Fazit und Relevanz für diese Arbeit
- 2 Die Elternperspektive von Late Talkern
- 2.1 Elterliches Belastungserleben von Late Talkern
- 2.2 Auswirkungen des Belastungserlebens auf die Eltern-Kind-Interaktion
- 2.2.1 Exkurs: Ungestörte Eltern-Kind-Interaktion bei kleinen Kindern
- 2.2.2 Die entwicklungshemmende eskalierende Spirale in der Eltern-Kind-Interaktion bei Eltern und ihrem Late Talker
- 2.3 Resiliente Eltern von Late Talkern
- 2.4 Fazit und Relevanz für diese Arbeit
- 3 Elternarbeit in der frühen Sprachtherapie
- 3.1 Elternberatung bzw. Elternarbeit – Begriffs- und Zielbestimmung
- 3.2 Grundsätze, Prinzipien sowie Modelle der Elternarbeit
- 3.3 Notwendigkeit der Beratung und Arbeit mit Eltern
- 3.4 Übersicht über aktuelle Programme für Eltern von Late Talkern
- 3.5 Fazit und Relevanz für diese Arbeit
- 4 Qualitätsorientierung und Evaluation sprachtherapeutischer Arbeit mit kleinen Kindern
- 4.1 Qualitätsorientierung in der sprachtherapeutischen Arbeit
- 4.1.1 Qualitätsbegriff im Gesundheitswesen und explizit in der Sprachtherapie
- 4.1.2 Qualitätsmanagement in der Sprachtherapie und Sprachtherapieforschung
- 4.1.3 Qualitätsebenen am Beispiel der Sprachtherapie mit kleinen Kindern
- 4.2 Evaluationsforschung in der Kindersprachtherapie
- 4.3 Evaluation sprachtherapeutischer Intervention aus Elternsicht
- 4.3.1 Beurteilung der sprachtherapeutischen Frühintervention aus Elternsicht (k)ein Qualitätskriterium?
- 4.3.2 Evaluationsstudien (sprach-)therapeutischer Interventionsprogramme aus Elternsicht
- 4.4 Fazit und Relevanz für diese Arbeit
- 5 Das Late-Talker-Forschungsprojekt
- 5.1 Ziel und Hypothesen sowie deren wissenschaftliche Einbettung
- 5.2 Zur Durchführung des Forschungsprojektes
- 5.2.1 Forschungsdesign
- 5.2.2 Diagnostiken und frühe Sprachtherapie
- 5.2.3 Elternarbeit
- 5.3 Einbettung der Untersuchung sowie Relevanz
- Teil III: Methodik der eigenen empirischen Untersuchung
- Teil IV: Ergebnisse der eigenen empirischen Untersuchung
- Teil V: Interpretation zentraler Ergebnisse
- Teil VI: Diskussion
- Teil VII: Konsequenzen und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Perspektiven von Eltern von Kindern mit Late-Talker-Phänomen auf die sprachtherapeutische Frühintervention. Ziel ist es, die Sorgen und Erwartungen der Eltern zu verstehen und die Qualität der Intervention aus deren Sicht zu evaluieren. Die Ergebnisse sollen zur Verbesserung der Elternarbeit und des Therapiekonzepts beitragen.
- Elterliches Belastungserleben im Kontext des Late-Talker-Phänomens
- Qualität der sprachtherapeutischen Frühintervention aus Elternsicht
- Wirkung der Elternarbeit auf den Therapieerfolg
- Entwicklung von Verbesserungsvorschlägen für die sprachtherapeutische Praxis
- Relevanz der Elternperspektive für die Gestaltung zukünftiger Interventionen
Zusammenfassung der Kapitel
Teil I: Einleitung: Dieser Teil führt in die Thematik des Late-Talker-Phänomens ein, beschreibt den wissenschaftlichen Hintergrund und die Forschungsfragen der Arbeit. Es werden die Hypothesen vorgestellt und der Aufbau der Arbeit erläutert. Der Fokus liegt auf der Relevanz der Thematik und der Begründung der gewählten Forschungsmethodik.
Teil II: Theoretische Grundlagen: Dieser Abschnitt behandelt den ungestörten und gestörten Spracherwerb bei Kleinkindern. Es wird detailliert auf das Late-Talker-Phänomen eingegangen, inklusive Definition, Symptomatik, Prävalenz und Diagnostik. Die Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) wird als mögliche Prognose für Late Talker diskutiert. Weiterhin wird die Bedeutung der Elternperspektive und die Rolle der Elternarbeit in der frühen Sprachtherapie beleuchtet.
Teil III: Methodik der eigenen empirischen Untersuchung: In diesem Teil wird die gewählte Forschungsmethode, die schriftliche Befragung mittels Fragebogen, detailliert beschrieben und begründet. Es werden die Operationalisierung der verwendeten Begriffe, die Auswertungsmethoden und der Aufbau des Elternfragebogens (ELBO-FI) erläutert. Die Durchführung der Befragung und die Optimierung der Rücklaufquote werden ebenfalls thematisiert.
Schlüsselwörter
Late-Talker-Phänomen, Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES), Elternperspektive, Sprachtherapeutische Frühintervention, Elternarbeit, qualitative Forschung, Fragebogen, Elternbefragung, Qualitätsorientierung, Evaluationsforschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Perspektiven von Eltern von Kindern mit Late-Talker-Phänomen auf die sprachtherapeutische Frühintervention
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Perspektiven von Eltern von Kindern mit Late-Talker-Phänomen auf die sprachtherapeutische Frühintervention. Das Ziel ist es, die Sorgen und Erwartungen der Eltern zu verstehen und die Qualität der Intervention aus deren Sicht zu evaluieren, um Verbesserungsvorschläge für die Praxis abzuleiten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem elterlichen Belastungserleben im Kontext des Late-Talker-Phänomens, der Qualität der sprachtherapeutischen Frühintervention aus Elternsicht, der Wirkung der Elternarbeit auf den Therapieerfolg, sowie der Entwicklung von Verbesserungsvorschlägen für die sprachtherapeutische Praxis und der Relevanz der Elternperspektive für zukünftige Interventionen.
Welche theoretischen Grundlagen werden berücksichtigt?
Die Arbeit betrachtet den ungestörten und gestörten Spracherwerb bei Kleinkindern, das Late-Talker-Phänomen (Definition, Symptomatik, Prävalenz, Diagnostik), die Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) als mögliche Prognose, die Bedeutung der Elternperspektive und die Rolle der Elternarbeit in der frühen Sprachtherapie, sowie Qualitätsorientierung und Evaluationsforschung in der Kindersprachtherapie.
Welche Methode wurde für die empirische Untersuchung verwendet?
Die empirische Untersuchung basiert auf einer schriftlichen Befragung der Eltern mittels eines Fragebogens (ELBO-FI). Die Arbeit beschreibt detailliert die Methodik, die Operationalisierung der Begriffe, die Auswertungsmethoden und den Aufbau des Fragebogens. Die Durchführung der Befragung und die Optimierung der Rücklaufquote werden ebenfalls thematisiert.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung, die aus der Elternbefragung gewonnen wurden. Diese Ergebnisse werden im Detail analysiert und interpretiert.
Welche Schlussfolgerungen und Konsequenzen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen aus den gewonnenen Ergebnissen und diskutiert die Konsequenzen für die sprachtherapeutische Praxis. Ein Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen und -ansätze rundet die Arbeit ab.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Late-Talker-Phänomen, Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES), Elternperspektive, Sprachtherapeutische Frühintervention, Elternarbeit, qualitative Forschung, Fragebogen, Elternbefragung, Qualitätsorientierung, Evaluationsforschung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Teile gegliedert: Einleitung, Theoretische Grundlagen, Methodik der empirischen Untersuchung, Ergebnisse der empirischen Untersuchung, Interpretation zentraler Ergebnisse, Diskussion und Konsequenzen und Ausblick. Der detaillierte Aufbau ist im Inhaltsverzeichnis ersichtlich (siehe oben im HTML-Code).
- Arbeit zitieren
- Sandra Krenz (Autor:in), 2008, Was wünschen Eltern für sich und ihre Late Talker?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167872