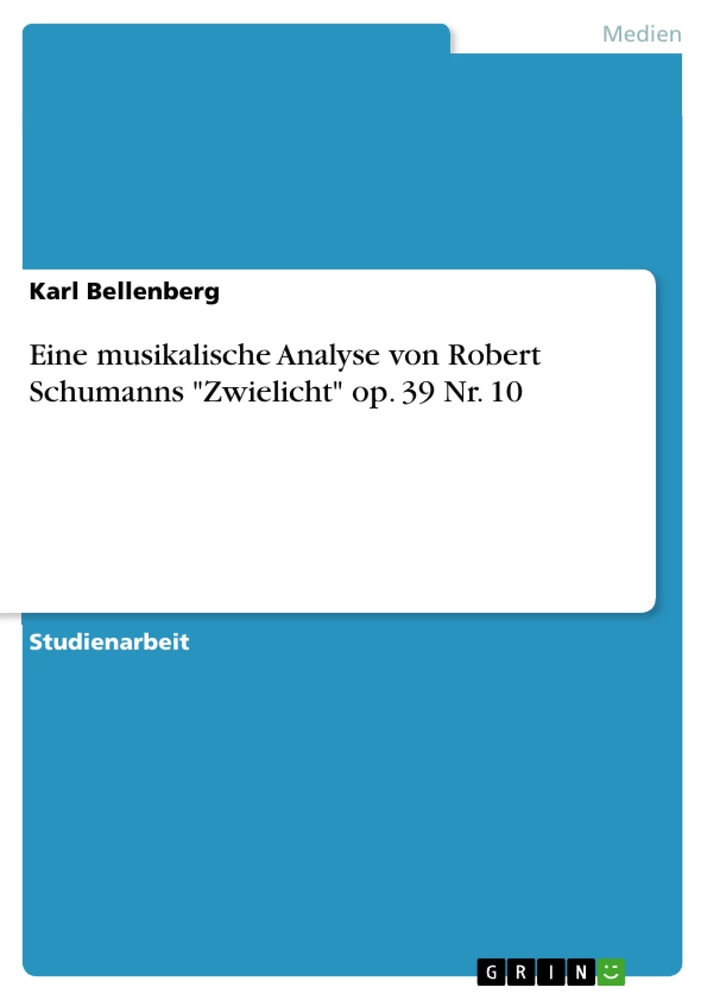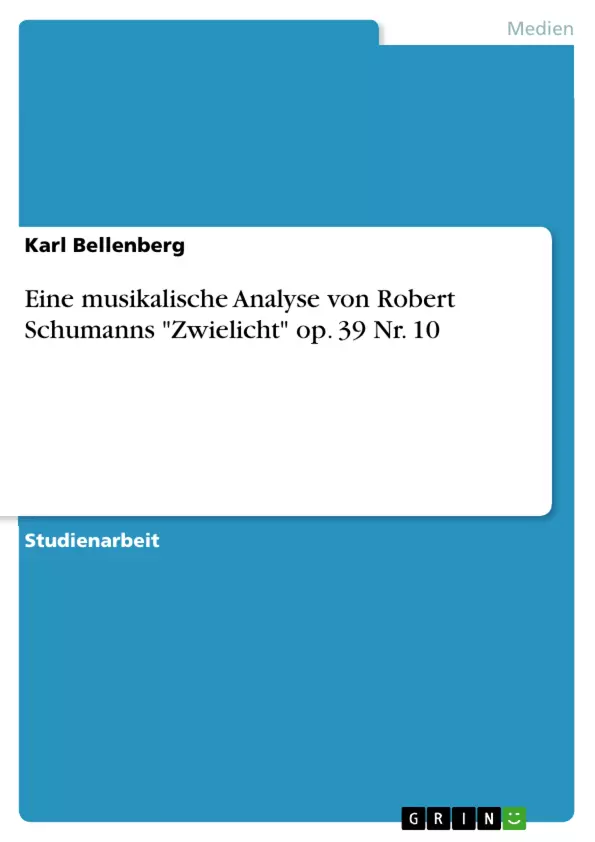Das Lied "Zwielicht" gehört dem Eichendorff-Liederkreis op. 39 von Robert Schumann an, den dieser in seinem produktionsreichsten, sogenannten »Liederjahr« 1840 komponierte. Der Eichendorff-Text erfährt durch mehrfach geänderte Verortung auch semantische Veränderungen. Es werden in der vorliegenden Arbeit u.a. Querbezüge zu anderen Eichendorff Gedichten wie auch zur Biographie Schumanns hergestellt. Die Liedvertonung wird einer eingehenden Analyse des literarischen und musikalischen Textes unterzogen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Entstehung des Gedichts und der Komposition
- 2. Der Eichendorff-Text
- 2.1 Textuelles Umfeld 1: Der Roman Ahnung und Gegenwart
- 2.2 Textuelles Umfeld 2: Der Eichendorff-Liederkreis op. 39
- 2.3 Das Gedicht Zwielicht, literarische Analyse
- 2.3.1 Form, Metrum und Rhythmus
- 2.3.2 Der Begriff Zwielicht
- 2.3.3 Onomatopoesie
- 2.3.4 Bildlichkeit und Wahn
- 2.3.5 Wirklichkeitsbezug und Fiktionalität
- 2.4 Bezüge zur Biographie Schumanns
- 3. Das Lied Zwielicht op. 39 Nr. 10
- 3.1 Einbettung im Liederzyklus op. 39
- 3.1.1 Anordnungen
- 3.1.2 Tonarten
- 3.2 Die musikalische Analyse
- 3.2.1 Die Gesamtstruktur
- 3.2.2 Die Einleitung
- 3.2.3 Die Gesangsstimme
- 3.2.4 Das >> geliebte Reh«, eine »glatte«< Strophe?
- 3.2.5 Der >>falsche Freund« und »wer bin ich?«<
- 3.2.6 Die Schlussstrophe: Hüte dich, kommst nimmermehr aus diesem Wald!
- Eichendorffs lyrisches Werk und seine Rezeption
- Die Bedeutung des Gedichts "Zwielicht" im Kontext des Romans "Ahnung und Gegenwart"
- Die musikalische Gestaltung des Liedes durch Schumann
- Die Beziehung zwischen Text und Musik im Liederkreis op. 39
- Die Rolle der romantischen Erfahrung der Fremde in Schumanns Komposition
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit analysiert Robert Schumanns Vertonung von Joseph von Eichendorffs Gedicht "Zwielicht" aus dem Liederkreis op. 39. Der Fokus liegt auf der Entstehung des Gedichts und der Komposition sowie auf der musikalischen Analyse. Ziel ist es, die spezifischen Merkmale der Komposition im Kontext des Liederzyklus und der Biographie Schumanns zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel beleuchtet die Entstehung des Gedichts "Zwielicht" und der zugehörigen Komposition von Schumann. Es wird auf die Entstehung des Gedichts im Kontext von Eichendorffs Werk eingegangen und die Besonderheiten seiner Einbettung in den Roman "Ahnung und Gegenwart" hervorgehoben. Darüber hinaus wird die Entstehung des Liederkreises op. 39 in Schumanns Biographie beleuchtet.
Das zweite Kapitel widmet sich der Analyse des Eichendorff-Textes. Es werden die literarischen Merkmale des Gedichts, wie Form, Metrum, Rhythmus und Bildsprache, untersucht. Besondere Aufmerksamkeit wird auf die Bedeutung des Begriffs "Zwielicht" und die Relevanz des Motivs der Fremde im Gedicht gelegt.
Im dritten Kapitel wird die musikalische Analyse von Schumanns "Zwielicht" vorgestellt. Die Komposition wird im Kontext des Liederzyklus op. 39 betrachtet, wobei insbesondere die musikalische Gestaltung der einzelnen Strophen und die Beziehung zwischen Text und Musik im Vordergrund stehen. Die Analyse beleuchtet die spezifischen musikalischen Mittel, die Schumann einsetzt, um die emotionale Stimmung des Gedichts zu transportieren.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie die romantische Erfahrung der Fremde, die Analyse des Gedichts "Zwielicht" von Joseph von Eichendorff, die musikalische Gestaltung des Liedes von Robert Schumann, die Beziehung zwischen Text und Musik im Liederkreis op. 39, die Bedeutung von Tonarten und die musikalische Gestaltung der einzelnen Strophen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an Schumanns Lied "Zwielicht"?
Es ist Teil des Eichendorff-Liederkreises op. 39 und zeichnet sich durch eine düstere, geheimnisvolle Stimmung aus, die die romantische Erfahrung der Fremde und des Misstrauens thematisiert.
Aus welchem literarischen Kontext stammt der Text von Eichendorff?
Das Gedicht "Zwielicht" ist ursprünglich in Eichendorffs Roman "Ahnung und Gegenwart" eingebettet.
Was symbolisiert der Begriff "Zwielicht" im Lied?
Er steht für einen Zustand der Ungewissheit, der Gefahr und des drohenden Wahns, in dem Freund und Feind nicht mehr unterscheidbar sind.
Wie setzt Schumann den Text musikalisch um?
Schumann nutzt komplexe Harmonik und eine subtile Klavierbegleitung, um die unheilvolle Atmosphäre und die psychologische Tiefe des Gedichts einzufangen.
In welchem Jahr komponierte Schumann dieses Werk?
Es entstand 1840, dem sogenannten „Liederjahr“ Robert Schumanns, in dem er eine enorme Anzahl an Vokalwerken schuf.
- Citar trabajo
- Dipl. Ing. Karl Bellenberg (Autor), 2010, Eine musikalische Analyse von Robert Schumanns "Zwielicht" op. 39 Nr. 10, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167896