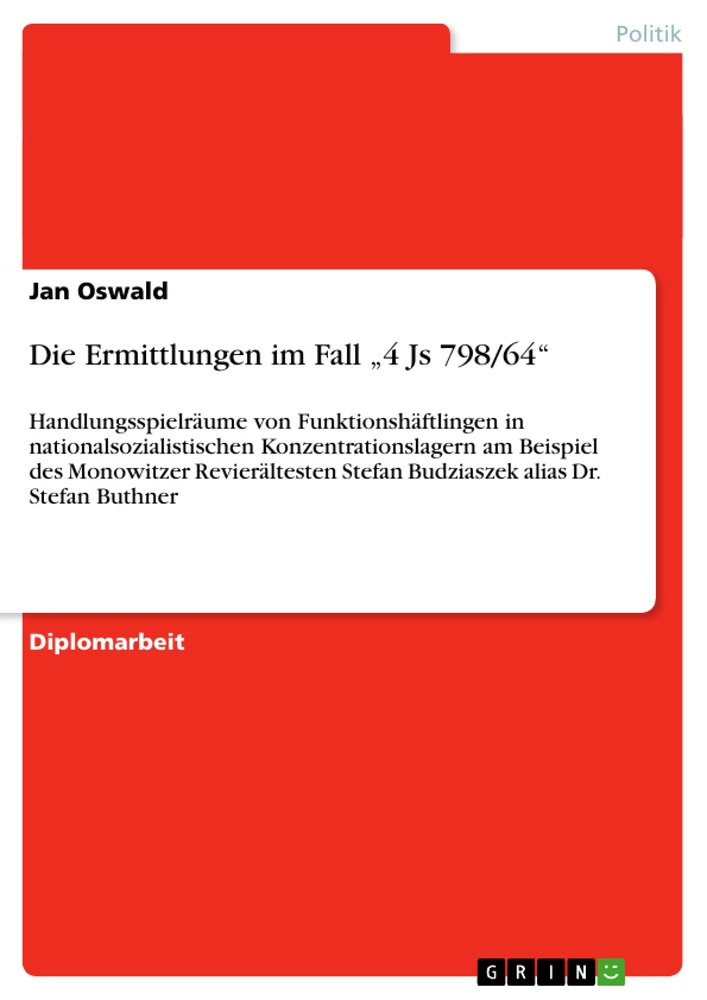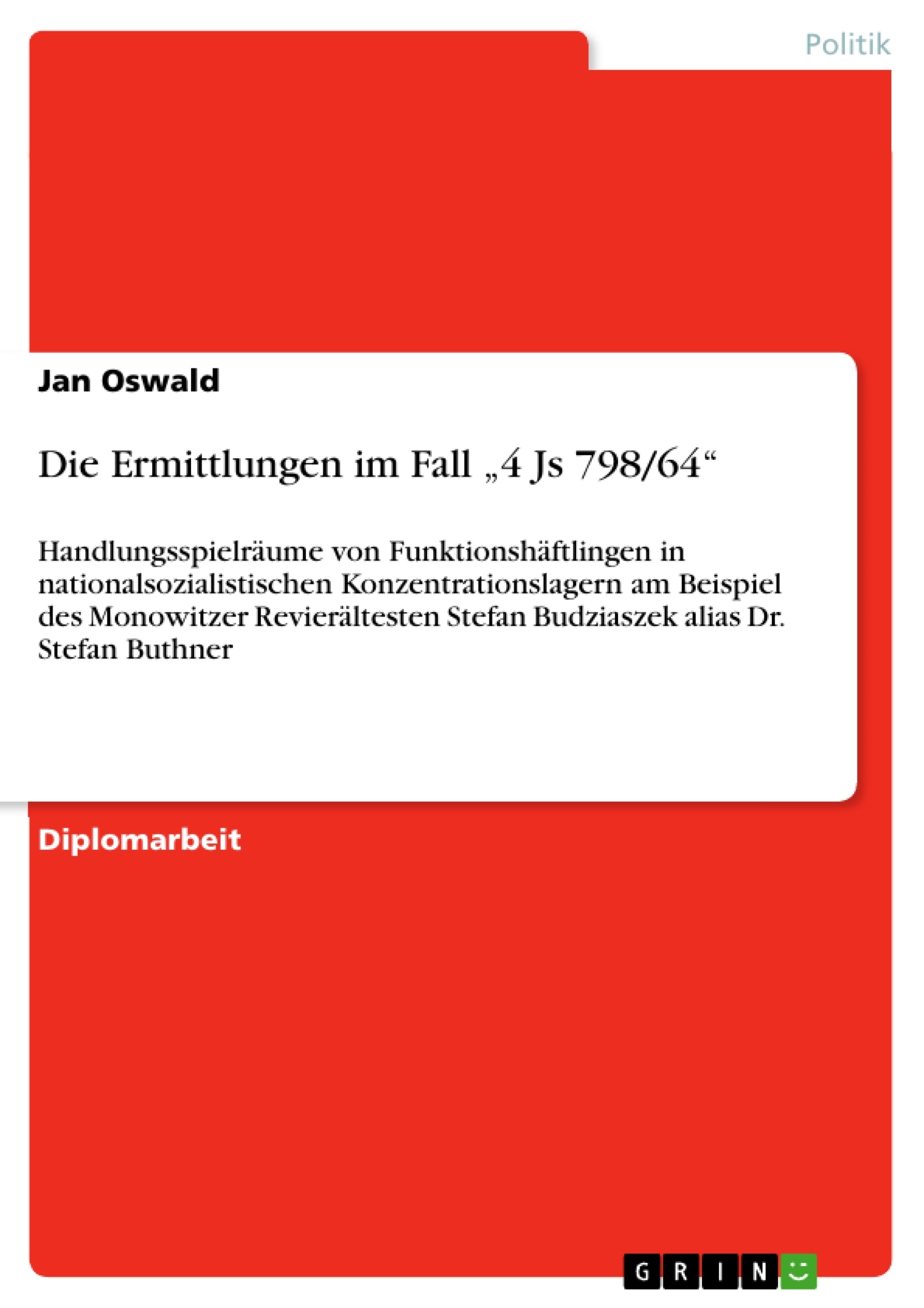Allein der Titel dieser Arbeit mag den einen oder anderen Leser unruhig stimmen, da der Begriff der Handlungsspielräume im Bereich der neueren Täterforschung erst seine Konjunktur erlebt hat und damit vermeintlich die Funktionshäftlinge2 in die Nähe der Täter im Nationalsozialismus rückt. In der Tat verweist der Begriff des Handlungsspielraumes auf das Subjekt und seine Möglichkeiten, innerhalb eines sozialen Raumes zu agieren. Bezogen auf NS-Täter, Mitwisser und –läufer, Schreibtischtäter und so weiter rekurriert der Begriff, auf das Potential „Was wäre möglich gewesen, wenn sich eine Person anders verhalten hätte.“
Gleichzeitig dient er aber auch als Folie, vor dem die zahlreiche Mittäterschaft breiter Bevölkerungsschichten gespiegelt wird, die Schuld nicht mehr nur auf die zwangspathologisierten Eliten des NS-Systems transferiert, sondern die Mitschuld großer Teile der Bevölkerung geschärft wird.3 Im Zusammenhang der neueren Täterforschung hat sich auch unser Wissen über die nationalsozialistischen Konzentrationslager in den vergangenen 15 bis 20 Jahren systematisch erweitert, eine ganze Reihe von Publikationen geben Aufschluss über Planung4, Errichtung, Funktionsweise und Zweck von Konzentrationslagern im Herrschaftsgefüge der Nationalsozialisten.5 Auch die KZ-Gedenkstätten publizieren auf lokaler Ebene, so dass zumindest die deutschen Gedenkstätten nicht nur Eingang in die Forschungslandschaft finden, sonder diese auch zum großen Teil prägen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Forschungsstand
- Strukturen und Definitionen im Konzentrationslager:
- Vom Aufbau des Systems der Funktionshäftlinge bis zur Einlieferung der Häftlinge und ihrer Kennzeichnung
- Zur Frage von Macht und Autonomie einzelner Funktionsstellen
- Von der Gruppenbildung zur Stereotypisierung
- Gruppenspezifische Handlungsformen zwischen Widerstand und „Opfertausch“?
- Anmerkungen zu NSG-Verfahren gegen ehemalige Funktionshäftlinge
- Zusammenfassung und Problemanalyse
- Das Ermittlungsverfahren 4 Js 798/64 gegen Dr. Stefan Buthner
- Dr. Stefan Budziaszek alias Dr. Stefan Buthner
- Vom Krakauer Medizinstudenten Stefan Budziaszek zum polnischen Widerstandskämpfer in Auschwitz-Monowitz?
- Aufbau einer neuen Existenz in Westdeutschland als Dr. Stefan Buthner
- Das Ermittlungsverfahren 4 Js 798/64 im Rahmen der Frankfurter Auschwitzprozesse
- Die Belastungszeugen
- Die Entlastungszeugen
- Ergebnis der Vorermittlungen
- Rekonstruktion der Selektionen in Monowitz anhand weiterer Aktenbestände
- Der zweite Frankfurter Auschwitz-Prozess und das Urteil gegen den SDG Neubert
- Jawischowitz
- Das Verhältnis Buthner - Fischer
- Fazit
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit den Handlungsspielräumen von Funktionshäftlingen in nationalsozialistischen Konzentrationslagern, anhand des Beispiels des Monowitzer Revierältesten Stefan Budziaszek alias Dr. Stefan Buthner. Sie untersucht, welche Möglichkeiten und Grenzen diese Häftlinge in ihrer besonderen Lage hatten und welche Entscheidungen sie im Angesicht von Gewalt und Terror treffen mussten.
- Analyse des Systems der Funktionshäftlinge in nationalsozialistischen Konzentrationslagern.
- Rekonstruktion des Lebenswegs von Stefan Budziaszek/Dr. Stefan Buthner und seiner Rolle in Auschwitz-Monowitz.
- Bewertung der Beweislage im Ermittlungsverfahren 4 Js 798/64 gegen Dr. Stefan Buthner.
- Untersuchung der Handlungsspielräume von Funktionshäftlingen vor dem Hintergrund von Gewalt, Terror und Überlebenskampf.
- Beurteilung der Rolle von Funktionshäftlingen in der Lagergesellschaft und ihre Auswirkungen auf die Häftlinge.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung führt in die Thematik der Handlungsspielräume von Funktionshäftlingen in nationalsozialistischen Konzentrationslagern ein und beleuchtet den aktuellen Forschungsstand.
Kapitel 2 befasst sich mit den Strukturen und Definitionen im Konzentrationslager. Es untersucht die Funktionsweise des Systems der Funktionshäftlinge, die Frage von Macht und Autonomie sowie die Gruppenspezifische Handlungsformen.
Kapitel 3 widmet sich dem Ermittlungsverfahren 4 Js 798/64 gegen Dr. Stefan Buthner, wobei der Lebensweg und die Rolle von Stefan Budziaszek/Dr. Stefan Buthner in Auschwitz-Monowitz beleuchtet werden.
Kapitel 4 rekonstruiert die Selektionen in Monowitz anhand weiterer Aktenbestände, analysiert den zweiten Frankfurter Auschwitz-Prozess und das Urteil gegen den SDG Neubert sowie das Verhältnis Buthner-Fischer.
Schlüsselwörter (Keywords)
Funktionshäftlinge, Konzentrationslager, Nationalsozialismus, Handlungsspielraum, Auschwitz-Monowitz, Stefan Budziaszek, Dr. Stefan Buthner, Ermittlungsverfahren 4 Js 798/64, Frankfurter Auschwitzprozesse, Selektionen, Täterforschung, Lagergesellschaft, Überlebenskampf, Widerstand.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Stefan Budziaszek alias Dr. Stefan Buthner?
Ein ehemaliger polnischer Widerstandskämpfer und Funktionshäftling (Revierältester) in Auschwitz-Monowitz, gegen den später in Westdeutschland ermittelt wurde.
Welche Rolle spielten Funktionshäftlinge im KZ-System?
Sie waren Häftlinge, denen die SS Aufsichtsaufgaben übertrug, was sie in ein moralisches Spannungsfeld zwischen Überlebenskampf und Mittäterschaft brachte.
Was wurde im Ermittlungsverfahren 4 Js 798/64 untersucht?
Es ging um die Beteiligung an Selektionen und die Machtausübung Buthners im Krankenbau von Auschwitz-Monowitz im Rahmen der Frankfurter Auschwitzprozesse.
Was bedeutet der Begriff „Handlungsspielraum“ in der Täterforschung?
Er hinterfragt, welche Möglichkeiten Einzelne hatten, sich innerhalb des Unterdrückungssystems anders zu verhalten oder Widerstand zu leisten.
Was war Auschwitz-Monowitz?
Ein großes Nebenlager von Auschwitz, auch bekannt als Buna-Lager, in dem Häftlinge Zwangsarbeit für die I.G. Farben leisten mussten.
- Quote paper
- Jan Oswald (Author), 2006, Die Ermittlungen im Fall „4 Js 798/64“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/167959