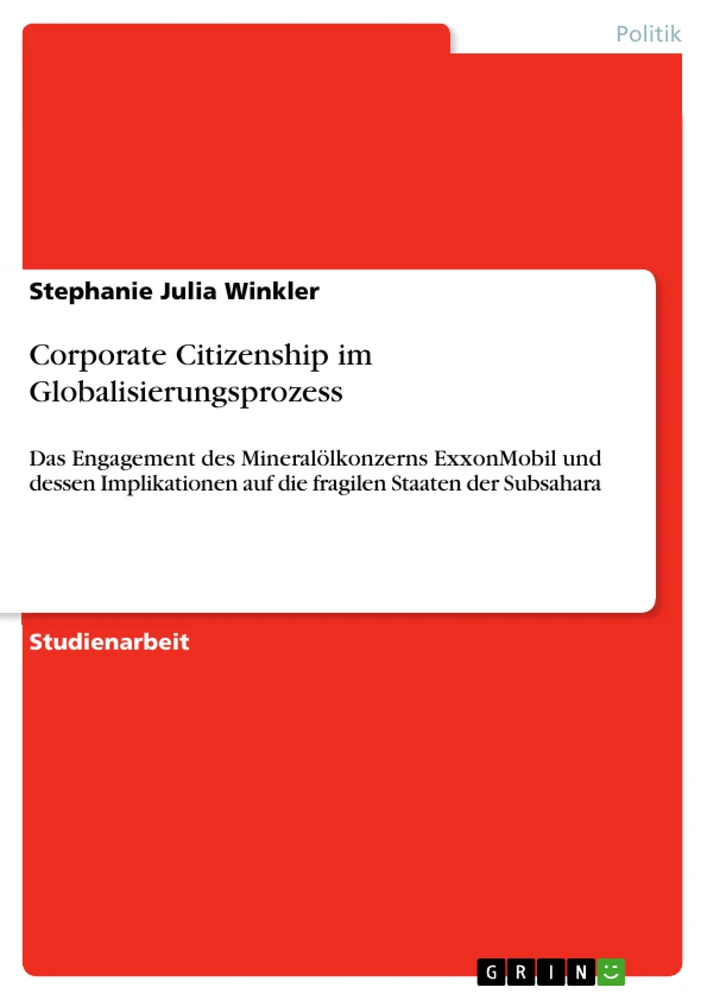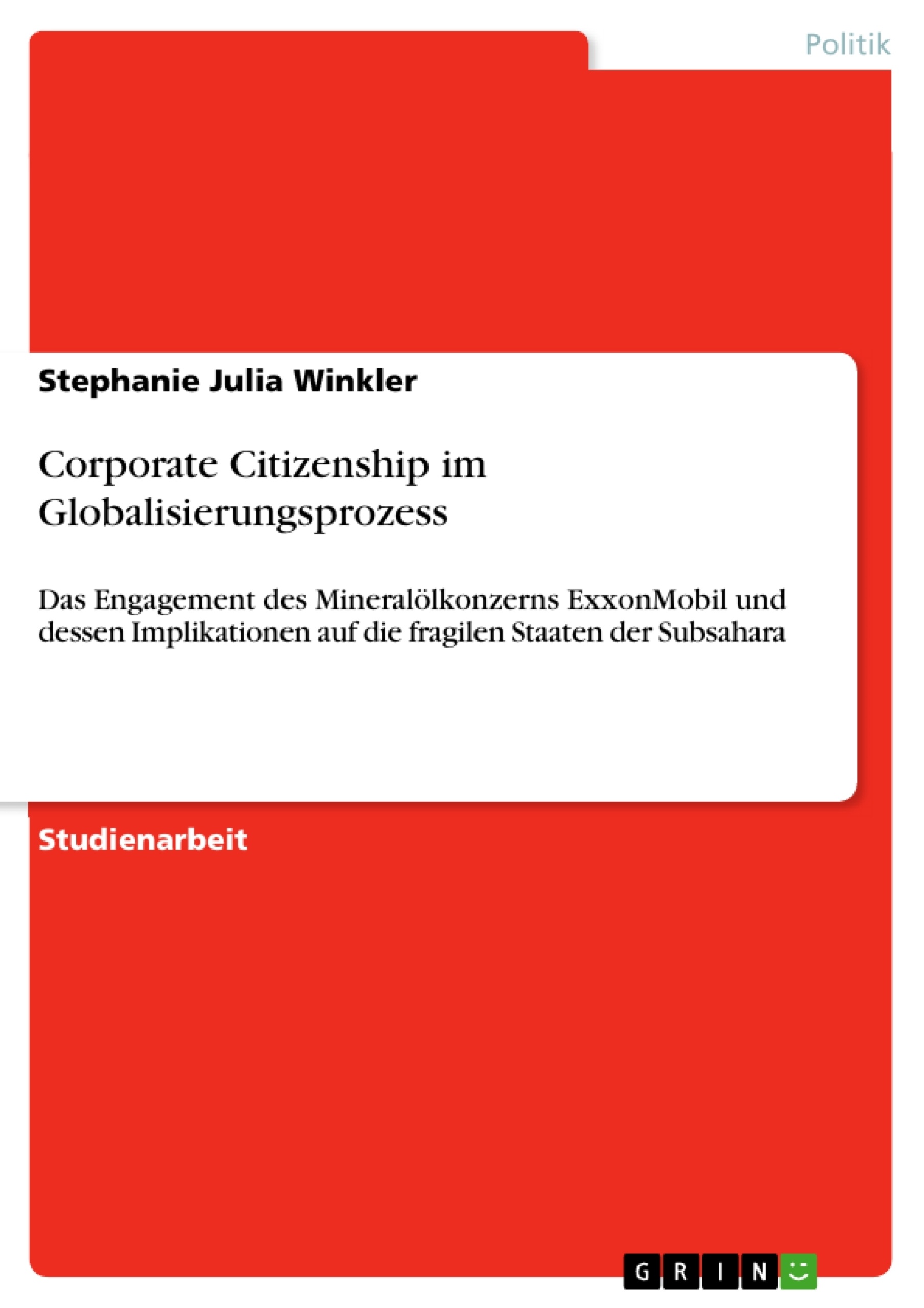,,Making Money by Doing Good‘‘ , diesen Trend haben große, multinational agierende Unternehmen wie Novartis, General Motors oder auch ExxonMobil längst erkannt, und legen folglich hohen Wert darauf, sich extern als vorbildliche Corporate Citizen zu kommunizieren. Unter der Devise des Corporate Citizenship (CC), also des bürgerschaftlichen Engagements von Unternehmen für die Gesellschaft, werden soziale Aktivitäten längst nicht mehr als lästige Pflicht betrachtet, sondern als durchaus ökonomisch sinnvolle Investitionen, die positiven Einfluss auf die Wertschöpfung und Marktkapitalisierung des Unternehmens nach sich ziehen.Aktienindizes, wie der Dow Jones Sustainability Index oder der FTSE4Good, bieten mittlerweile Transparenz und umfassende Vergleichsmöglichkeiten für die Nachhaltigkeit des Engagements von Unternehmen. Profit werfen unternehmerische Aktivitäten vor allem deshalb ab, weil moralisches Integrität und soziales Engagement auf den globalen Märkten sowohl von Shareholdern, als auch von Konsumenten und Stakeholdern honoriert werden.Durch die Inkorporierung gesellschaftlicher Akteure schwindet aber auch das Machtpotential und die Steuerungsfähigkeit des korporatistischen Staates. Multinationalen Unternehmen haben somit, im Rahmen der zunehmenden Expansion des Corporate Citizenship Engagements auf Entwicklungs- und Schwellenländer, einen Einfluss auf die Mitgestaltung ordnungspolitischer und staatlicher Rahmenbedingungen, obwohl sie dafür keinerlei demokratische Legitimation besitzen. Eine völlig neue Problemdimension des Global Governance ergibt sich, wenn Unternehmen wie der Ölmultikonzern ExxonMobil in fragilen, erdölreichen Staaten der Subsahara zunehmend staatliche Aufgaben übernehmen und somit dem Rückzug des Staates aus originären sozial- und gesundheitspolitischen Sektoren subsidiarisch assistieren.
Doch was genau versteht man unter Doch was genau versteht man unter
Corporate Citizenship im Zeitalter der Globalisierung?Welche Chancen und Risiken birgt dieses globale Engagement? Welche Auswirkungen hat unternehmerisches Wohlfahrtsengagement im Kontext der fragilen Staatsgebilde der erdölreichen Subsahara Staaten, und wie ist dies zu bewerten? Diese und andere Fragen rund um das Thema Corporate Citizenship sollen im Verlauf dieser Hausarbeit untersucht und exemplarisch am Engagement des Konzerns ExxonMobil in Subsahara-Afrika dargelegt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Corporate Citizenship Konzept
- 2.1 Definitorische Annäherung an den Begriff des Corporate Citizenship und Abgrenzung zum Terminus,,Corporate Social Responsibility"
- 2.2 Eigentum verpflichtet: Unternehmen als Bürger in der Gesellschaft
- 2.3 Der Social Investment State als,,Third Way\" zwischen Neoliberalismus und Sozialstaat
- 3. Corporate Citizenship im Zeitalter der Globalisierung
- 4. Die Vereinigung von gesellschaftlichen Interessen mit unternehmerischem Nutzen als Potential des Bürgerschaftsengagements
- 4.1 Kalkulierte Großzügigkeit: Der,,Business Case"
- 4.2 Profit für die Gesellschaft: Der,,Social Case"
- 4.3 Corporate Citizenship als Balance zwischen Mäzenatentum und Sponsoring
- 5. Risikofaktor Corporate Citizenship
- 6. Der Konzern ExxonMobil und sein Engagement in den erdölreichen Staaten der Subsahara
- 6.1,,Paradox of Plenty\": Die ressourcenreichen afrikanischen Staaten als Konglomerate politischer, sozialer und ökonomischer Dilemmata
- 6.2 Porträt der Corporate Citizenship Strategie von ExxonMobil in Afrika
- 6.3 Die Problemregion Tschad und das Exxon Valdez Desaster als kausale Faktoren für begründete Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Konzernengagements
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert das Konzept des Corporate Citizenship im Kontext der Globalisierung und untersucht dessen Implikationen, insbesondere in fragilen, erdölreichen Staaten der Subsahara. Die Arbeit beleuchtet das Engagement des Mineralölkonzerns ExxonMobil in diesen Regionen und setzt sich kritisch mit den Chancen und Risiken dieses bürgerschaftlichen Engagements auseinander.
- Definition und Abgrenzung des Corporate Citizenship Konzepts von Corporate Social Responsibility
- Die Rolle von Unternehmen als Bürger der Gesellschaft im Kontext des Social Investment State
- Chancen und Risiken des Corporate Citizenship im Zeitalter der Globalisierung
- Das Engagement von ExxonMobil in den erdölreichen Staaten der Subsahara
- Die Problematik des "Paradox of Plenty" und die Rolle von multinationalen Unternehmen in fragilen Staaten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema Corporate Citizenship ein und stellt dessen Relevanz im Kontext globaler Entwicklungen dar. Kapitel zwei definiert den Begriff des Corporate Citizenship und grenzt ihn vom Konzept der Corporate Social Responsibility ab. Anschließend wird die Rolle von Unternehmen als Bürger der Gesellschaft im Kontext des Social Investment State diskutiert. Kapitel drei beleuchtet die Chancen und Risiken des Corporate Citizenship im globalen Kontext. Kapitel vier befasst sich mit dem Engagement des Mineralölkonzerns ExxonMobil in den erdölreichen Staaten der Subsahara und analysiert dessen Implikationen für diese fragilen Staaten.
Schlüsselwörter
Corporate Citizenship, Corporate Social Responsibility, Globalisierung, Social Investment State, ExxonMobil, Subsahara, Paradox of Plenty, fragilen Staaten, Ressourcenreichtum, ökonomische Entwicklung, gesellschaftliche Verantwortung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Corporate Citizenship (CC)?
Corporate Citizenship bezeichnet das bürgerschaftliche Engagement von Unternehmen, die über ihre Geschäftstätigkeit hinaus soziale Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen.
Wie unterscheidet sich CC von Corporate Social Responsibility (CSR)?
CSR ist oft breiter gefasst und bezieht sich auf die gesamte Verantwortung des Unternehmens im Kerngeschäft, während CC spezifisch das Engagement als „Bürger“ in der lokalen oder globalen Gemeinschaft betont.
Was ist das „Paradox of Plenty“?
Es beschreibt das Phänomen, dass ressourcenreiche Staaten oft unter wirtschaftlicher Instabilität, Korruption und sozialen Konflikten leiden, anstatt vom Reichtum zu profitieren.
Welche Risiken birgt CC in fragilen Staaten?
Unternehmen können ohne demokratische Legitimation staatliche Aufgaben übernehmen, was dazu führen kann, dass der Staat sich aus seiner Verantwortung für Soziales und Gesundheit zurückzieht.
Warum investieren Konzerne wie ExxonMobil in soziale Projekte?
Neben moralischen Gründen gibt es den „Business Case“: Soziales Engagement verbessert das Image, die Marktkapitalisierung und wird von Shareholdern honoriert.
- Arbeit zitieren
- Stephanie Julia Winkler (Autor:in), 2009, Corporate Citizenship im Globalisierungsprozess, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168064