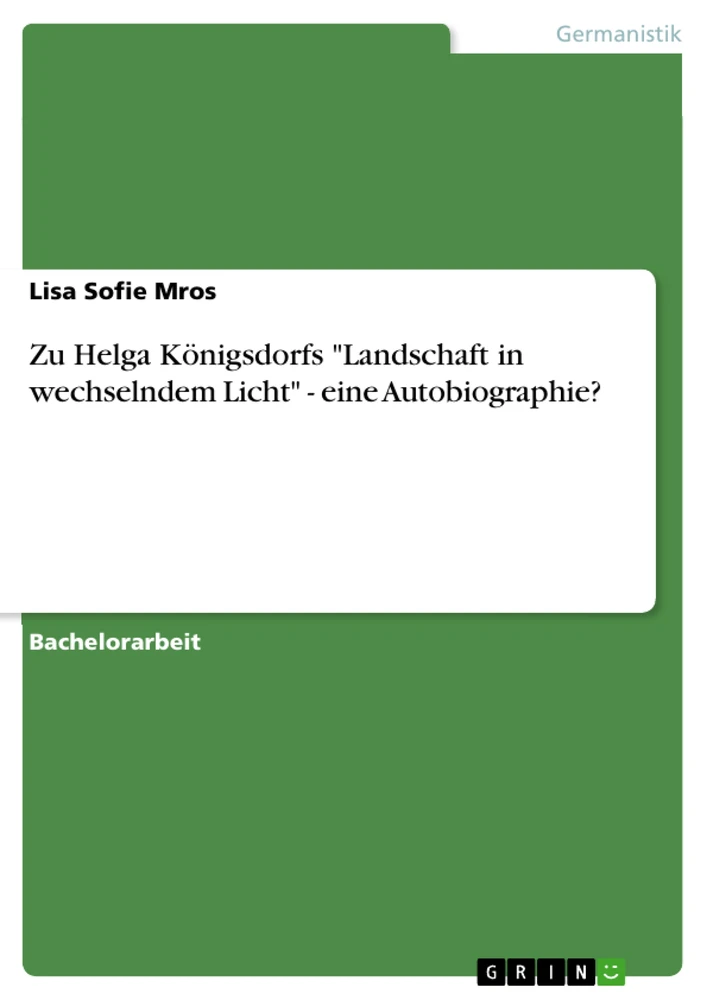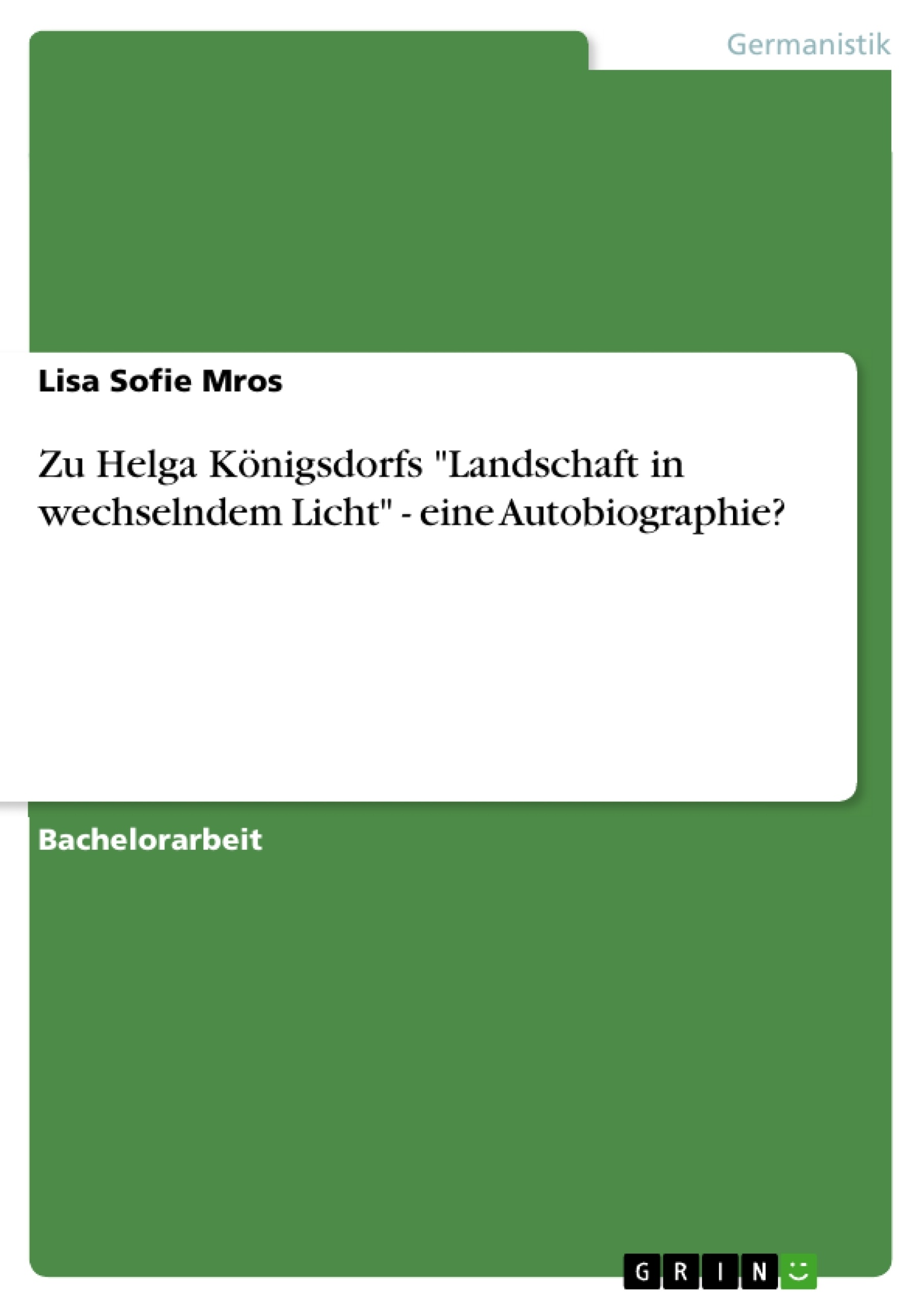Immer noch oder immer wieder erfreuen sich schriftliche Selbstoffenbarungen großer Beliebtheit bei dem lesenden Teil der Bevölkerung. Ob die Selbstdarstellung einer bekannten Persönlichkeit oder der Frau von Nebenan: Es ist äußerst reizvoll private Details aus dem Leben eines fremden Menschen zu erfahren. Dabei spielt für den Leser eine untergeordnete Rolle, ob es sich um eine Biographie, Autobiographie oder um ein Memoirenbuch handelt.
Anders verhält sich die Angelegenheit jedoch für die Literaturwissenschaftler, die in zahlreichen Aufsätzen und Büchern über die spezifischen Unterschiede zwischen den autobiographischen Genres referieren. Während meiner Literaturrecherche musste ich feststellten, dass diese Ansicht nicht überall verbreitet ist. In einer Rezension der Berliner Zeitung über Helga Königsdorfs Autobiographie „Landschaft in wechselndem Licht“ betitelt der Verfasser ihr Werk fortlaufend als Memoirenbuch. Obwohl ich bereits der Überzeugung war, dass es sich bei diesem Werk um eine Autobiographie und nicht um ein Memoirenbuch handeln musste, entschloss ich mich dennoch dazu, eine Differenzierung der autobiographischen Gattung vorzunehmen und als Themenpunkt mit in meine Ausarbeitung aufzunehmen.
Die Arbeit lässt sich in zwei Bereiche einteilen: Kapitel 2 umfasst die Darstellung des theoretischen Teils der Gattung Autobiographie. Drei Unterpunkte beschäftigen sich mit den Entwicklungen und den Charakteristiken moderner Autobiographien sowie mit der Definition der sogenannten autobiographischen Wahrheit. Auf diese Weise soll der Leser für die autobiographische Gattung sensibilisiert werden, um in der Lage zu sein, in Kapitel 3 einen Transfer leisten zu können. In diesem Kapitel folgt auf der Grundlage theoretischen Wissens schließlich die Analyse des Primärtextes „Landschaften in wechselndem Licht“. In fünf Unterkapiteln wird der Text auf typische Merkmale moderner Autobiographien untersucht, die am Ende meine These bestätigen sollen. Dabei werde ich nicht nur die Art der Umsetzung des autobiographischen Paktes überprüfen, sondern auch nach Ereignissen suchen, die von der Autobiographin subjektiv oder gar nicht erwähnt werden. Des Weiteren wird die Autobiographie auf zentrale Motive und Themen untersucht, die die Identität von Autorin und Protagonistin zusätzlich belegen. Anschließend beschäftigt sich ein letztes Unterkapitel mit kritischen Selbstreflexionen der Autorin. Mit einer Zusammenfassung endet meine Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie der modernen Autobiographie
- Entwicklung zur modernen Autobiographie des 20. Jahrhunderts
- Charakterisierungen moderner Autobiographien
- Autobiographische Wahrheit
- Analyse von Helga Königsdorfs Autobiographie ,,Landschaft in wechselndem Licht"
- Autobiographischer Pakt
- Erzählgestaltung und Zeitebene
- Subjektive Erinnerungen
- Themen und Motive
- Kritische Selbstreflexionen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Analyse von Helga Königsdorfs Autobiographie ,,Landschaft in wechselndem Licht". Ziel ist es, die Gattung der modernen Autobiographie anhand des Primärtextes zu untersuchen und die Frage nach der autobiographischen Wahrheit zu beleuchten.
- Die Entwicklung der modernen Autobiographie im 20. Jahrhundert
- Die Charakteristik der modernen Autobiographie
- Das Konzept der autobiographischen Wahrheit
- Die Analyse von ,,Landschaft in wechselndem Licht" im Hinblick auf typische Merkmale moderner Autobiographien
- Die Erforschung der zentralen Motive und Themen, die die Identität von Autorin und Protagonistin belegen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert den Ausgangspunkt der Arbeit und stellt die These auf, dass es sich bei ,,Landschaft in wechselndem Licht" um eine Autobiographie handelt.
Kapitel 2 widmet sich der Theorie der modernen Autobiographie. Es beleuchtet die historischen und theoretischen Grundlagen der Gattung sowie deren Entwicklung im 20. Jahrhundert. Besondere Aufmerksamkeit wird der Definition der autobiographischen Wahrheit geschenkt.
Kapitel 3 analysiert Helga Königsdorfs ,,Landschaft in wechselndem Licht" anhand von Kriterien moderner Autobiographien. Es untersucht die Art des autobiographischen Paktes, die Erzählgestaltung, die Zeitebene, die subjektiven Erinnerungen, die Themen und Motive sowie die kritischen Selbstreflexionen der Autorin.
Schlüsselwörter
Autobiographie, moderne Autobiographie, autobiographische Wahrheit, Helga Königsdorf, ,,Landschaft in wechselndem Licht", Identität, Selbstreflexion, Themen und Motive, Erzählgestaltung, Zeitebene.
Häufig gestellte Fragen
Ist „Landschaft in wechselndem Licht“ eine Autobiographie oder ein Memoirenbuch?
Obwohl es oft als Memoirenbuch bezeichnet wird, weist das Werk von Helga Königsdorf alle typischen Merkmale einer modernen Autobiographie auf, da es die persönliche Entwicklung und Identität der Autorin in den Mittelpunkt stellt.
Was versteht man unter dem „autobiographischen Pakt“?
Der autobiographische Pakt ist ein Übereinkommen zwischen Autor und Leser, bei dem der Autor versichert, dass er identisch mit dem Erzähler und der Hauptfigur ist und die Ereignisse der Wahrheit entsprechen.
Was ist „autobiographische Wahrheit“?
Autobiographische Wahrheit ist subjektiv. Sie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auf der Erinnerung und der Deutung des Autors, wie er sein Leben und seine Identität zum Zeitpunkt des Schreibens wahrnimmt.
Welche Themen sind zentral in Helga Königsdorfs Werk?
Zentrale Themen sind die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität, das Leben in der DDR, die Rolle als Frau und Wissenschaftlerin sowie die Reflexion über persönliche und gesellschaftliche Veränderungen.
Wie unterscheidet sich eine moderne Autobiographie von älteren Formen?
Moderne Autobiographien des 20. Jahrhunderts sind oft fragmentierter, selbstkritischer und legen weniger Wert auf eine lückenlose Chronologie als vielmehr auf die psychologische Tiefenschärfe und Selbstreflexion.
Warum ist die subjektive Erinnerung in Autobiographien so wichtig?
Da das menschliche Gedächtnis selektiv ist, zeigt die Auswahl der erzählten (oder weggelassenen) Ereignisse, welche Momente für die Identitätsbildung des Autors am bedeutendsten waren.
- Arbeit zitieren
- Lisa Sofie Mros (Autor:in), 2008, Zu Helga Königsdorfs "Landschaft in wechselndem Licht" - eine Autobiographie?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168067