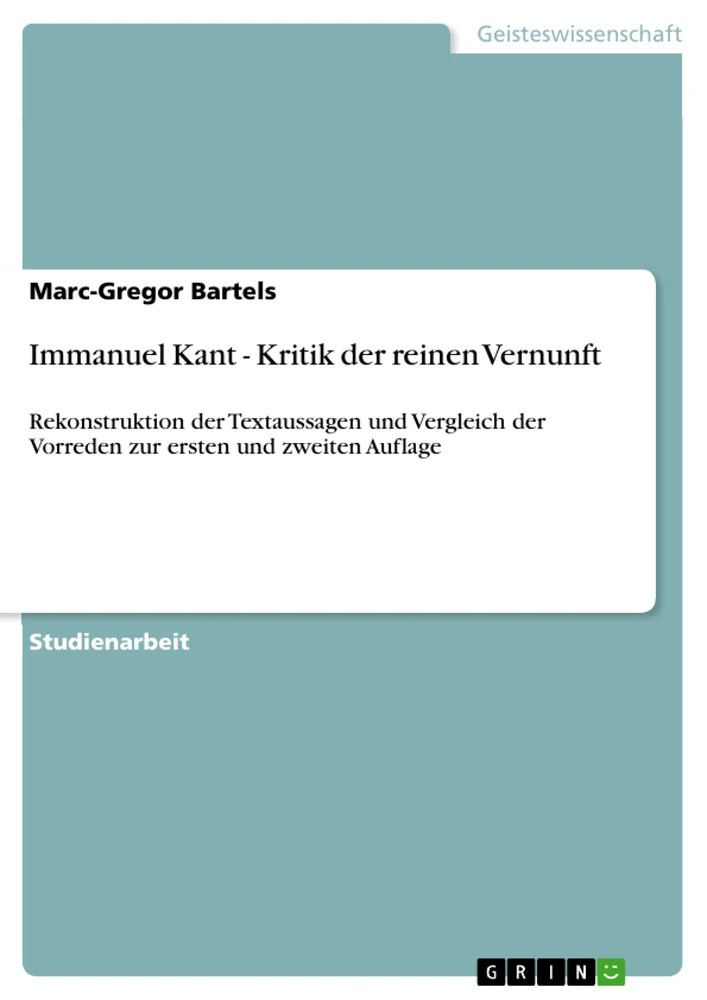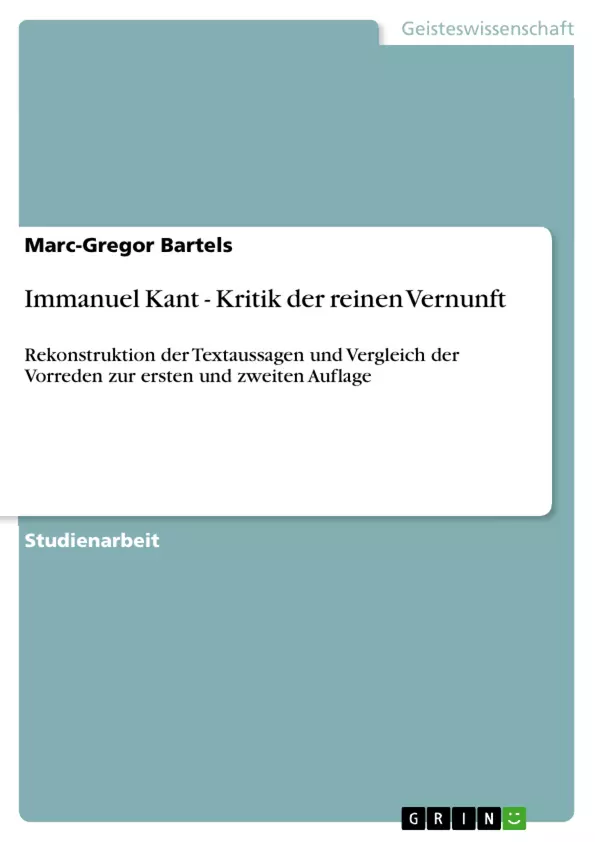1. Zielsetzung:
In der vorliegenden Hausarbeit über die Vorreden der ersten und zweiten Auflage von Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft, werde ich zunächst die enthaltenen Textaussagen rekonstruieren, um sie dann miteinander zu vergleichen. Anhand dieses Vergleichs werde ich die Unterschiede zwischen den beiden Vorreden aufzeigen.
Mit dieser Aufgabenstellung beabsichtige ich zweierlei:
Zum einen soll eine modernsprachliche Rekonstruktion besagter Texte deren Verständnis erleichtern und so Einsteigern und philosophischen Laien einen Zugang zu Immanuel Kants Hauptwerk ermöglichen.
Zum anderen gibt es einen sehr interessanter Einblick in die Person Kant einerseits und den Philosophen Kant andererseits, anhand der Unterschiede der beiden Vorreden nachzuzeichnen, wie er den öffentlichen Reaktionen, oder gerade deren Ausbleiben, auf die erste Ausgabe seines Hauptwerks begegnet.
2. Einleitung:
Zum Antritt seiner Professur für Logik und Metaphysik in Königsberg legte Immanuel Kant 1770 eine zweite Dissertation mit dem Titel Formen und Gründe der Sinnes-und Verstandeswelt vor.
Bei der Überarbeitung dieser zur Veröffentlichung, kamen Kant zunehmend Zweifel an seinen bis dahin, rationalistisch geprägten Positionen. Auslöser war die Lektüre des Empiristen David Hume. Dessen Position empfand Kant jedoch auch nicht als befriedigend, da diese unweigerlich zum Skeptizismus führten. So unterbrach Kant in den folgenden 11 Jahren sämtliche schriftstellerischen Aktivitäten und widmete sich in seiner Kritik der reinen Vernunft ausschließlich der Metaphysik. Nach der Erstveröffentlichung 1781 fielen die Reaktionen, auf das schwer verständliche Werk jedoch negativ und sehr verhalten aus. Daraufhin veröffentlichte Kant 1783 die Prolegomena (Vorbemerkungen) zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können, in welchen er von der bisherigen Darstellung seiner Positionen von „synthetischen Lehrart“ zur „analytischen Methode“ überging.
Dies, sowie das Erscheinen einer zweiten, stark überarbeiteten, Auflage der Kritik der reinen Vernunft 1787, steigerten das Verständnis und die Rezeption Kants und machten ihn zum führenden und meist diskutierten Philosophen seiner Zeit.
Inhaltsverzeichnis
- Zielsetzung
- Einleitung
- Vorrede zur ersten Auflage
- Vorrede zur zweiten Auflage
- Vergleich der Vorreden
- Quellenangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Vorreden zur ersten und zweiten Auflage von Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft. Sie rekonstruiert die Textinhalte und vergleicht die Unterschiede zwischen den beiden Vorreden. Die Arbeit zielt darauf ab, die Texte für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen und Einblicke in Kants Entwicklung und seine Reaktion auf die Rezeption seines Hauptwerks zu bieten.
- Rekonstruktion der Textinhalte der Vorreden zur ersten und zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft
- Vergleich der Unterschiede zwischen den beiden Vorreden
- Einblick in Kants Entwicklung und seine Reaktion auf die Rezeption seines Hauptwerks
- Vereinfachung der Texte für ein breiteres Publikum
- Verständnis des Kontexts der Kritik der reinen Vernunft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Problematik der Metaphysik und Kants Auseinandersetzung mit Rationalismus und Empirismus ein. Sie skizziert den Entstehungsprozess der Kritik der reinen Vernunft und die Reaktion auf die erste Auflage.
Vorrede zur ersten Auflage
Die Vorrede zur ersten Auflage charakterisiert die menschliche Vernunft als ein Vermögen, das sich mit Fragen konfrontiert, die über seine Fähigkeiten hinausgehen. Kant beschreibt den Konflikt zwischen Rationalismus und Skeptizismus in der Metaphysik und betont die Bedeutung der Kritik der reinen Vernunft als einen "Gerichtshof" für die Vernunft.
Vorrede zur zweiten Auflage
Die Vorrede zur zweiten Auflage stellt die Kritik der reinen Vernunft als eine Methode dar, die es ermöglicht, die Grenzen und Möglichkeiten der Vernunft zu bestimmen. Kant argumentiert, dass seine Kritik eine vollständigere und präzisere Darstellung der Vernunft bietet und so die bisherige Dogmatik und den Skeptizismus überwindet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Hausarbeit sind die Kritik der reinen Vernunft, Immanuel Kant, Vorreden, Metaphysik, Rationalismus, Empirismus, Erkenntnis, Vernunftvermögen, apriorische Erkenntnis, synthetische Lehrart, analytische Methode, Dogmatismus, Skeptizismus.
Häufig gestellte Fragen
Warum gibt es zwei verschiedene Vorreden zur "Kritik der reinen Vernunft"?
Kant reagierte in der zweiten Vorrede von 1787 auf die verhaltene und teils negative Rezeption der Erstausgabe von 1781, um sein Werk verständlicher zu machen.
Was ist Kants "Gerichtshof der Vernunft"?
In der ersten Vorrede beschreibt Kant die Kritik der reinen Vernunft als eine Instanz, die die rechtmäßigen Ansprüche der Vernunft sichern und grundlose Anmaßungen abweisen soll.
Welchen Einfluss hatte David Hume auf Kant?
Die Lektüre Humes weckte Kant aus seinem "dogmatischen Schlummer" und führte dazu, dass er seine rationalistischen Positionen überdachte und sich elf Jahre lang der Metaphysik widmete.
Was ist der Unterschied zwischen synthetischer Lehrart und analytischer Methode?
Kant wechselte in den Prolegomena zur analytischen Methode, um den Zugang zu seinen komplexen Thesen zu erleichtern, während das Hauptwerk ursprünglich in synthetischer Lehrart verfasst war.
Was sind apriorische Erkenntnisse?
Es handelt sich um Erkenntnisse, die unabhängig von aller Erfahrung gültig sind und die Grenzen des menschlichen Vernunftvermögens definieren.
- Arbeit zitieren
- Marc-Gregor Bartels (Autor:in), 2010, Immanuel Kant - Kritik der reinen Vernunft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168073