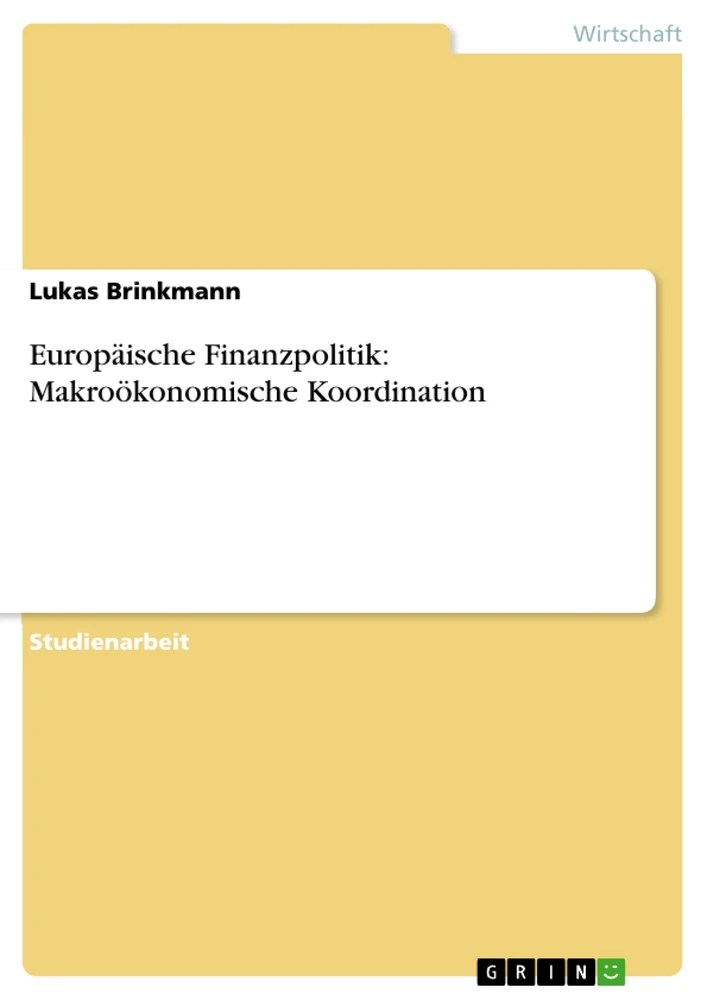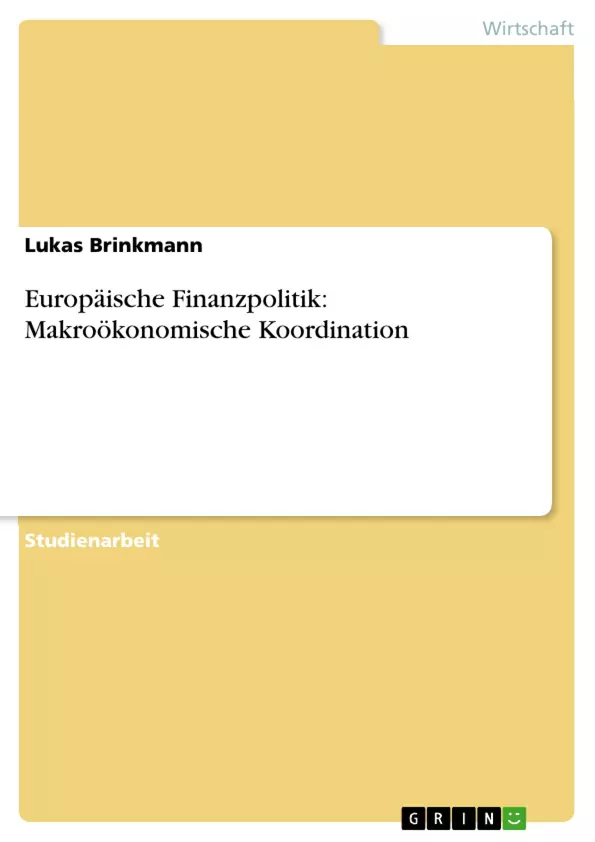1. Einleitung
Seit der Gründung der Europäischen Währungsunion (EWU) 1999 fehlen den Mitgliedsstaa- ten wichtige Instrumente der nationalen Wirtschaftspolitik, da diese nun in die Europäische Zentralbank (EZB) übergegangen sind. Dadurch, dass es keine nationalen Währungen und die damit einhergehenden Wechselkurse mehr gibt, können die einzelnen Volkswirtschaften folg- lich nicht mehr auf- oder abwerten. Die EZB betreibt nämlich eine einheitliche Geldpolitik für die EWU und orientiert sich nicht an nationalen Erfordernissen.
Für viele Länder entstanden dadurch positive Effekte. Die einheitliche und stabilitätsorientier- te Geldpolitik verringerte das Potential einer erhöhten Inflation erheblich. Dies lag vor allem daran, dass die zuverlässige und wissensstarke damalige Deutsche Bundesbank als Vorbild genommen wurde. Ferner verringerte sich die Risikoprämie bei den Zinsen deutlich.1 Länder wie Spanien, Italien oder Irland konnten sich nach Einführung des Euros günstiger Geld an den Finanzmärkten beschaffen. Dies führte in der Anfangsphase der EWU zu deutlich höhe- ren Wachstumsraten in diesen Ländern, aber auch zur Unterstützung von Fehlentwicklungen wie beispielsweise der spanischen Immobilienblase.
Die EWU ist ein Staatenkonstrukt mehrerer verschiedener Staaten, welche sich strukturell unterscheiden. Aufgrund der Heterogenität stellt sich unter Ökonomen oft die Frage, ob eine makroökonomische Koordination sinnvoll ist, um beispielsweise asymmetrischen Schocks besser entgegenzuwirken oder auch um Steuersysteme etc. zu harmonisieren. Durch die Fi- nanzkrise von 2008 waren die Staaten weltweit gezwungen ihre Wirtschaft durch schuldenfi- nanzierte Konjunkturpakete zu unterstützen. Hierbei handelte die Europäische Union (EU) als Staatengemeinschaft eher unkoordiniert. Die Länder handelten sehr unterschiedlich. Deutsch- land und Spanien verabschiedeten in Relation zum BIP große Konjunkturpakete. Kleinere Länder und Italien hingegen beschlossen sehr geringe oder gar keine Maßnahmen. Aus die- sem Sachverhalt ergibt sich die Frage, ob es Länder in der EWU gibt, welche auf grenzüber- schreitende Spillover Effekte setzen und sich selbst nicht aktiv an einer Konjunkturstützung im Form von Fiskalmaßnahmen beteiligen wollen. Diese Frage werde ich in Kapitel 4 näher beleuchten.
Zuvor wird in Kapitel 2 mit der Analyse von Multiplikatoreffekten begonnen. In der Wissen- schaft wird oft der keynesianische Multiplikatoreffekt herangezogen, welcher größer eins ist. Jedoch gibt
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Multiplikatoreffekte durch Ausgabensteigerungen nationaler Regierungen
- Kann eine koordinierte Makropolitik von Vorteil sein?
- Politikbereiche einer makroökonomischen Koordination
- Wünschbarkeit einer makroökonomischen Koordination
- Instrumente einer makroökonomischen Koordination
- Exkurs: Zentralisierung der GP in den ASEAN Staaten
- Spillover Effekte in der EU am Beispiel der Finanzkrise
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Auswirkungen von fiskalpolitischen Maßnahmen auf die Wirtschaft und untersucht, ob eine koordinierte Makropolitik in der Europäischen Währungsunion sinnvoll ist. Die Arbeit untersucht insbesondere die Auswirkungen von Konjunkturpaketen auf den Multiplikatoreffekt und die Frage, ob und wie eine Koordination der Wirtschaftspolitik in der EU sinnvoll wäre.
- Der keynesianische Multiplikatoreffekt und seine Gültigkeit
- Die Bedeutung von Spillover-Effekten für die EU
- Die Vorteile und Herausforderungen einer koordinierten Makropolitik in der EWU
- Die Rolle von Fiskalpolitik in der Bewältigung von asymmetrischen Schocks
- Eine vergleichende Betrachtung der Fiskalpolitik in verschiedenen EU-Staaten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Ausgangssituation in der Europäischen Währungsunion (EWU) dar und erläutert die Herausforderungen, die sich durch die fehlenden Instrumente der nationalen Wirtschaftspolitik ergeben. Zudem werden die wichtigsten Themen der Arbeit und die Gliederung der einzelnen Kapitel vorgestellt.
- Multiplikatoreffekte durch Ausgabensteigerungen nationaler Regierungen: In diesem Kapitel wird der keynesianische Multiplikatoreffekt im Kontext der Konjunkturpakete der Finanzkrise von 2008/2009 analysiert. Es werden verschiedene Studien und Modelle vorgestellt, die den Effekt von staatlichen Ausgaben auf die Gesamtnachfrage untersuchen. Dabei wird die Diskussion um die Höhe des Multiplikators und die potenziellen negativen Folgen von staatlichen Ausgaben beleuchtet.
- Kann eine koordinierte Makropolitik von Vorteil sein?: Dieses Kapitel behandelt die Frage, ob eine koordinierte Makropolitik in der EU sinnvoll ist, um beispielsweise asymmetrischen Schocks besser entgegenzuwirken. Es werden die verschiedenen Politikfelder einer möglichen Koordination erläutert und die potenziellen Vorteile und Nachteile einer solchen Koordination analysiert. Außerdem werden verschiedene Instrumente einer makroökonomischen Koordination vorgestellt.
- Spillover Effekte in der EU am Beispiel der Finanzkrise: In diesem Kapitel werden die grenzübergreifenden Spillover-Effekte von Fiskalpolitik in der EU am Beispiel der Finanzkrise beleuchtet. Es wird die Frage untersucht, ob Länder in der EWU auf diese Effekte setzen und sich selbst nicht aktiv an einer Konjunkturstützung beteiligen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen der Makroökonomischen Koordination, der Fiskalpolitik, dem Multiplikatoreffekt, den Spillover-Effekten, der Europäischen Währungsunion (EWU) und der Finanzkrise von 2008. Besondere Bedeutung haben die Analyse von staatlichen Konjunkturpaketen, die Auswirkungen von fiskalpolitischen Maßnahmen auf die Wirtschaft und die Frage, ob und wie eine Koordination der Wirtschaftspolitik in der EU sinnvoll wäre.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist makroökonomische Koordination in der EWU wichtig?
Da die Mitgliedsstaaten keine eigene Geldpolitik mehr betreiben können, hilft Koordination dabei, asymmetrische Schocks besser abzufedern.
Was besagt der keynesianische Multiplikatoreffekt?
Er beschreibt, wie staatliche Ausgabensteigerungen zu einer überproportionalen Erhöhung der Gesamtnachfrage und des BIP führen können.
Was sind Spillover-Effekte im EU-Kontext?
Damit sind Auswirkungen fiskalpolitischer Maßnahmen eines Landes auf andere Mitgliedsstaaten gemeint, die grenzüberschreitend wirken.
Wie reagierte die EU auf die Finanzkrise 2008?
Die Reaktion war eher unkoordiniert; während Deutschland große Pakete verabschiedete, blieben andere Länder wie Italien passiv.
Welche Rolle spielt die EZB für die nationalen Volkswirtschaften?
Die EZB betreibt eine einheitliche Geldpolitik, die sich an der gesamten EWU orientiert und nicht an den spezifischen Erfordernissen einzelner Länder.
- Citar trabajo
- Bachelor of Arts Lukas Brinkmann (Autor), 2010, Europäische Finanzpolitik: Makroökonomische Koordination, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168109