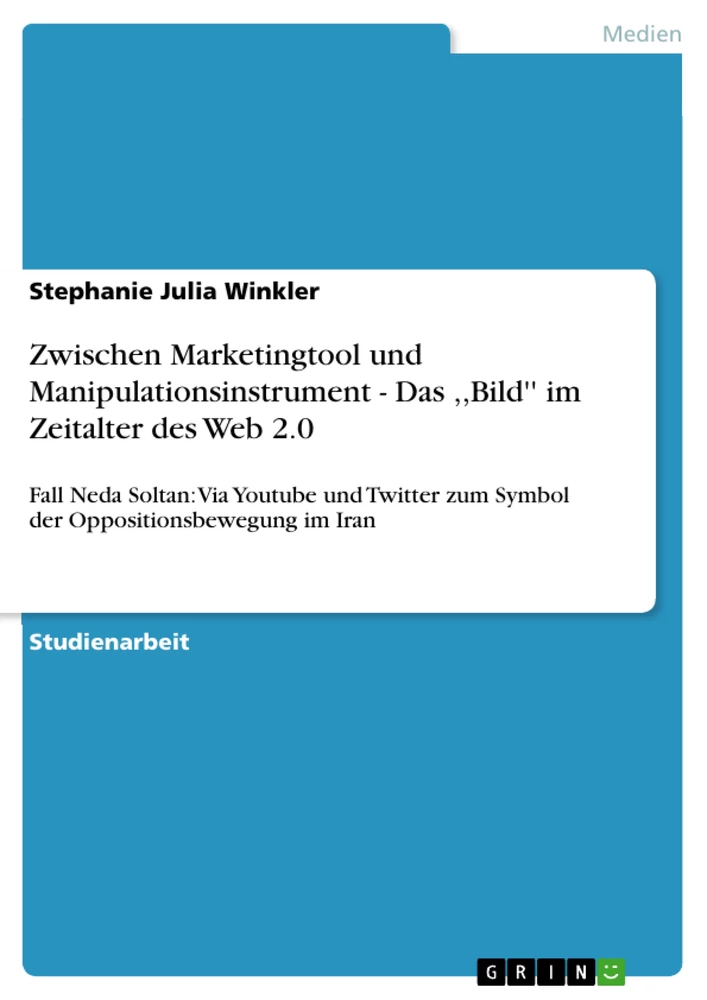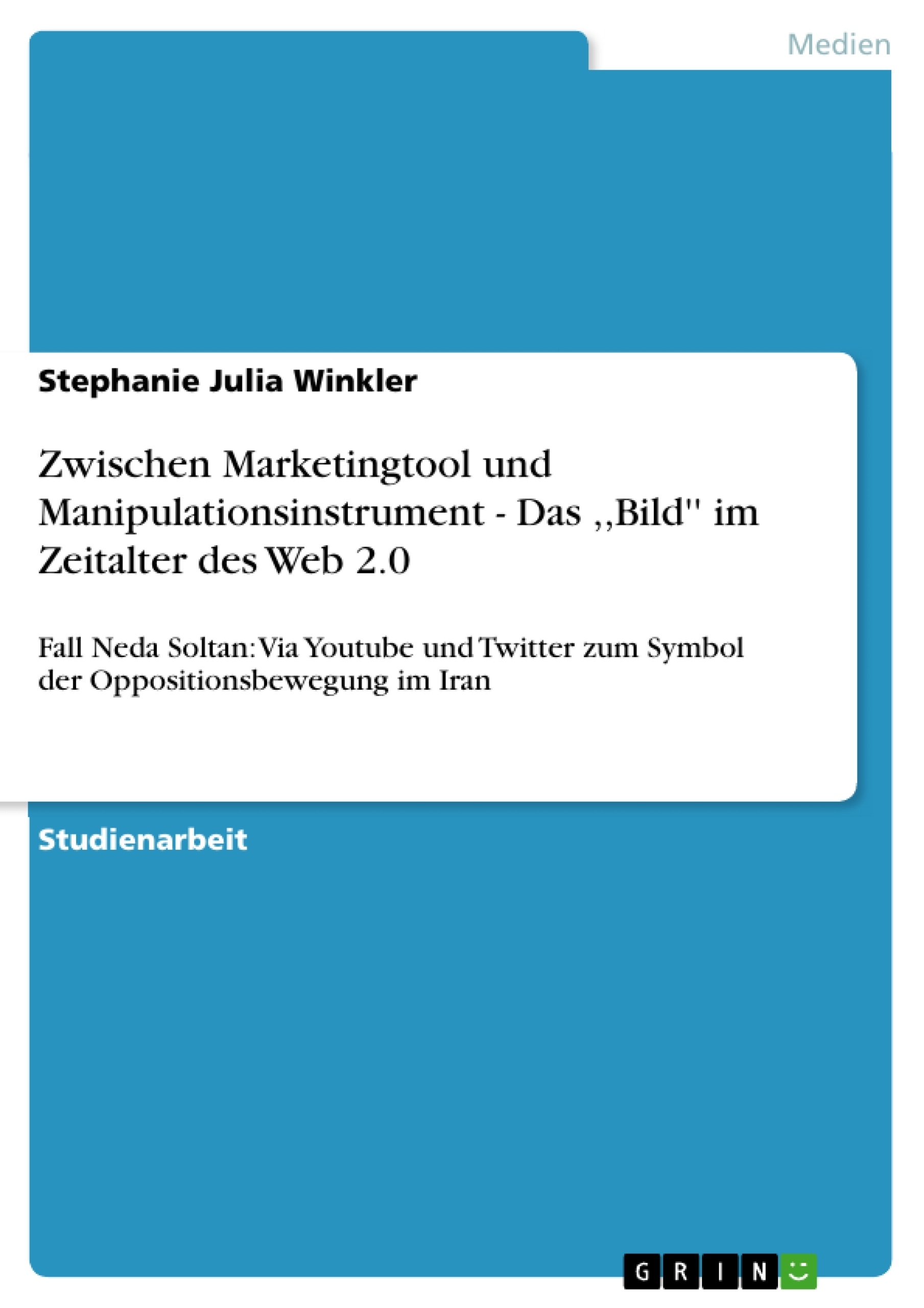Schon im 15.Jahrhundert, also lange bevor man von einer Entwicklung hin zu einer multimedialen Bildgesellschaft sprechen kann, erkannte Erasmus von Rotterdam, dass ,,je weniger wir Trugbilder bewundern, desto mehr vermögen wir die Wahrheit aufzunehmen‘‘ . Fünf Jahrhunderte später, also zu Beginn des 20.Jahrhunderts folgte dann der Übergang von der Bebilderung der Welt zu Welt der Bilder . Die explosionsartige Verbreitung der Fernsehtechnologie in den 60er Jahren lieferte dabei die technische Basis für die Transformation in Richtung einer Gesellschaft, die von der Omnipräsenz der Bilder geprägt ist. Heute leben wir in jenem visuellen Zeitalter, in dem Bilder die Autorität über unsere Vorstellungskraft besitzen und in dem wir unsere Lebensgewohnheiten nach dem Fernseher richten . Mitchell bezeichnete dieses Phänomen der stark visuell geprägten Rezeption und Interpretationsmodi einst als ,,pictoral turn‘‘ . Sich nicht von den vorgefertigten Informations- und Interpretationsstrukturen beeinflussen, zu lassen ist allerdings kein leichtes Unterfangen in der Mediengesellschaft des 21. Jahrhunderts, in der die digitale Revolution die Möglichkeiten der Bildbearbeitung und Manipulation revolutioniert hat. Dabei macht sich nicht nur die Fernsehindustrie die Gier des menschlichen Bedürfnisses nach Konkretheit und Anschaulichkeit zu Nutze. In der kompletten Medienbranche herrscht ein regelrechter Bilderboom. Youtube ist mit durchschnittlich 65.000 neuen täglich hochgeladenen Videos und 100 Millionen täglich angesehenen Clips Weltmarktführer, und schon jetzt sind mehr Menschen in sozialen (Bild-)Netzwerken wie StudiVZ oder facebook organisiert als in Sportvereinen. Das Bild galt seit Beginn des 20.Jahrhunderts als Schlüsselmedium unserer Zeit. Aber haben nicht gerade die kontinuierlichen Entwicklungen im Technikbereich und die zunehmende Ablösung des klassischen Bildes durch die Hypertext-Bilder des Internets gezeigt, dass dieser Begriff veraltet ist? Wo liegt heutzutage die Funktion der Bilder, die anscheinend zwischen Marketingtool und Manipulationsinstrument divergiert? In welchen Kontexten werden Bilder heute primär eingesetzt? Was lässt sich heute, im Zeitalter des Web 2.0, unter dem Begriff Bild verstehen? Diese und andere Fragen rund um das Thema Bild sollen im Verlauf dieser Hausarbeit untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung: Vom 15. Jahrhundert zum Bild im Zeitalter des Web 2.0
- 1.1 Das Bild als Schlüsselmedium unserer Zeit
- 2. Etymologische Annäherung an den Begriff des Bildes in seiner Funktion als Medium
- 3. Augenzeugenillusion und Global Village als Ursache der Macht der Bilder im Zeitalter des World Wide Web
- 4. Kognitive Verarbeitungsprozesse und deren Implikationen für die subjektive Bildrezeption
- 5. Divergente Bildeffekte von Corporate Design bis kollektivem Kulturgedächtnis
- 6. Das Bild in multiplen Kontexten
- 6.1 Fotografie als reproduktive Verbilderung von Wirklichkeit
- 6.2 Bilder in Printmedien und deren lebenszyklisch-prägender Einfluss
- 6.3 Die integrative Funktion des Graffiti
- 6.4 Der Verlust der Aura als Folge der technischen Reproduzierbarkeit im Bereich der Bildkunst
- 6.5 Bildwerbungsboom und PR 2.0
- 6.6 Fernsehen: Stereotyp trifft Schlüsselbild
- 6.7 Das Bild als computergesteuerte Simulation von Wirklichkeit
- 6.8 Web 2.0: Das Bild als kreative Ausdrucksform in Social Communities, Media Sharing Plattformen und Co.
- 7. Fall Neda Soltan: Via Youtube und Twitter zum Symbol der Oppositionsbewegung im Iran
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht die Rolle des Bildes im Zeitalter des Web 2.0 und beleuchtet die Ambivalenz seiner Funktion als sowohl Marketingtool als auch Manipulationsinstrument. Sie analysiert, wie Bilder in der heutigen Gesellschaft wahrgenommen und verarbeitet werden und wie sie unsere Meinungsbildung und unser Handeln beeinflussen.
- Die Entwicklung der Bildkultur im 20. Jahrhundert
- Die Macht der Bilder und ihre Auswirkungen auf unsere Wahrnehmung
- Die Rolle des Web 2.0 in der Verbreitung und Nutzung von Bildern
- Der Einfluss von Bildern auf die Meinungsbildung und das gesellschaftliche Bewusstsein
- Die Möglichkeiten und Gefahren der Manipulation durch Bilder
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt den Kontext des Bildes im 21. Jahrhundert dar und zeigt die historische Entwicklung von der Bebilderung der Welt zu einer Welt der Bilder. Kapitel 2 befasst sich mit der etymologischen Herleitung des Begriffs „Bild“ und seiner Funktion als Medium. In Kapitel 3 werden die Ursachen für die Macht der Bilder im Zeitalter des World Wide Web beleuchtet, insbesondere die Augenzeugenillusion und das „Global Village“. Kapitel 4 analysiert die kognitiven Prozesse, die bei der Bildrezeption eine Rolle spielen. Kapitel 5 diskutiert die unterschiedlichen Effekte von Bildern, vom Corporate Design bis zum kollektiven Kulturgedächtnis. Die Kapitel 6.1 bis 6.8 untersuchen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Bildes in verschiedenen Kontexten, wie Fotografie, Printmedien, Graffiti, Kunst, Werbung, Fernsehen, Computer und Internet. Abschließend präsentiert Kapitel 7 den Fall der iranischen Studentin Neda Soltan als Beispiel für die Macht der Bilder im Web 2.0.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit fokussiert auf den Begriff des Bildes, seine Funktion als Medium und seine Auswirkungen auf unsere Wahrnehmung und Meinungsbildung. Zentrale Themen sind die Bildkultur im digitalen Zeitalter, das Web 2.0, die Augenzeugenillusion, die kognitive Bildverarbeitung, die Manipulationsmöglichkeiten von Bildern und die Rolle von Social Communities in der Verbreitung von Bildern.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff "pictoral turn"?
Er beschreibt den Übergang von einer textbasierten zu einer visuell geprägten Gesellschaft, in der Bilder die primäre Quelle für Information und Interpretation sind.
Wie werden Bilder als Manipulationsinstrument genutzt?
Durch digitale Bearbeitung und Kontextverschiebung können Bilder eine "Augenzeugenillusion" erzeugen, die Betrachter emotional lenkt und Fakten verzerrt.
Welche Rolle spielt das Web 2.0 für die Bildkultur?
Plattformen wie YouTube, Instagram oder Facebook ermöglichen eine explosionsartige Verbreitung und machen das Bild zu einer kreativen Ausdrucksform für jedermann.
Was ist die integrative Funktion von Graffiti?
Graffiti dient oft als visuelles Ausdrucksmittel subkultureller Identität und kann zur Aneignung und Gestaltung des urbanen Raums beitragen.
Warum verlieren Bilder durch technische Reproduzierbarkeit ihre "Aura"?
In Anlehnung an Walter Benjamin führt die endlose Kopierbarkeit dazu, dass das Einzigartige und der traditionelle Kontext eines Kunstwerks verloren gehen.
- Arbeit zitieren
- Stephanie Julia Winkler (Autor:in), 2009, Zwischen Marketingtool und Manipulationsinstrument - Das ,,Bild'' im Zeitalter des Web 2.0, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168136