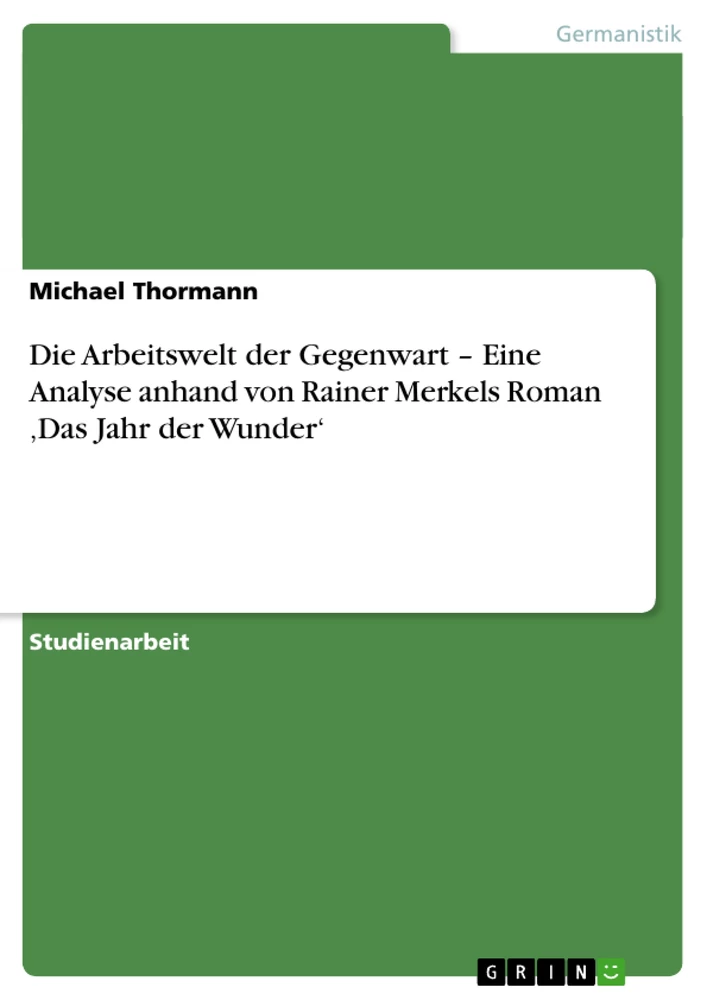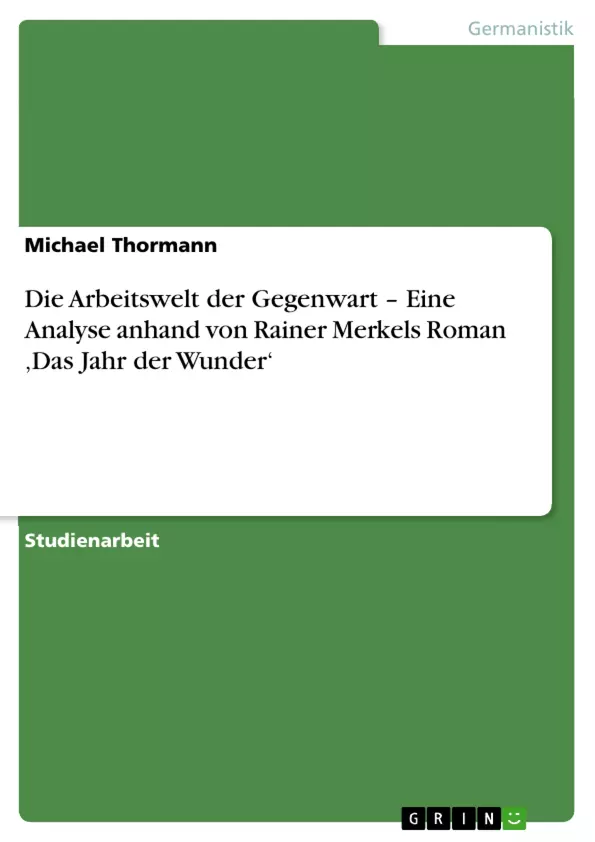Seit den letzten Jahren rückt das Thema Arbeit wieder stärker in den Fokus literarischer Verarbeitung. Ein Grund dafür könnten die drastischen Transformationen sein, welche die Arbeitswelt und die Ökonomie seit wenigen Jahrzehnten durchlaufen. Damit korrespondiert die Entwicklung, dass seit einiger Zeit auch die Literaturwissenschaft die Ökonomie und das Literarische in einer neuen, einander wechselseitigen Durchdringung für sich entdeckt. In der vorliegenden Arbeit soll es daher darum gehen, die fiktionale Werbewelt in Rainer Merkels Roman ‚Das Jahr der Wunder‘ in Beziehung zu setzen mit der Arbeitswirklichkeit, wobei speziell die New Economy betont wird, da die Handlung des Buches in einer Werbeagentur in der Mitte der 90er Jahre spielt.
Dabei wird zunächst in aller Kürze die bisherige „Arbeitsabwesenheit“ in der deutschen Literatur beleuchtet, nach möglichen Gründen hierfür gesucht und es werden einige ausgewählte, aktuelle literarische und wissenschaftliche Texte benannt, die sich mit Arbeit und Ökonomie befassen. Im Anschluss daran beschreibt der zweite kurze Abschnitt die Herausbildung des „Symbol-Analytikers“, jenen Vertreter einer neuen Form von „immaterieller Arbeit“ und zeigt seine besondere Relevanz für die New Economy, die sich eben dadurch auszeichnet, dass sie immaterielle Werte produziert.
Im dritten und größten Kapitel werden dann Passagen in Merkels Werk analysiert, an denen sich der Charakter der gegenwärtigen Arbeitswelt dort manifestiert, wo moderne Disziplinar- bzw. Machtmechanismen auftauchen und Subjektivierungstendenzen im Sinne eines zunehmenden Programms des Sich-selbst-Regierens stattfinden. Darüber hinaus gehen weitere Unterpunkte den mythischen, quasi-religiösen und fiktionalen Vorstellungen innerhalb von Merkels Text nach, reflektieren die (scheinbar unbedeutende) Rolle des Geldes und hinterfragen den Begriff der Kreativität, den die Mitarbeiter in Merkels erdachter Agentur „GFPD“ so intensiv für sich reklamieren. Die beiden letzten Unterpunkte versuchen die Diskrepanz von „Schein und Sein“ sowohl in der New Economy wie auch im Werbeunternehmen in ‚Das Jahr der Wunder‘ aufzudecken und enthüllen dabei einen oft diffusen, etikettenhaften Sprachgebrauch und eine manchmal vorkommende Inhaltsleere in der modernen Wirtschaftswelt.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Arbeit und das Ökonomische in der Literatur der Gegenwart
2. Die New Economy und die neue Form der „immateriellen Arbeit“
3. Zum Roman ‚Das Jahr der Wunder‘ und seinem Autor Rainer Merkel
3.1. Atmosphäre in der Agentur
3.2. „Überwachen und Strafen“ - Das Prinzip des Benthamschen Panopticons in der Arbeitswelt
3.3. Subjektivierungstendenzen in Merkels Roman
3.4. Mythen, Mystik und Fiktionen
3.5. Geld als Nebensache
3.6. Der „kreative Imperativ“
3.7. Die hohle Sprache - Begriffe als Etiketten
3.8. Oberflächlichkeit - Das Missverhältnis von Ausdruck und Inhalt
Fazit
Literaturverzeichnis
Einleitung
Seit den letzten Jahren rückt das Thema Arbeit wieder stärker in den Fokus literarischer Verarbeitung. Ein Grund dafür könnten die drastischen Transformationen sein, welche die Arbeitswelt und die Ökonomie seit wenigen Jahrzehnten durchlaufen. Damit korrespondiert die Entwicklung, dass seit einiger Zeit auch die Literaturwissenschaft die Ökonomie und das Literarische in einer neuen, einander wechselseitigen Durchdringung für sich entdeckt. In der vorliegenden Arbeit soll es daher darum gehen, die fiktionale Werbewelt in Rainer Merkels Roman ‚Das Jahr der Wunder‘ in Beziehung zu setzen mit der Arbeitswirklichkeit, wobei speziell die New Economy betont wird, da die Handlung des Buches in einer Werbeagentur in der Mitte der 90er Jahre spielt.
Dabei wird zunächst in aller Kürze die bisherige „Arbeitsabwesenheit“ in der deutschen Literatur beleuchtet, nach möglichen Gründen hierfür gesucht und es werden einige ausgewählte, aktuelle literarische und wissenschaftliche Texte benannt, die sich mit Arbeit und Ökonomie befassen. Im Anschluss daran beschreibt der zweite kurze Abschnitt die Herausbildung des „Symbol-Analytikers“, jenen Vertreter einer neuen Form von „immaterieller Arbeit“ und zeigt seine besondere Relevanz für die New Economy, die sich eben dadurch auszeichnet, dass sie immaterielle Werte produziert. Im dritten und größten Kapitel werden dann Passagen in Merkels Werk analysiert, an denen sich der Charakter der gegenwärtigen Arbeitswelt dort manifestiert, wo moderne Disziplinar- bzw. Machtmechanismen auftauchen und Subjektivierungstendenzen im Sinne eines zunehmenden Programms des Sich-selbst-Regierens stattfinden. Darüber hinaus gehen weitere Unterpunkte den mythischen, quasi-religiösen und fiktionalen Vorstellungen innerhalb von Merkels Text nach, reflektieren die (scheinbar unbedeutende) Rolle des Geldes und hinterfragen den Begriff der Kreativität, den die Mitarbeiter in Merkels erdachter Agentur „GFPD“ so intensiv für sich reklamieren. Die beiden letzten Unterpunkte versuchen die Diskrepanz von „Schein und Sein“ sowohl in der New Economy wie auch im Werbeunternehmen in ‚Das Jahr der Wunder‘ aufzudecken und enthüllen dabei einen oft diffusen, etikettenhaften Sprachgebrauch und eine manchmal vorkommende Inhaltsleere in der modernen Wirtschaftswelt.
1. Arbeit und das Ökonomische in der Literatur der Gegenwart
Obwohl Arbeit einen sowohl gesamtgesellschaftlich wie auch individuell ungeheuer wichtigen Aspekt des menschlichen Lebens ausmacht, wurde sie paradoxerweise in der deutschen Literatur nicht so eingehend behandelt wie andere Themen. Vielleicht liegt ein Grund dafür in der Alltäglichkeit der Arbeit, im Gewohnten, das ja eigentlich nicht Bestandteil von Literatur sein will:
„die bloße Wiedergabe […] von Vorgängen aus der Produktionssphäre produziert nämlich nichts als Langeweile. Literatur [aber] handelt vom Unverhofften und mit dem Unverhofften. […] Jede winzige Katastrophe ist ihr […] erzählenswerter als das Normale, die Routine des Alltags.“1
Schon „in der deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts findet die industrielle Revolution nicht das Echo wie in der englischen und französischen Literatur“2. Dass das Thema Arbeit in der deutschen Literatur auch heute weniger Beachtung (aber nicht: gar keine) findet, ist laut Ralf Winnes genau aus dieser damaligen literaturgeschichtlichen Situation heraus zu erklären.3 Im gleichen Symposium wie Winnes meldet sich Heinrich Droege zu Wort und zitiert zur Erklärung der Arbeitsabstinenz in deutschen literarischen Texten einen alten FAZ-Artikel vom 24.7.59, in dem es heißt:
‚Die jungen Schriftsteller ergreifen heute das Geschäft des Schreibens unmittelbar, nachdem sie Schule und Universität verlassen haben, und kaum einer, der die Welt des Wirtschaftslebens in der Arbeit selbst erlebt hat, es fehlt das Erlebnis des modernen Betriebes, insbesondere des Großbetriebes, als ein erregender Schauplatz menschlicher Größe und menschlicher Niedrigkeit.‘4
Wenn die Beiträge aus dem kleinen Sammelband ‚Erfahrung und Fiktion‘, die allesamt von einer Tagung aus dem Jahr 1991 stammen5 unterm Strich eine Tendenz ausmachen, wonach in der Literatur vor 20 Jahren ebenso wie im 19. Jh. die Thematik Arbeit nicht so viel Aufmerksamkeit erhält wie allgemeinere Themen wie Liebe, Leid und Tod etc., so könnte man sagen, dass ungefähr mit Beginn der Nuller-Jahre die Arbeitswelt und das Ökonomische wieder stärker in den Blickpunkt literarischer Verarbeitung und literaturwissenschaftlicher Betrachtung kommt.6
[...]
1 Baumgart 1993, S. 42.
2 Heckmann 1993, S. 9. Vgl. dazu auch Killy 1993, der zum gleichen Schluss kommt wie Heckmann.
3 Heckmann/Dette (Hgg.) 1993, im Kap. Gespräch und Diskussion S. 117.
4 Heinrich Droege in ebd., S. 118.
5 Tagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung (Darmstadt) und des Gesamtverbandes der metallindustriellen Arbeitgeberverbände am 5./6. Dezember 1991 in Darmstadt. Siehe in Heckmann/Dette (Hgg.) 1993 inneren Titelblatttext zur Buchbeschreibung.
Häufig gestellte Fragen zu "Inhaltsverzeichnis"
Worum geht es in diesem Dokument?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die einen Titel, ein Inhaltsverzeichnis, Zielsetzungen und Schwerpunktthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält.
Was ist der Hauptfokus der Arbeit?
Der Hauptfokus liegt darauf, die fiktionale Werbewelt in Rainer Merkels Roman ‚Das Jahr der Wunder‘ in Bezug zur Arbeitswirklichkeit zu setzen, wobei besonders die New Economy hervorgehoben wird, da die Handlung des Buches in einer Werbeagentur in den 90er Jahren spielt.
Welche Themen werden in der Einleitung angesprochen?
Die Einleitung thematisiert die zunehmende Bedeutung von Arbeit in der Literatur, die Transformationen in der Arbeitswelt und Ökonomie, und die Durchdringung von Ökonomie und Literaturwissenschaft.
Was wird im ersten Kapitel behandelt?
Das erste Kapitel behandelt das Thema Arbeit und das Ökonomische in der zeitgenössischen Literatur und beleuchtet die bisherige "Arbeitsabwesenheit" in der deutschen Literatur.
Welche Aspekte der New Economy werden diskutiert?
Es wird die Herausbildung des "Symbol-Analytikers" als Vertreter einer neuen Form von "immaterieller Arbeit" beschrieben, und seine Relevanz für die New Economy, die immaterielle Werte produziert, wird beleuchtet.
Was wird im dritten Kapitel von Merkels Werk analysiert?
Im dritten Kapitel werden Passagen in Merkels Werk analysiert, in denen sich der Charakter der gegenwärtigen Arbeitswelt manifestiert, moderne Disziplinar- und Machtmechanismen auftauchen, und Subjektivierungstendenzen im Sinne eines zunehmenden Sich-selbst-Regierens stattfinden.
Welche weiteren Unterpunkte werden im Zusammenhang mit Merkels Text behandelt?
Weitere Unterpunkte befassen sich mit mythischen, quasi-religiösen und fiktionalen Vorstellungen, reflektieren die Rolle des Geldes, hinterfragen den Begriff der Kreativität und versuchen die Diskrepanz von „Schein und Sein“ in der New Economy und im Werbeunternehmen aufzudecken.
Warum wurde das Thema Arbeit in der deutschen Literatur bisher weniger behandelt?
Ein Grund könnte in der Alltäglichkeit der Arbeit liegen, im Gewohnten, das nicht Bestandteil von Literatur sein soll. Zudem fehlt oft die Erfahrung der Autoren in der modernen Arbeitswelt.
Welche Schlussfolgerung wird bezüglich der Aufmerksamkeit für Arbeit in der Literatur gezogen?
Es wird festgestellt, dass seit den Nuller-Jahren die Arbeitswelt und das Ökonomische wieder stärker in den Fokus literarischer Verarbeitung und literaturwissenschaftlicher Betrachtung gerückt sind.
- Quote paper
- Michael Thormann (Author), 2010, Die Arbeitswelt der Gegenwart – Eine Analyse anhand von Rainer Merkels Roman ‚Das Jahr der Wunder‘, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168163