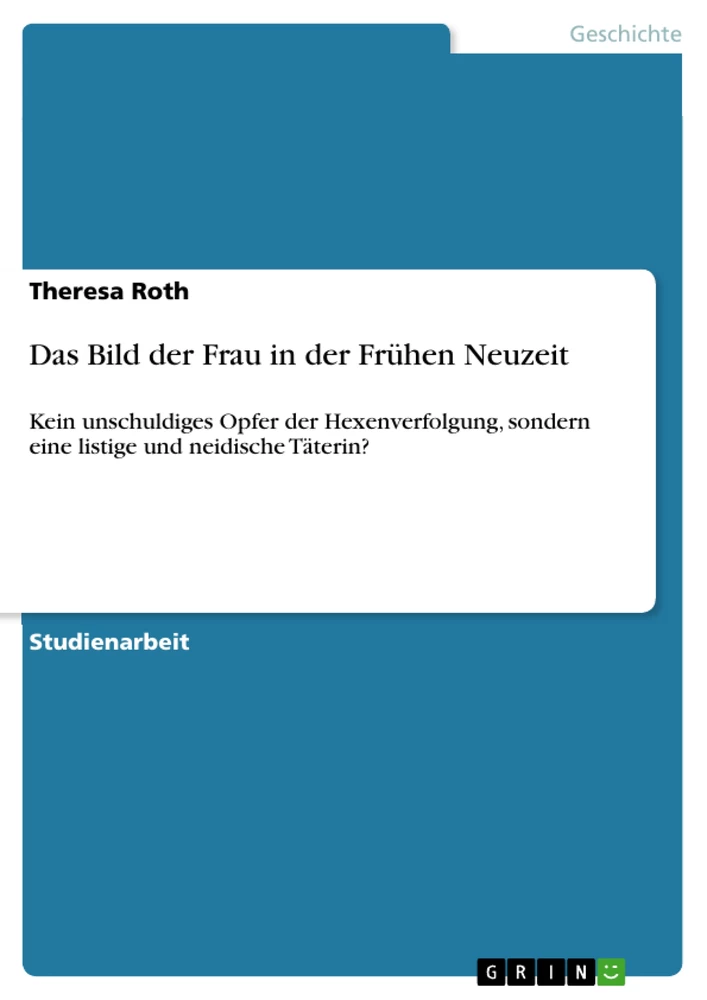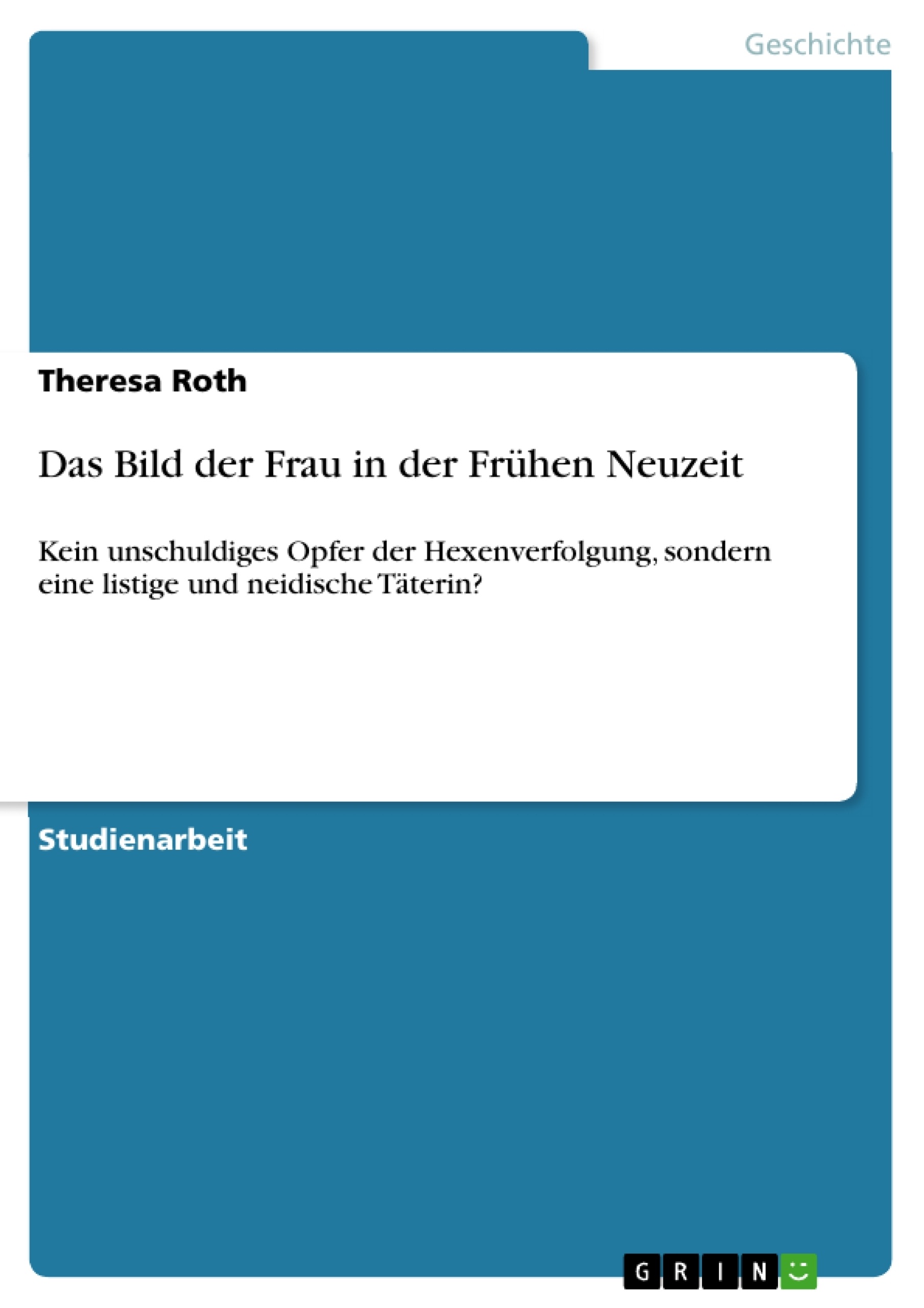Das Bild von der Frau in der Frühen Neuzeit ist unter anderem geprägt von der Angst vor Schadenzauber durch Hexen, die magische Fähigkeiten besaßen und diese für ihre Zwecke einsetzten und Menschen damit verletzen konnten. Der Gedanke, dass Frauen in dieser Zeit (15.-17. Jahrhundert) Opfer der Hexenverfolgung waren und gänzlich unschuldig angeklagt und verurteilt wurden, entspricht nicht mehr dem aktuellen Forschungsstand. Die Frau wird nunmehr als Täterin gesehen, die Wissen und Fähigkeiten von ihren weiblichen Verwandten und Bekannten erlernte und dieses gegebenenfalls auch zum Schaden anderer anwendete. Der 1487 erschienene Hexenhammer dient als Quellengrundlage, speziell ist hier das 6. Kapitel des 1. Buches anzuführen. In diesem Auszug wird die Frau als Nutzerin von Hexerei und definitive Täterin gesehen. Grundlegende Literatur zu diesem Thema bieten Ingrid Ahrendt-Schulte und andere, die hier Anwendung finden. Das Ziel dieser Arbeit soll es sein, eine Antwort auf die Frage zu finden, warum die Frau eine Täterin und kein Opfer der Hexenverfolgung war. Das Thema ist unter anderem in der Frauenforschung aktuell, da die Vorstellung einer Täterin eine Gegenbewegung zum Opfergedanken darstellt. Der Hauptteil ist besteht aus einer Quellenanalyse und einer Quelleninterpretation. Die Analyse ist in vier Aspekte unterteilt, die Einteilung des weiblichen Geschlechts in zwei Wesen, welche Frauen anfällig für das Hexensein zu sein schienen, die Mängel von Frauen und die Gründe für die Hexenausbreitung. Der zweite Teil befasst sich mit der Interpretation eines speziellen Aspektes: die Frau als Chimäre, eine Metapher für den Zwiespalt der frühneuzeitlichen Frau.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- A. Quellenanalyse
- A.I. Einteilung von Frauen
- I.1. Gute Geister
- I.2. Böse Geister
- A.II. Welche Frauen wurden vom Teufel ausgesucht?
- A.III. Mängel der Frau
- III.1. Bosheit
- III.2. Schwäche
- III.3. Ruchlosigkeit
- A.IV. Gründe der Hexenausbreitung
- IV.1. Sicherung des Lebensunterhalts
- IV.2. Rachegedanke
- IV.3. Streitsucht
- A.I. Einteilung von Frauen
- B. Quelleninterpretation
- B.I. Die Frau als Chimäre
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Bild der Frau in der Frühen Neuzeit im Kontext der Hexenverfolgung. Sie hinterfragt die traditionelle Opferrolle der Frau und beleuchtet stattdessen ihre Darstellung als aktive Täterin. Der Fokus liegt auf der Analyse des „Hexenhammer“ und weiterer Quellen, um die Gründe für die Zuschreibung von Hexerei zu Frauen zu verstehen.
- Das Bild der Frau in der Frühen Neuzeit
- Die Frau als Täterin und nicht nur als Opfer der Hexenverfolgung
- Analyse des „Hexenhammer“ als Quelle
- Die Ursachen der Hexenverfolgung
- Soziokulturelle Faktoren, die zur Stigmatisierung von Frauen beitrugen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Rolle der Frau in der Hexenverfolgung in der Frühen Neuzeit vor. Sie bricht mit dem traditionellen Opferbild und betont den aktuellen Forschungsstand, der die Frau vermehrt als Täterin darstellt. Der „Hexenhammer“ wird als zentrale Quelle genannt, und die methodische Vorgehensweise, bestehend aus Quellenanalyse und -interpretation, wird umrissen. Das Ziel ist, die Gründe für die Zuschreibung von Täterrolle an Frauen zu untersuchen.
A. Quellenanalyse: Dieser Abschnitt analysiert verschiedene Aspekte der Quellen, um das Bild der Frau in der Frühen Neuzeit zu rekonstruieren. Er beginnt mit der Einteilung von Frauen in „gute“ und „böse“ Geister, wobei die ersteren als fromm und unterwürfig, die letzteren als böse und fähig zu Zauberei dargestellt werden. Die Analyse untersucht, welche Frauentypen besonders der Hexerei bezichtigt wurden (z.B. Hebammen, Frauen, die mit Kräutern arbeiteten). Schließlich werden verschiedene Gründe für die Ausbreitung von Hexenbeschuldigungen erörtert, wie z.B. die Sicherung des Lebensunterhalts oder Rachegedanken.
B. Quelleninterpretation: Dieser Abschnitt interpretiert einen spezifischen Aspekt der Quellenanalyse, nämlich die Metapher der Frau als Chimäre. Diese Metapher soll den Widerspruch und die Ambivalenz im Bild der frühneuzeitlichen Frau verdeutlichen, die gleichzeitig als Quelle des Guten und des Bösen gesehen wurde. Die Analyse beleuchtet die komplexen sozialen und kulturellen Faktoren, welche zu dieser ambivalenten Darstellung führten.
Schlüsselwörter
Frau, Frühe Neuzeit, Hexenverfolgung, Hexenhammer, Quellenanalyse, Quelleninterpretation, Täterin, Opfer, Dämonologie, Magie, Frauenbild, soziale Geschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Analyse des Frauenbildes in der Frühen Neuzeit im Kontext der Hexenverfolgung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Bild der Frau in der Frühen Neuzeit, speziell im Kontext der Hexenverfolgung. Sie geht über das traditionelle Opferbild hinaus und analysiert die Darstellung der Frau als aktive Täterin. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse des „Hexenhammer“ und weiterer Quellen, um die Gründe für die Zuschreibung von Hexerei an Frauen zu verstehen.
Welche Quellen werden analysiert?
Die Arbeit analysiert den „Hexenhammer“ sowie weitere, nicht näher spezifizierte Quellen, um das Bild der Frau in der Frühen Neuzeit zu rekonstruieren. Die Analyse umfasst sowohl die direkte Quellenanalyse als auch die Interpretation der Ergebnisse.
Welche methodische Vorgehensweise wird verwendet?
Die Arbeit verwendet eine zweiphasige Methodik: Zuerst wird eine Quellenanalyse durchgeführt, die verschiedene Aspekte der Quellen beleuchtet (Einteilung der Frauen, Gründe für Hexenbeschuldigungen usw.). Im zweiten Schritt folgt eine Quelleninterpretation, die die gewonnenen Erkenntnisse aus der Quellenanalyse vertieft und interpretiert (z.B. die Metapher der Frau als Chimäre).
Wie werden Frauen in den Quellen dargestellt?
Die Quellen zeigen eine ambivalente Darstellung der Frau. Sie werden in „gute“ und „böse“ Geister eingeteilt. „Gute“ Frauen werden als fromm und unterwürfig dargestellt, „böse“ Frauen als böse und fähig zu Zauberei. Die Analyse untersucht auch, welche Frauentypen besonders der Hexerei bezichtigt wurden (z.B. Hebammen).
Welche Gründe für die Ausbreitung von Hexenbeschuldigungen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Gründe für die Ausbreitung von Hexenbeschuldigungen, darunter die Sicherung des Lebensunterhalts, Rachegedanken und Streitsucht.
Was ist die zentrale Interpretationsmetapher?
Die zentrale Interpretationsmetapher ist die Darstellung der Frau als Chimäre. Diese Metapher soll den Widerspruch und die Ambivalenz im Bild der frühneuzeitlichen Frau verdeutlichen, die gleichzeitig als Quelle des Guten und des Bösen gesehen wurde.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Das Bild der Frau in der Frühen Neuzeit; Die Frau als Täterin und nicht nur als Opfer der Hexenverfolgung; Analyse des „Hexenhammer“ als Quelle; Die Ursachen der Hexenverfolgung; Soziokulturelle Faktoren, die zur Stigmatisierung von Frauen beitrugen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text?
Schlüsselwörter sind: Frau, Frühe Neuzeit, Hexenverfolgung, Hexenhammer, Quellenanalyse, Quelleninterpretation, Täterin, Opfer, Dämonologie, Magie, Frauenbild, soziale Geschichte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, einen Abschnitt zur Quellenanalyse, einen Abschnitt zur Quelleninterpretation und eine Schlussbemerkung. Die Quellenanalyse unterteilt sich in die Einteilung von Frauen, die Auswahl der Frauen durch den Teufel, die Mängel der Frau und die Gründe der Hexenausbreitung. Die Quelleninterpretation konzentriert sich auf die Frau als Chimäre.
- Quote paper
- Theresa Roth (Author), 2007, Das Bild der Frau in der Frühen Neuzeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168192