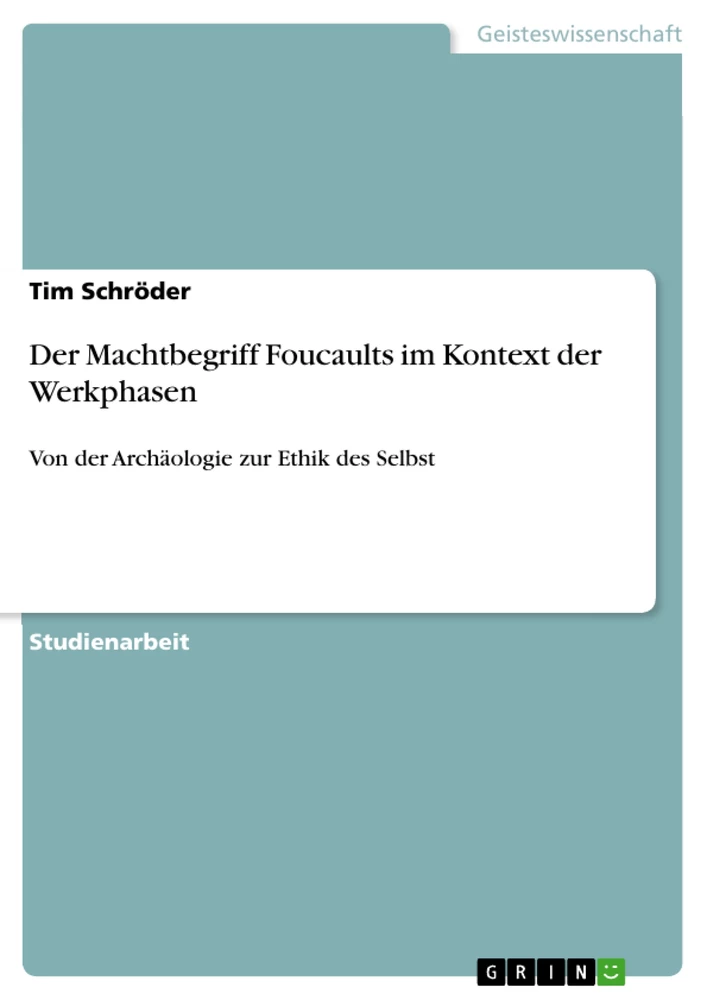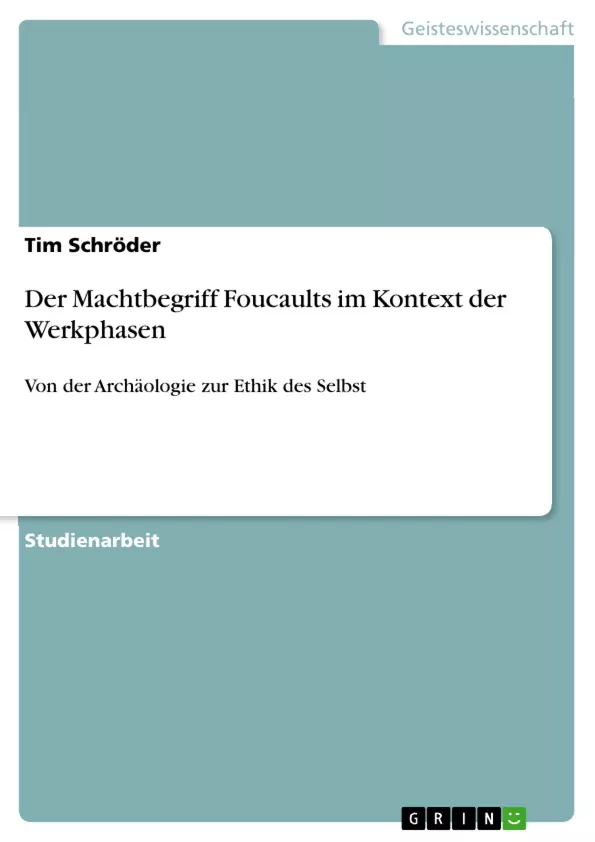Wer sich von einem kulturwissenschaftlichen Standpunkt aus dem Machtbegriff nähert, kommt an Michel Foucault nicht vorbei. Dessen Gesamtwerk wird üblicherweise chronologisch in drei Phasen eingeteilt: 1) die am Grundbegriff des „Diskurses“ orientierte „Archäologie“ der 1960er, 2) die um den Begriff der „Macht“ herum gebaute „Genealogie“ der 1970er und 3) die „Ethik“ der „Sorge um sich“ aus den 1980er Jahren. Vorrangiges Ziel dieses Aufsatzes ist es, die Entwicklung des Machtbegriffs Foucaults im Rahmen der genealogischen Phase nachzuvollziehen. Wenn man sich aber
auf die Suche nach den Spuren der Macht bei Foucault begibt, wird schnell deutlich, dass eine chronologische und thematische Umgrenzung keineswegs eindeutig möglich ist. Die Machtthematik ist bereits in der Archäologie angelegt und wird auch in der Phase der Ethik nicht suspendiert. Zudem stehen alle drei Themenbereiche in engem Bezug zueinander. Es wird deshalb die Aufgabe sein, den genealogischen Machtbegriff Foucaults mit Bezug auf das Ge-
samtwerk kritisch zu rekonstruieren. Nimmt man das Gesamtprojekt als Maßstab, so kommt der Kritik an Foucaults ubiquitärem Machtbegriff, so wird sich am Ende zeigen, ihr Gegenstand abhanden. Die Kritik muss an anderer Stelle ansetzen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung.
- Das „Projekt\" Foucaults und das Erbe Nietzsches....
- Archäologie: Vom Schweigen des Wahnsinns zur Diskursanalyse..........\li>
- Die Ordnung des Diskurses (1970).
- Wahnsinn und Gesellschaft (1961).
- Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen Blicks 1963.
- Archäologie des Wissens, 1969.
- Von der Archäologie zur Dynastik, 1972.
- Genealogie: Die explizite Frage nach der Macht....
- Vom Problem diskursiver Ordnung zur Genealogie.
- Überwachen und Strafen (1975).
- Sexualität und Wahrheit I: Der Wille zum Wissen (1976).
- Geschichte der Gouvernementalität (1978).
- Die Ethik des Selbst .......
- Fazit
- Literatur..
- Siglenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Dieser Aufsatz zielt darauf ab, die Entwicklung des Machtbegriffs Michel Foucaults im Kontext seiner genealogischen Werkphase zu untersuchen. Obwohl die Machtthematik in allen drei Phasen seines Gesamtwerks präsent ist, liegt der Fokus hier auf der genealogischen Phase der 1970er Jahre. Der Aufsatz strebt eine kritische Rekonstruktion des genealogischen Machtbegriffs Foucaults an, indem er seine Entwicklung im Verhältnis zu seinem Gesamtwerk betrachtet.
- Das „Projekt“ Foucaults und das Erbe Nietzsches
- Die Spuren der Macht in der Archäologie
- Die explizite Ausformulierung des Machtbegriffs in der Genealogie
- Die Frage nach der Überschreitung von Machtverhältnissen in der Ethik
- Kritik an Foucaults ubiquitärem Machtbegriff
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Struktur des Aufsatzes vor. Kapitel 2 beleuchtet Foucaults „Projekt“ und seine Verbindung zu Nietzsches Werk. Kapitel 3 erörtert die Spuren der Macht in Foucaults archäologischer Phase, während Kapitel 4 die explizite Ausformulierung des Machtbegriffs in der genealogischen Phase untersucht.
Schlüsselwörter (Keywords)
Der Aufsatz beschäftigt sich mit Michel Foucaults Machtbegriff, der Genealogie, der Archäologie, der Diskursanalyse, der Ethik des Selbst und Nietzsches Einfluss auf Foucaults Werk. Die Analyse betrachtet die Entwicklung des Machtbegriffs in den verschiedenen Werkphasen Foucaults.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird das Gesamtwerk von Michel Foucault chronologisch eingeteilt?
Das Werk wird üblicherweise in drei Phasen unterteilt: Die „Archäologie“ der 1960er Jahre (Fokus auf Diskurs), die „Genealogie“ der 1970er Jahre (Fokus auf Macht) und die „Ethik“ der 1980er Jahre (Fokus auf die Sorge um sich).
Was ist das Hauptziel dieser Analyse zum Machtbegriff?
Vorrangiges Ziel ist es, die Entwicklung von Foucaults Machtbegriff innerhalb der genealogischen Phase kritisch zu rekonstruieren und in Bezug zum Gesamtwerk zu setzen.
Ist das Thema Macht nur in der genealogischen Phase Foucaults relevant?
Nein, die Machtthematik ist bereits in der Archäologie angelegt und bleibt auch in der Phase der Ethik präsent. Eine strikte chronologische Trennung ist laut dem Aufsatz nicht eindeutig möglich.
Welchen Einfluss hatte Friedrich Nietzsche auf Foucaults Projekt?
Nietzsches Erbe spielt eine zentrale Rolle für Foucaults „Projekt“, insbesondere im Hinblick auf die methodische Herangehensweise der Genealogie und die Hinterfragung von Wahrheitsansprüchen.
Was wird unter dem „ubiquitären“ Machtbegriff Foucaults verstanden?
Damit ist die Vorstellung gemeint, dass Macht überall (allgegenwärtig) in sozialen Beziehungen wirkt, was oft Gegenstand von Kritik an Foucaults Theorie ist.
Welche Werke werden im Kontext der Archäologie untersucht?
Dazu gehören unter anderem „Wahnsinn und Gesellschaft“, „Die Geburt der Klinik“ und die „Archäologie des Wissens“.
- Arbeit zitieren
- Tim Schröder (Autor:in), 2009, Der Machtbegriff Foucaults im Kontext der Werkphasen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168246