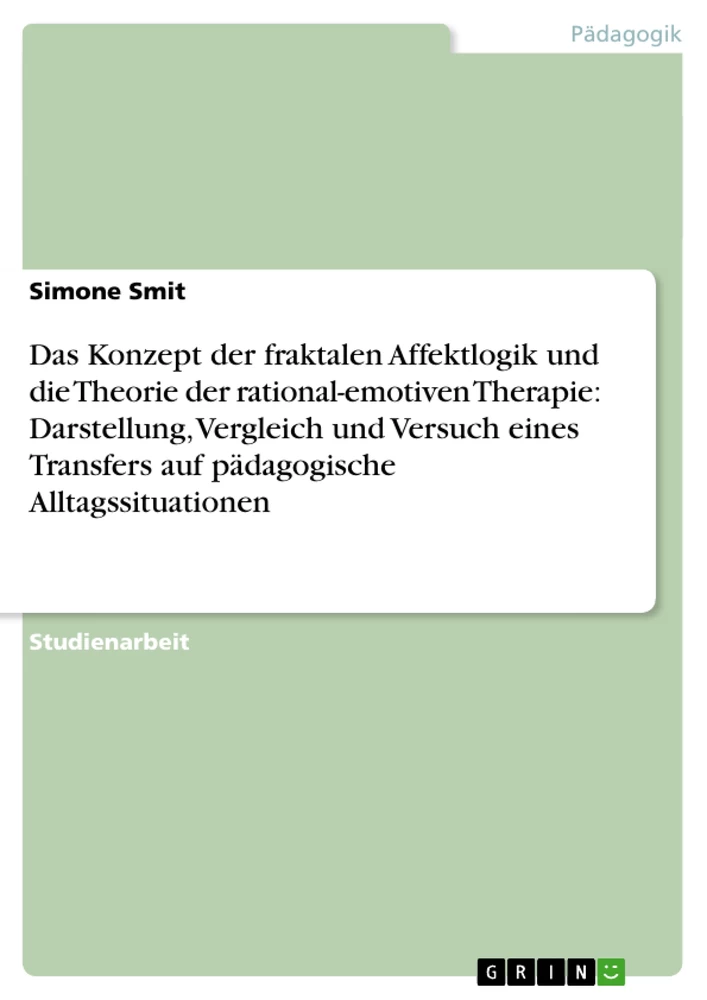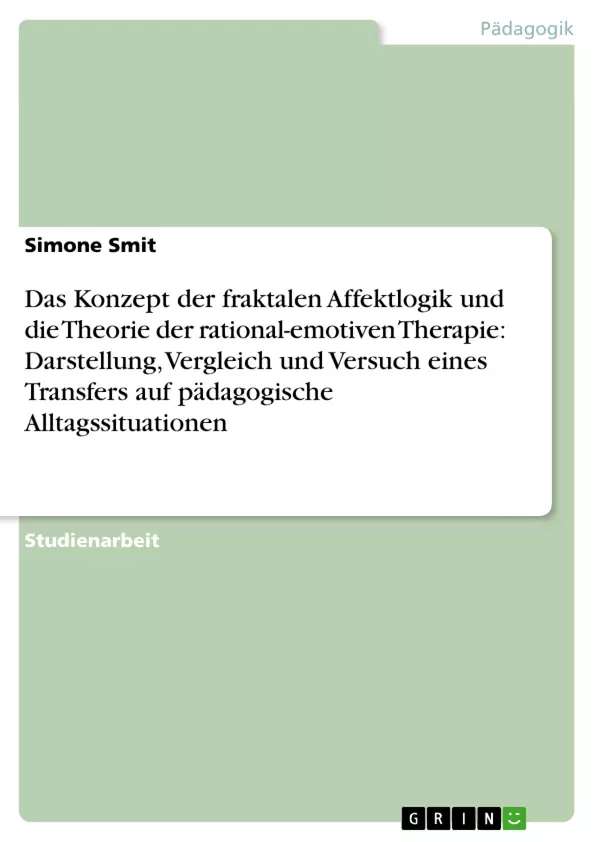[...] Gerade von der
Theorie der rational- emotiven Therapie verspreche ich mir einen sehr großen
persönlichen Nutzen, da ich es mir später auch vorstellen kann, als Beraterin bzw.
Therapeutin tätig zu werden. Außerdem werde ich in den nächsten Semesterferien
mein zweimonatiges Grundpraktikum in einer Beratungsstelle für katholische
Frauen absolvieren.
Ein weiterer wichtiger Anreiz ist für mich die Tatsache, daß sich hinter diesem
kleinen Begriff „Gefühl“ soviel mehr verbirgt, als man überhaupt annimmt. Es gibt
noch einige unbeantwortete Fragen und einzelne Bereiche, die wissenschaftlich
noch lange nicht ausgeschöpft sind. Allerdings verändern sich mit der Zeit auch
einige Aspekte, so daß man an dieser Stelle dann wieder von neuem anfangen
kann zu forschen oder sich viele neue Vergleichsmöglichkeiten anbieten. Es ist
einfach erstaunlich: Jeder Mensch hat Gefühle und macht von ihnen im
zwischenmenschlichen Bereich Gebrauch, doch das Wie oder Warum kann sich
keiner so recht erklären! Daher denke ich, daß ich beim Schreiben der Hausarbeit
die Chance habe, mich noch weiter in diese Materie hineinzuarbeiten und vielleicht
ein paar Antworten oder ein paar neue Denkanstöße zu bekommen, die mir in naher Zukunft bestimmt von Nutzen sein werden. Wie auch schon das Deckblatt verrät, werde ich in meiner Hausarbeit zunächst
einmal die wichtigsten Begriffe des jeweiligen Ansatzes erklären, bevor ich dann
auf den einzelnen Ansatz selbst eingehe und ihn vorstelle. Anschließend erfolgt ein
Vergleich der beiden Theorien, damit die jeweiligen Unterschiede oder auch
Gemeinsamkeiten noch einmal deutlich werden. Danach folgt eine persönliche
Einschätzung der beiden Theorien und abschließend erfolgt meine
Transferleistung. Diese wird daraus bestehen, daß ich versuchen werde, beide
Ansätze in den pädagogischen Alltag, also in typische pädagogische Situationen
zu übertragen und einschätzen werde, wann und warum die eine oder andere
Theorie aus meiner Sicht empfehlenswerter anzuwenden ist.
Zum Aufbau der Arbeit ist nur soviel zu sagen, daß ich mich beim Vorstellen der
beiden Ansätze ausschließlich auf die Werke von Luc Ciompi und Albert Ellis
sowie Russell Grieger beziehe.
Beim Erklären des Begriffes „Affekt“ habe ich zusätzlich noch das Wörterbuch der
Pädagogik von Winfried Böhm, das Buch von Reinhard Pekrun sowie die
Zeitschrift „Spektrum der Wissenschaft“ verwendet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundbegriffe der fraktalen Affektlogik
- Affekt
- Affektlogik
- Das Konzept der fraktalen Affektlogik
- Grundbegriffe der Theorie der rational-emotiven Therapie
- Eine aktivierende Erfahrung oder ein aktivierendes Ereignis (A)
- Die persönliche Überzeugung (B)
- Die Konsequenzen (C)
- Der rationale Disput (D)
- Der therapeutische Effekt (E)
- Die Theorie der rational-emotiven Therapie
- Vergleich der beiden Ansätze
- Wie und warum kann man aus meiner persönlichen Sicht von den beiden Theorien im pädagogischen Alltag am besten profitieren?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der fraktalen Affektlogik und der rational-emotiven Therapie. Ziel ist es, die beiden Ansätze darzustellen, zu vergleichen und zu untersuchen, wie sie im pädagogischen Alltag angewendet werden können. Der Schwerpunkt liegt auf der Erläuterung der zentralen Konzepte beider Theorien und der Analyse ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
- Die fraktale Affektlogik als Ansatz zur Beschreibung von Emotionen
- Die Theorie der rational-emotiven Therapie und ihre Grundprinzipien
- Vergleich der beiden Ansätze hinsichtlich ihrer Grundannahmen und Methoden
- Mögliche Transfermöglichkeiten der beiden Theorien in den pädagogischen Alltag
- Bewertung der Anwendbarkeit der Theorien in verschiedenen pädagogischen Situationen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Hausarbeit stellt die beiden Ansätze der fraktalen Affektlogik und der rational-emotiven Therapie vor und erläutert die Motivation für die Beschäftigung mit diesem Thema.
- Grundbegriffe der fraktalen Affektlogik: Dieses Kapitel definiert die wichtigsten Begriffe der fraktalen Affektlogik, insbesondere den Begriff des Affekts und der Affektlogik.
- Das Konzept der fraktalen Affektlogik: In diesem Kapitel wird das Konzept der fraktalen Affektlogik detaillierter dargestellt und erklärt.
- Grundbegriffe der Theorie der rational-emotiven Therapie: Dieses Kapitel definiert die zentralen Elemente der rational-emotiven Therapie, wie z. B. die aktivierende Erfahrung, die persönliche Überzeugung, die Konsequenzen, den rationalen Disput und den therapeutischen Effekt.
- Die Theorie der rational-emotiven Therapie: Dieses Kapitel präsentiert die Theorie der rational-emotiven Therapie in ihrer Gesamtheit.
- Vergleich der beiden Ansätze: In diesem Kapitel werden die beiden Ansätze miteinander verglichen, um ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen.
- Wie und warum kann man aus meiner persönlichen Sicht von den beiden Theorien im pädagogischen Alltag am besten profitieren?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Übertragbarkeit der beiden Theorien auf den pädagogischen Alltag und stellt Überlegungen zur Anwendung in konkreten pädagogischen Situationen an.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Hausarbeit sind: fraktale Affektlogik, rational-emotive Therapie, Affekt, Emotionen, Kognitionen, Verhalten, Pädagogik, Alltagssituationen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Kernkonzept der fraktalen Affektlogik?
Die fraktale Affektlogik nach Luc Ciompi beschreibt das komplexe Zusammenspiel von Fühlen und Denken und wie Affekte die kognitiven Prozesse strukturieren.
Wie funktioniert die rational-emotive Therapie (RET)?
Die RET nach Albert Ellis basiert auf dem ABC-Modell: Ein aktivierendes Ereignis (A) führt über persönliche Überzeugungen (B) zu emotionalen Konsequenzen (C). Durch rationalen Disput (D) wird ein therapeutischer Effekt (E) erzielt.
Was sind die Hauptunterschiede zwischen beiden Ansätzen?
Während die Affektlogik eher ein theoretisches Modell zur Beschreibung der Psyche ist, ist die RET ein praktisches therapeutisches Verfahren zur Veränderung irrationaler Denkmuster.
Können diese Theorien im pädagogischen Alltag genutzt werden?
Ja, die Arbeit untersucht den Transfer auf pädagogische Situationen, um Lehrkräften oder Beratern zu helfen, die emotionalen Reaktionen von Schülern besser zu verstehen und zu steuern.
Welche Rolle spielen "irrational Überzeugungen" in der RET?
Sie gelten als Hauptursache für psychische Probleme. Ziel der Therapie ist es, diese durch rationale Überzeugungen zu ersetzen, um gesündere emotionale Reaktionen zu ermöglichen.
- Quote paper
- Simone Smit (Author), 2000, Das Konzept der fraktalen Affektlogik und die Theorie der rational-emotiven Therapie: Darstellung, Vergleich und Versuch eines Transfers auf pädagogische Alltagssituationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/16834