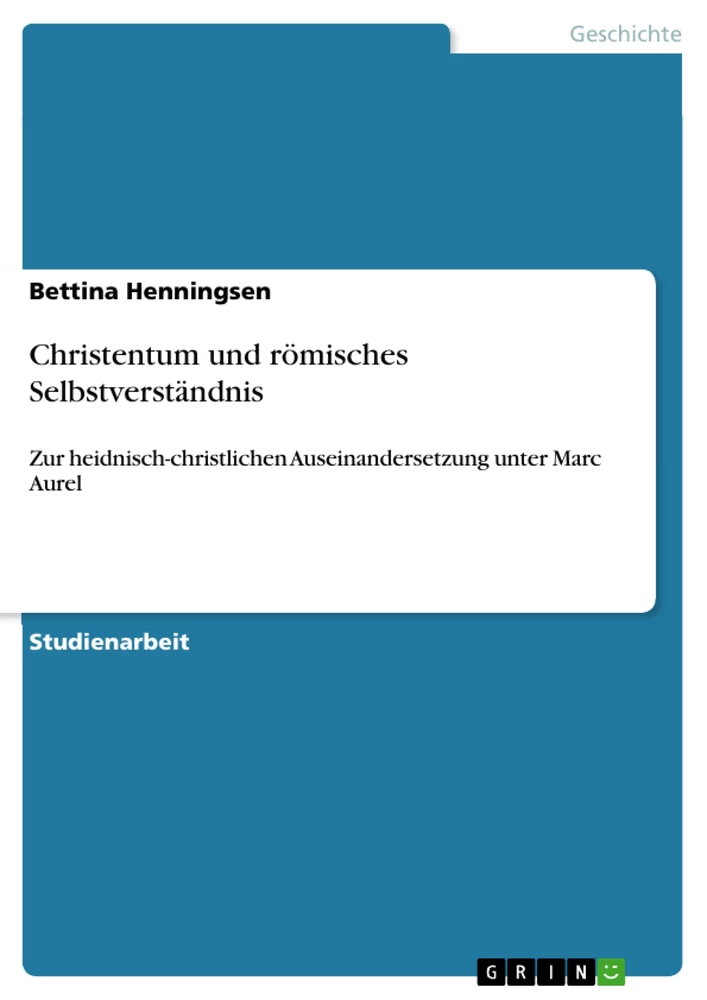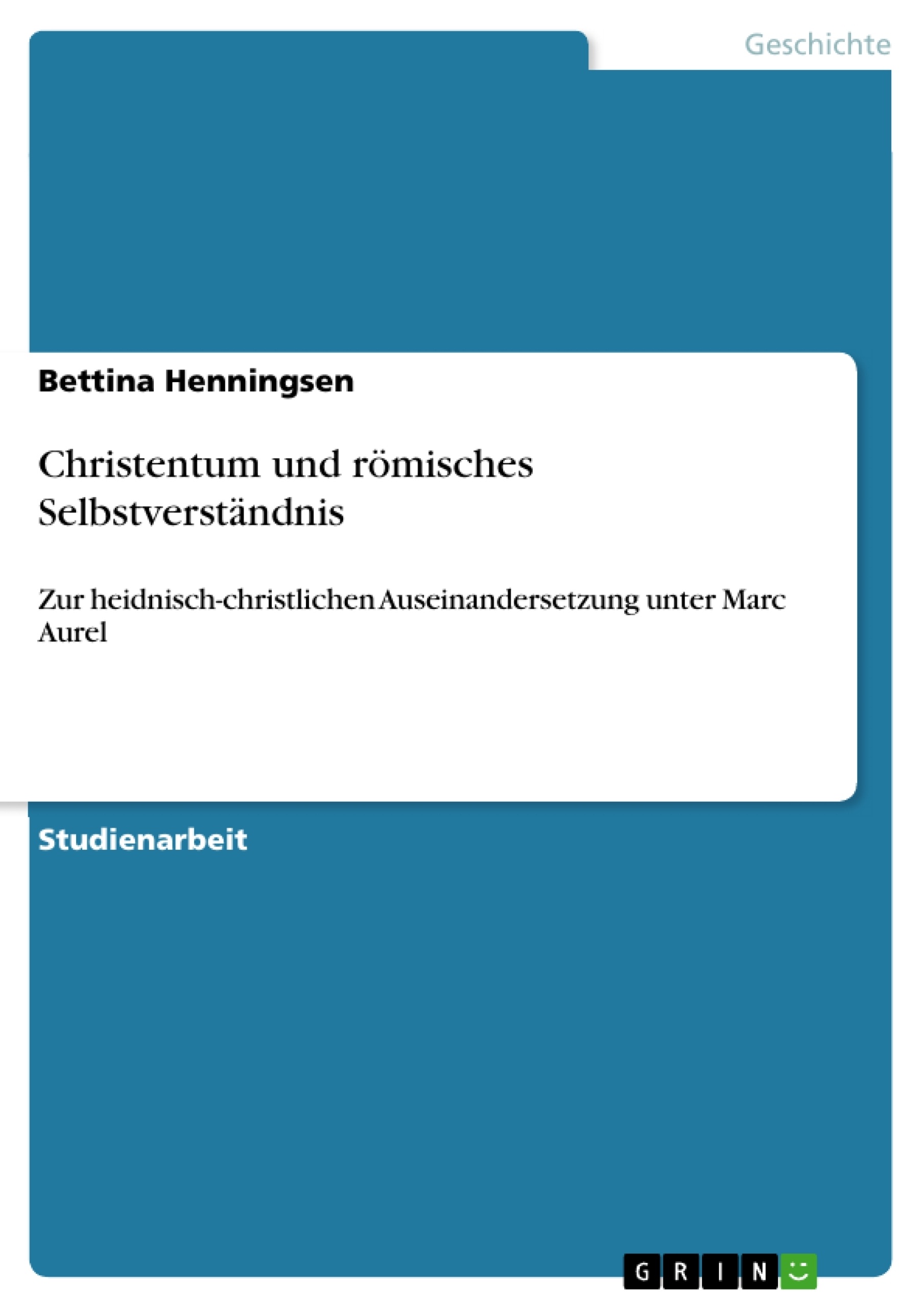Das Bild, das sich uns bei der Person Mark Aurels darstellt, ist widersprüchlich. Zum einen ist es gekennzeichnet durch eine intensive Beschäftigung mit der stoischen Philosophie, zum anderen zeigt es den Kaiser, der Zeit seines Lebens versucht hat, die Gegensätze in der römischen Kultur, Religion und Gesellschaft in Einklang zu bringen. Dabei hatte er einen schweren Stand, Staat und Volk waren geschwächt durch Kriege, Seuchen und Unruhen. Es war eine Zeit, in der die Bevölkerung nach einem Schuldigen für ihr Unglück suchte; das Gleichgewicht innerhalb des Staates und das Vertrauen in die römische Politik waren gefährdet.
Der Philosoph Mark Aurel träumt von der Einheit des römischen Staates. Als Kaiser muß er aber auf die Wut und Furcht seines Volk reagieren, welches die sich im römischen Reich ausbreitende christliche Religion und seine Anhänger für die Verluste und Rückschläge verantwortlich macht. Deutlich wird die Rolle des Kaisers insbesondere im Hinblick auf die Gesetzgebung. Wie war Mark Aurels Verhältnis zur christlichen Religion? Welches Bild hatte die römisch-heidnische Gesellschaft vom Christentum?
Liegt Marta Sordi mit ihrer These richtig, in der sie die Zeit Mark Aurels als Wendepunkt in der Geschichte der Beziehung zwischen Christentum und römischem Imperium bezeichnet?
Im folgenden soll untersucht werden, inwiefern die neue Religion zum Feindbild des Reiches werden konnte und wie infolge dessen eine Diskussion auf geistig-literarischer Ebene begann, die sowohl das traditionell-römische als auch das christliche Selbstverständnis widerspiegelte. Darüber hinaus sollen anhand des „Regenwunders“ Motive und Methode der christlichen Apologetik erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Mark Aurel und die Philosophie
- Die philosophische und religiöse Haltung Mark Aurels
- Das Verhältnis der Römer zum Christentum
- Beurteilung durch die römische Gesellschaft
- Die Christen als Staatsfeinde
- Römische Gesetzgebung und aktive Christenverfolgung
- Das Verhältnis der christlichen Religion zur Philosophie
- Zur christlich-heidnischen Auseinandersetzung: Das „Regenwunder“
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht die komplexen Beziehungen zwischen dem Christentum und dem römischen Selbstverständnis während der Herrschaft von Marc Aurel. Sie analysiert, wie die neue Religion zum Feindbild des Reiches werden konnte und welche geistig-literarischen Debatten diese Entwicklung auslöste. Darüber hinaus wird das „Regenwunder“ als Beispiel für Motive und Methoden der christlichen Apologetik betrachtet.
- Die philosophische und religiöse Haltung von Marc Aurel
- Das Verhältnis der römischen Gesellschaft zum Christentum
- Die Rolle der römischen Gesetzgebung in der Christenverfolgung
- Die Auseinandersetzung zwischen christlicher Religion und Philosophie
- Das „Regenwunder“ als Beispiel für christliche Apologetik
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die Person Marc Aurels vor, dessen ambivalente Rolle als stoischer Philosoph und Kaiser im Spannungsfeld zwischen Tradition und Neuerungen im Römischen Reich beleuchtet wird. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage, wie er mit der Verbreitung des Christentums und der daraus resultierenden Herausforderungen für die römische Gesellschaft umging.
Kapitel 2 widmet sich Mark Aurels philosophischer und religiöser Haltung. Es beschreibt die Verbindung der traditionellen Staatsreligion mit dem stoischen Gedankengut und untersucht die Kernpunkte seiner philosophischen Grundhaltung, insbesondere die Vorstellung von der Einheit des Universums und der Gleichheit aller Menschen.
Kapitel 3 untersucht das Verhältnis der römischen Gesellschaft zum Christentum. Es beleuchtet die Beurteilung der Christen durch die römische Gesellschaft, ihre Stigmatisierung als Staatsfeinde und die Rolle der römischen Gesetzgebung in der Christenverfolgung. Es analysiert die Ursachen für die Ablehnung der christlichen Religion durch die römischen Eliten, insbesondere die Ablehnung des Kaiserkultes und die Furcht vor einer destabilisierenden neuen Religion.
Kapitel 4 befasst sich mit dem Verhältnis der christlichen Religion zur Philosophie. Es analysiert die geistig-literarische Auseinandersetzung zwischen dem Christentum und der römischen Philosophie und untersucht die Argumentationsstrategien beider Seiten.
Kapitel 5 analysiert das "Regenwunder" als Beispiel für christliche Apologetik. Es beleuchtet die Motive und Methoden der christlichen Polemik und untersucht, wie Christen ihre Religion in einer heidnischen Welt verteidigten.
Schlüsselwörter (Keywords)
Marc Aurel, Stoizismus, Christentum, römisches Selbstverständnis, heidnisch-christliche Auseinandersetzung, Staatsreligion, Christenverfolgung, Apologetik, "Regenwunder".
- Citation du texte
- M. A. Bettina Henningsen (Auteur), 2002, Christentum und römisches Selbstverständnis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168346