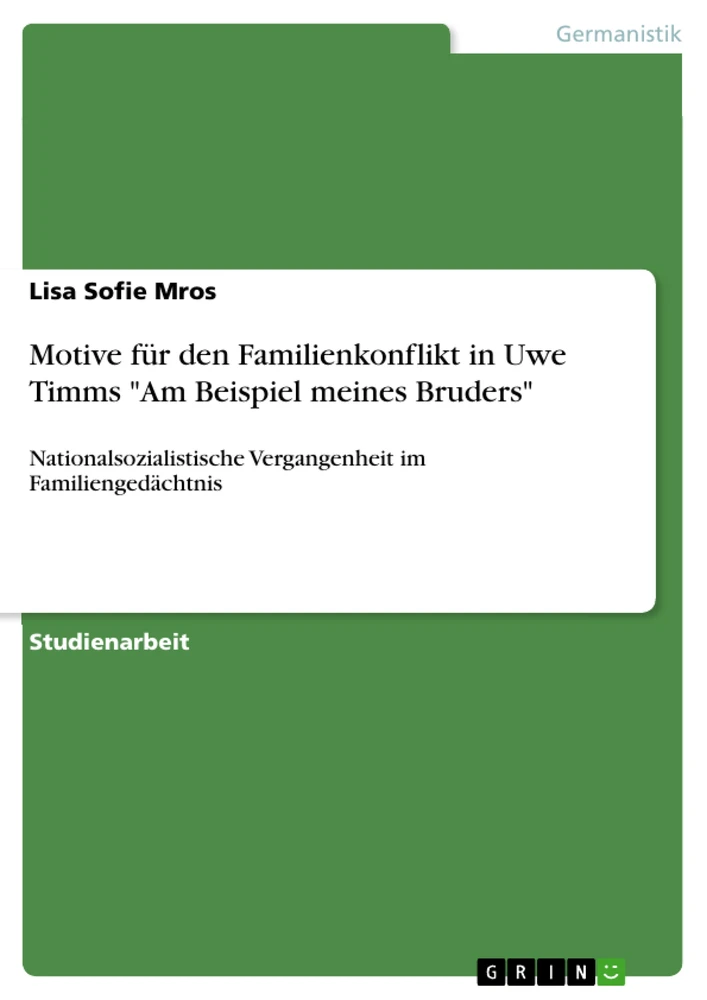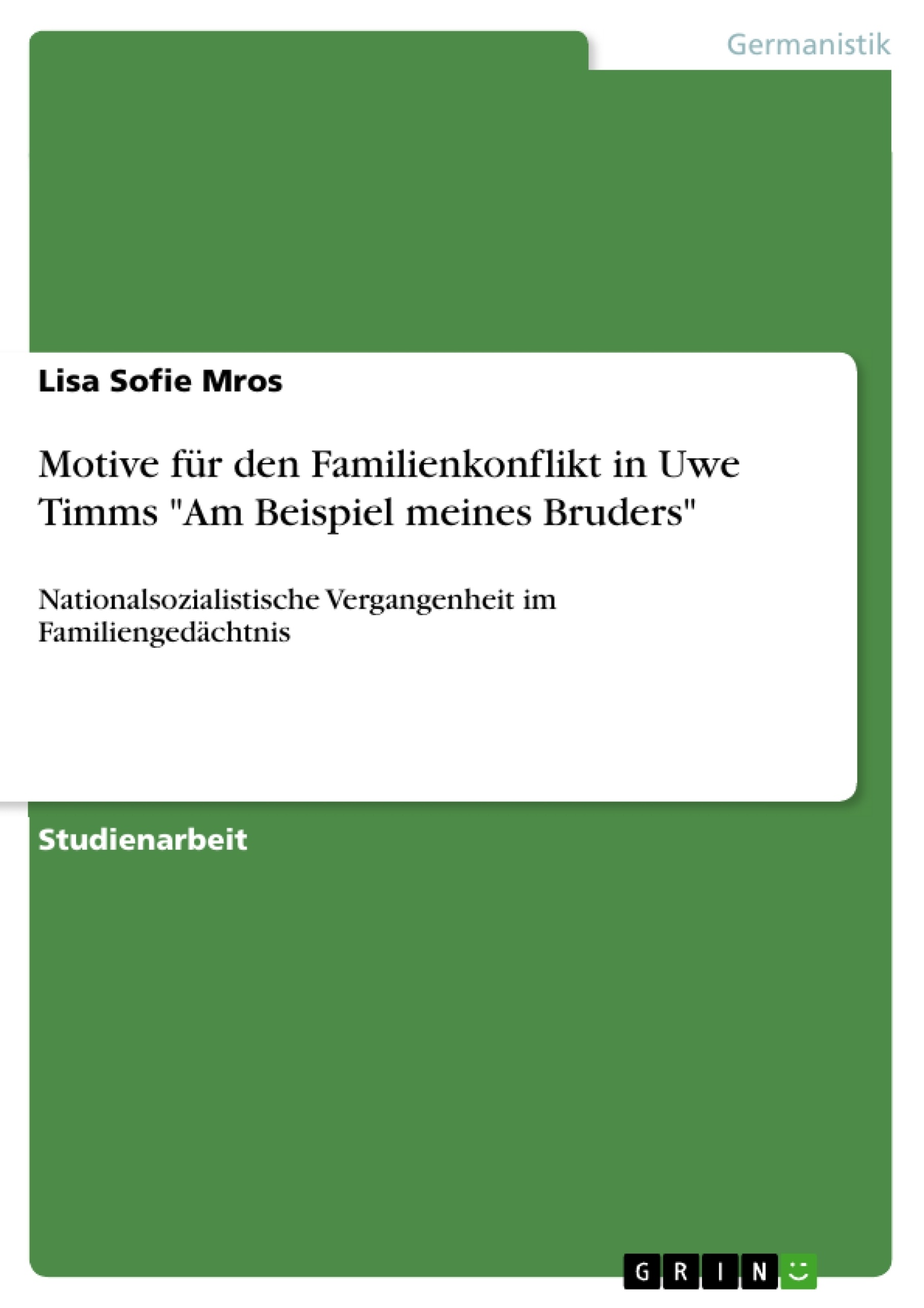Die folgende Ausarbeitung (...) beschäftigt sich mit den familiären Spannungen in Uwe Timms autobiografischem Werk „Am Beispiel meines Bruders“, das 2005 erschienen ist. Im Kontext dieser Arbeit sollen die Gründe für den Konflikt erforscht werden, der im Fall von Timms Werk unweigerlich mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Nationalsozialismus in Verbindung steht.
Das Faszinierende an Uwe Timms Werk ist für mich die auf jeder Seite spürbare und verzweifelte Suche nach der eigenen Identität, die Timm nur durch Aufarbeitung der familiären Verhältnisse zu finden glaubt. Sein Schreibstil ermöglichte mir als Leserin einen tiefen Einblick in sein Innenleben. Es ist beeindruckend zu lesen, in welcher Art und Weise sich prägende Ereignisse wie der Zweite Weltkrieg in der menschlichen Psyche niederschlagen und welche Auswirkungen das auf das gesamte Leben eines Menschen haben kann. „Am Beispiel meines Bruders“ zeigt eindringlich, welche Konsequenzen sich daraus für das Zusammenleben innerhalb der Familie ergeben und die vermeintlich unüberwindbare Kluft zwischen verschiedenen Generationen. Es war folglich dieser psychologische Aspekt des Buches, der ausschlaggebend für die Wahl des Arbeitsthemas war. Aus diesem Grund wird die generationenspezifische Verarbeitung und Tradierung des nationalsozialistischen Faschismus und des Holocaust einen weiteren Aspekt der Arbeit bilden.
Inhaltsverzeichnis:
(...) Das 2. Kapitel wird die für die Arbeit notwendigen Begriffserklärungen von Generationenkonflikt und Familiengedächtnis vornehmen.
In Kapitel 3 wird schließlich der literarische und inhaltliche Gegenstand des betreffenden Werks benannt, um die Verstehensbasis für die darauf folgenden Kapitel zu gewährleisten.
Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt auf dem 4. Kapitel, in dem ich die Analyse zweier Faktoren vornehme, die für den Konflikt innerhalb der Familie Timm verantwortlich sind. Es wird sowohl das schwierige Verhältnis zwischen Uwe Timm und seinem Vater Betrachtung finden (4.1) als auch das Bild des verstorbenen Bruders Karl-Heinz im Familiengedächtnis (4.2). In zwei Unterkapiteln werde ich den Bruder in der subjektiven Wahrnehmung der Eltern (4.2.1) und aus der bemüht objektiven Betrachtungsweise des Bruders Uwe Timm (4.2.2) analysieren.
Die Analyse der Familie erfolgt unter ständiger Bezugnahme auf Timms Werk und ausgewählte Literatur zu diesem Forschungsaspekt. Beides befindet sich im Literaturverzeichnis.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinitionen: Generationenkonflikt und Familiengedächtnis
- „Am Beispiel meines Bruders“: Literarischer und inhaltlicher Kontext
- Der Konflikt in der Familie Timm
- Auseinandersetzung mit der Vaterfigur
- Das Bild von Karl-Heinz im Familiengedächtnis
- Die Idealisierung durch die Eltern
- Versuch einer objektiven Betrachtung durch Uwe Timm
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Erforschung des Familienkonflikts in Uwe Timms autobiografischem Werk „Am Beispiel meines Bruders“ und dessen Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Die Arbeit untersucht die Gründe für den Konflikt und die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus auf das Familiengedächtnis.
- Der Einfluss der nationalsozialistischen Vergangenheit auf die Beziehungen innerhalb der Familie
- Die generationenspezifische Verarbeitung und Tradierung des Nationalsozialismus und des Holocaust
- Die Rolle des Familiengedächtnisses in der Gestaltung der Familienbeziehungen
- Die Suche nach der eigenen Identität im Kontext der Familiengeschichte
- Die Auswirkungen traumatischer Erlebnisse auf das Individuum und die Familie
Zusammenfassung der Kapitel
Im zweiten Kapitel werden die relevanten Begriffe "Generationenkonflikt" und "Familiengedächtnis" definiert und in ihren Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit gestellt. Das dritte Kapitel beleuchtet den literarischen und inhaltlichen Kontext von Uwe Timms Werk "Am Beispiel meines Bruders". Das vierte Kapitel analysiert die Faktoren, die für den Konflikt innerhalb der Familie Timm verantwortlich sind. Hierbei werden sowohl das schwierige Verhältnis zwischen Uwe Timm und seinem Vater als auch das Bild des verstorbenen Bruders Karl-Heinz im Familiengedächtnis untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Generationenkonflikt, Familiengedächtnis, Nationalsozialismus, Holocaust, Traumaverarbeitung, Identitätsfindung und Familiengeschichte. Besonderes Augenmerk liegt auf der Rolle des Familiengedächtnisses im Kontext der nationalsozialistischen Vergangenheit und dessen Einfluss auf die Familienbeziehungen.
- Citation du texte
- Lisa Sofie Mros (Auteur), 2010, Motive für den Familienkonflikt in Uwe Timms "Am Beispiel meines Bruders", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168395