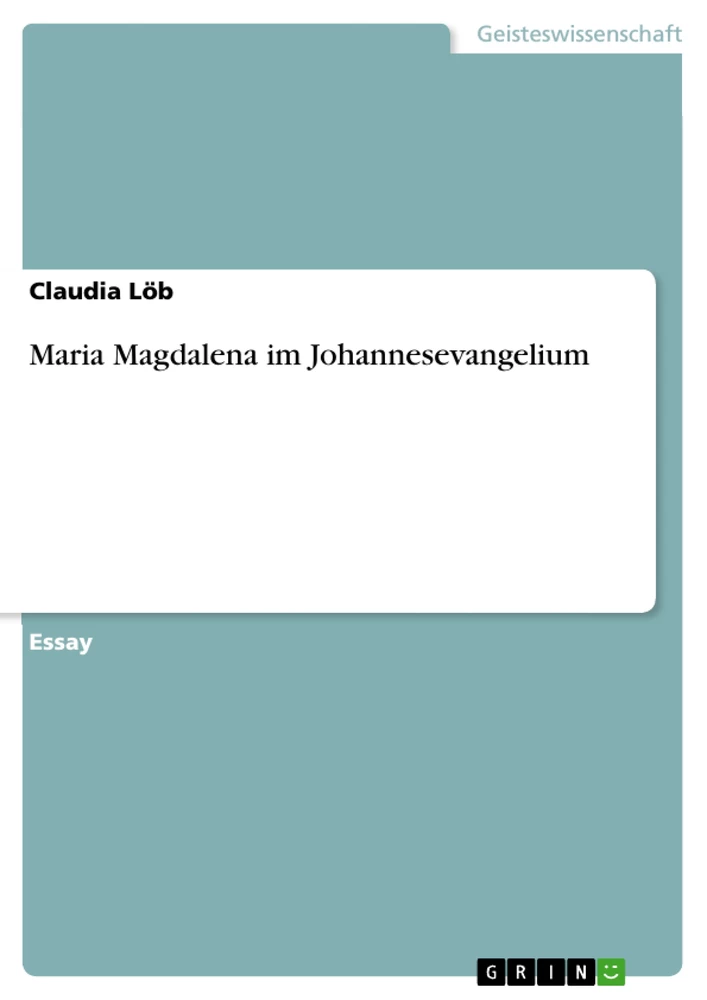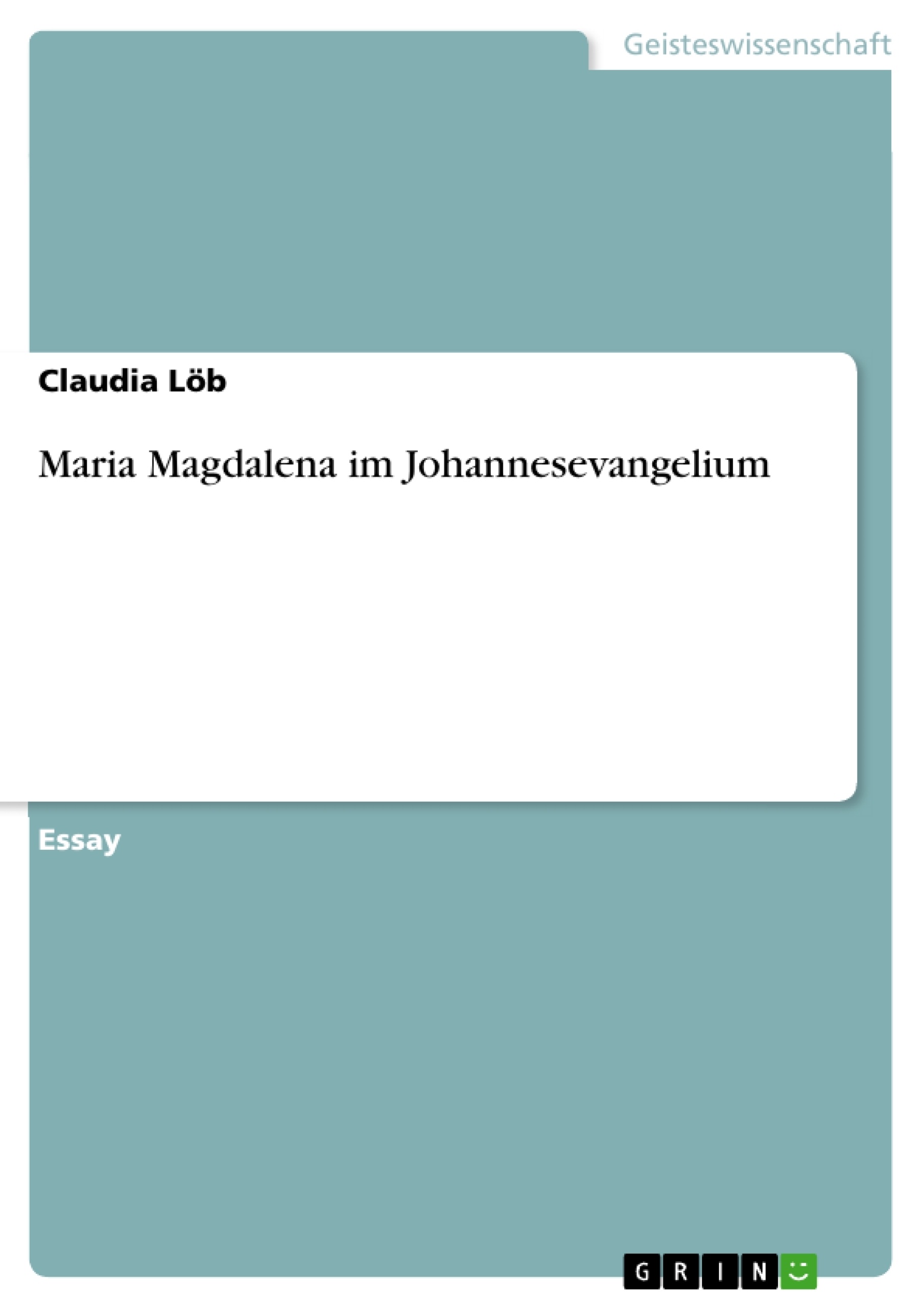Das Thema dieser Arbeit umfasst die neutestamentarische Maria Magdalena, wobei hier die Aufmerksamkeit auf das Johannesevangelium (später JohEv) gelenkt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Persönlichkeit Maria Magdalena
- Die Kreuzigung
- Die Auferstehung
- 20,1.2
- 20,3-10
- 20,11-13
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der neutestamentarischen Maria Magdalena, insbesondere im Kontext des Johannesevangeliums. Die Untersuchung analysiert die Rolle und Bedeutung Marias im Evangelium, indem sie die Informationen der Redaktion des Johannesevangeliums zu ihrer Persönlichkeit und den beiden Szenen ihrer Erwähnung (Kreuzigung und Auferstehung) beleuchtet.
- Die Bedeutung und Rolle Maria Magdalenas im Johannesevangelium
- Die Darstellung der Persönlichkeit Maria Magdalenas anhand der Informationen im Johannesevangelium
- Die Analyse der Kreuzigungsszene und Marias Rolle als Zeugin
- Die Untersuchung der Auferstehungsszene und Marias Rolle als erste Zeugin
- Die Interpretation der Bedeutung der Begegnung Marias mit den Engeln am Grab
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert den Fokus auf das Johannesevangelium. Es werden die beiden Stellen im Johannesevangelium erwähnt, an denen Maria Magdalena genannt wird, und die Forschungsfrage nach ihrer Bedeutung und Rolle im Evangelium wird formuliert.
Der Abschnitt „Die Persönlichkeit Maria Magdalena“ befasst sich mit der Darstellung Marias im Johannesevangelium. Es wird die Bedeutung ihres Beinamen „Magdalenerin“ und ihre Herkunft aus Magdala analysiert. Darüber hinaus werden Informationen aus dem Lukasevangelium herangezogen, um Hinweise auf ihre Vergangenheit und die Befreiung von Dämonen zu finden.
Im Kapitel „Die Kreuzigung“ wird die erste Erwähnung Maria Magdalenas im Johannesevangelium untersucht. Sie ist eine der Frauen, die als Zeugin der Kreuzigung Jesu genannt wird. Dieser Abschnitt analysiert die Rolle der Frauen als treue Anhänger Jesu im Gegensatz zu den Jüngern, die fliehen.
Das Kapitel „Die Auferstehung“ behandelt die zweite und wichtigere Erwähnung Maria Magdalenas im Johannesevangelium. Es wird der Gang Marias zum Grab Jesu geschildert und die Bedeutung ihrer Begegnung mit den Engeln analysiert. Der Abschnitt untersucht auch die Unterschiede zwischen Marias Erlebnis und den Erlebnissen von Petrus und dem geliebten Jünger.
Schlüsselwörter
Maria Magdalena, Johannesevangelium, Kreuzigung, Auferstehung, Zeugin, Bedeutung, Rolle, Persönlichkeit, Herkunftsort, Magdala, Dämonen, Frauen, Jünger, Engel, Grab, Begegnung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Maria Magdalena im Johannesevangelium?
Sie wird als zentrale Zeugin der Kreuzigung und als die erste Zeugin der Auferstehung Jesu dargestellt.
Was bedeutet der Beiname "Magdalenerin"?
Der Beiname weist auf ihre Herkunft aus dem Ort Magdala hin, was in der Arbeit als Teil ihrer Persönlichkeitsanalyse untersucht wird.
Wie unterscheidet sich Maria Magdalenas Erlebnis am Grab von dem der Jünger?
Die Arbeit analysiert die spezifische Begegnung Marias mit den Engeln und Jesus, die sich von den Erfahrungen von Petrus und dem "geliebten Jünger" unterscheidet.
Wird Maria Magdalena im Johannesevangelium mit Dämonen in Verbindung gebracht?
Die Arbeit zieht Informationen aus dem Lukasevangelium heran, um Hinweise auf ihre Vergangenheit und die Befreiung von Dämonen zu diskutieren.
Warum ist Maria Magdalena bei der Kreuzigung wichtig?
Sie gehört zu der Gruppe treuer Frauen, die im Gegensatz zu den geflohenen Jüngern bis zum Ende bei Jesus blieben.
- Quote paper
- Claudia Löb (Author), 2010, Maria Magdalena im Johannesevangelium, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168478