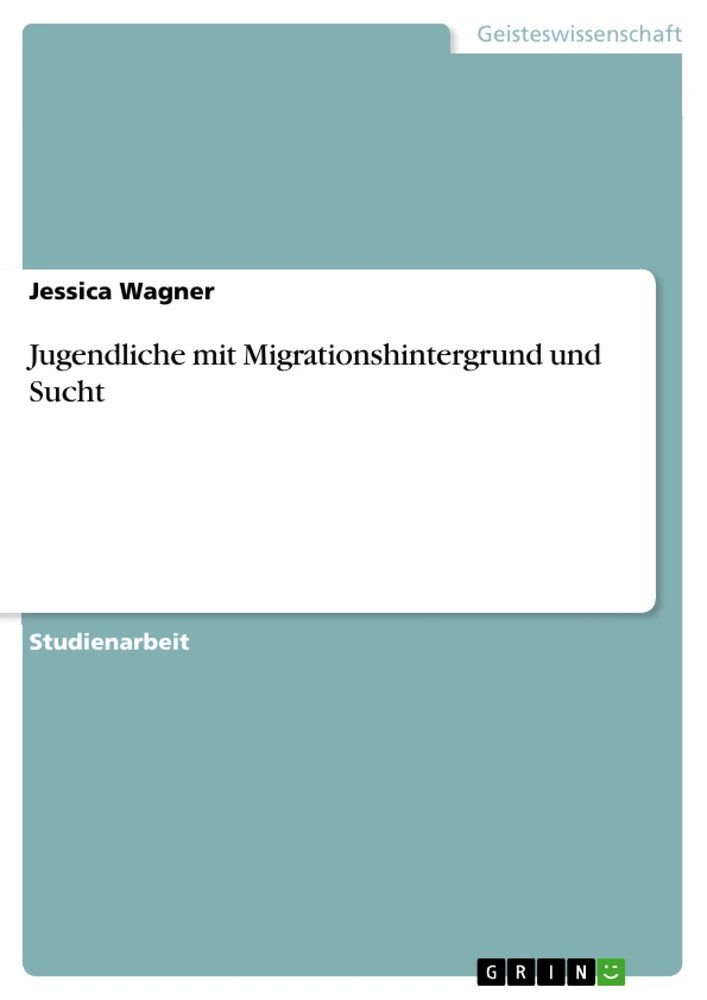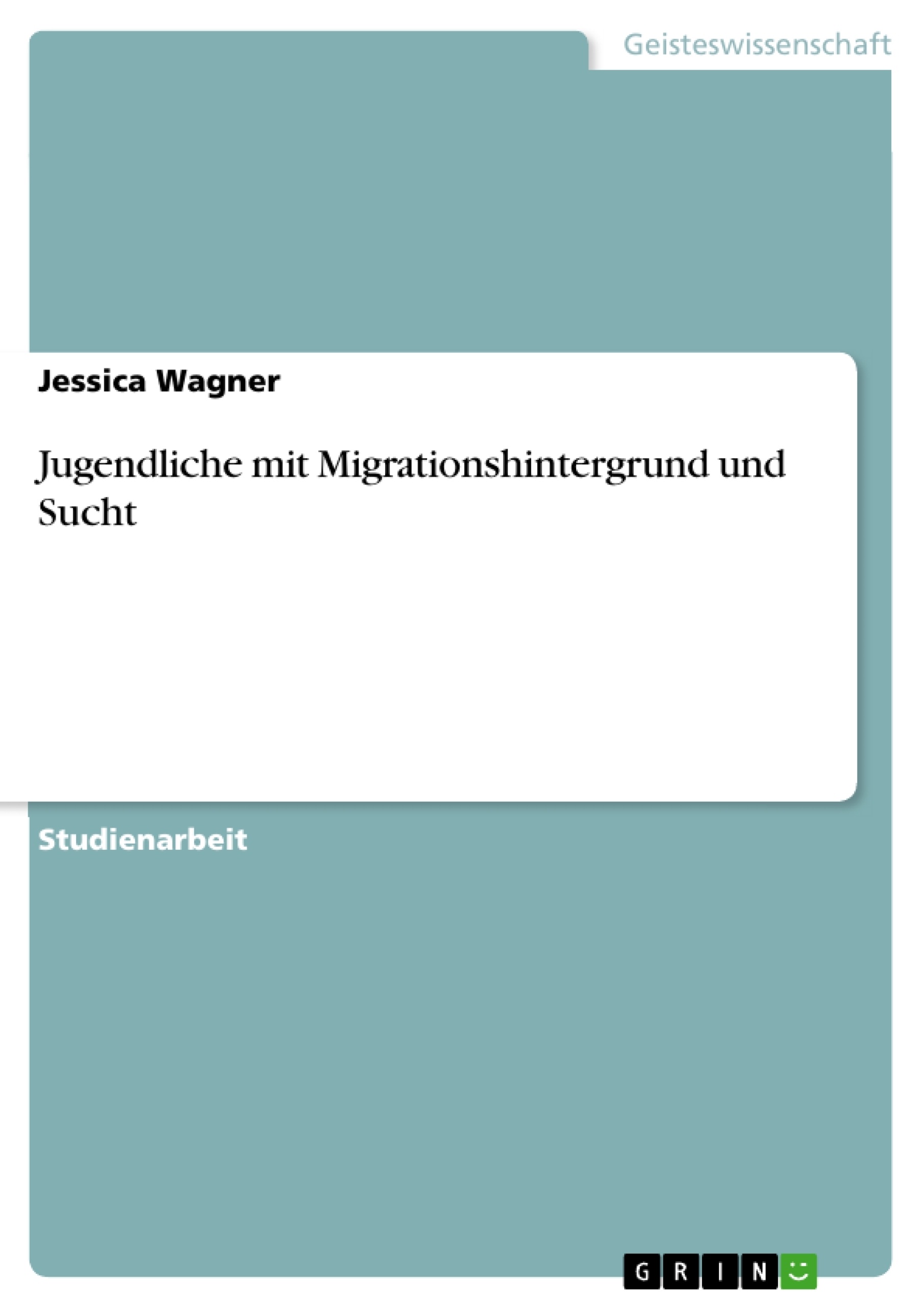Lange Zeit wurde verkannt, dass die Bundesrepublik Deutschland ein Einwanderungsland ist, und so wurden Migranten und Migrantinnen erst in jüngster Zeit als Klientel wahrgenommen.
Dies gilt auch für die Thematik der jugendlichen Migranten, die eine Suchtproblematik aufweisen. Hier wurde über lange Strecken die spezifische Problemlage, in der sich junge Migranten befinden, verkannt, ebenso wie deren Berücksichtigung in Einrichtungen der Suchthilfe.
In der einschlägigen Literatur herrscht weitgehende Uneinigkeit, was die tatsächliche prozentuale Suchterkrankung bzw. -gefährdung von jungen Migranten anbelangt.
So bleiben drei verschiedene Blickwinkel, aus denen man sich der Thematik „Jugendliche Migranten und Sucht“ nähern kann. Einerseits kann man nach Erklärungsansätzen für den vergleichsweise hohen Prozentsatz an Jugendlichen mit Migrationshintergrund an der Gesamtzahl der Suchtmittelkonsumenten, wie er in einigen Untersuchungen festgestellt wurde, suchen, andererseits kann man den Schwerpunkt auf den Anstieg der Konsumenten legen und schlussendlich kann man nach der Bedeutung der individuellen Migrationsbiographie für das Suchtverhalten fragen (vgl. Boos-Nünning / Siefen 2005, 205).
Ich habe mich entschlossen, in dieser Hausarbeit das Hauptaugenmerk auf migrationsspezifische Einflussfaktoren, was die Suchtgefährdung anbelangt, sowie auf die konkreten Chancen der Sozialen Arbeit in der Suchthilfe zu legen.
So werde ich im ersten Kapitel die Migrationssituation in Deutschland anhand einiger ausgewählter Daten, die Umfang und Zusammensetzung der Bevölkerung mit Migrationshintergrund betreffen, grob skizzieren. Im zweiten Kapitel werde ich die Thematik Sucht in Ansätzen umreißen und die damit verbundenen Begrifflichkeiten klären. Im folgenden dritten Kapitel werde ich einige ausgewählte Studien zum Suchtmittelgebrauch von jugendlichen Migranten vorstellen und analysieren und mich im Anschluss den konkreten Belastungs- und Einflussfaktoren des Biographieereignisses Migration widmen. Im fünften Kapitel werde ich darlegen, wie sich derzeit die Inanspruchnahme von Angeboten der Suchthilfe durch Migranten gestaltet und schließe im sechsten Kapitel mit praktischen Schlussfolgerungen für die Suchthilfe, die ich anhand eines exemplarischen Projekts – dem integrativen Suchthilfeprojekt der Stadt Hannover- darlegen werde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Migration in Deutschland
- Der Begriff Migration
- Anteil der Migranten an der Bevölkerung
- Gliederung nach Herkunftsländern
- Migranten unter 25 Jahren
- Psychische Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen
- Klassifizierung nach ICD-10
- Situation in Deutschland
- Statistische Erhebungen des Suchtmittelkonsums bei Migranten
- Empirische Studien und Daten
- Schlussfolgerungen
- Erklärungsansätze
- Psychische Belastungsmodelle von Migration
- Strukturelle Benachteiligung
- Wertekonflikte innerhalb der Familie
- Die Bedeutung der Peer-Group
- Inanspruchnahme von Einrichtungen der Suchthilfe
- Konsequenzen für die Praxis: Das Konzept der integrativen Suchthilfe am Beispiel des Ethno-medizinischen Zentrums Hannover
- Migration in Deutschland
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Migration auf das Suchtverhalten jugendlicher Migranten in Deutschland. Dabei werden migrationsspezifische Einflussfaktoren, die das Suchtverhalten beeinflussen können, analysiert und die Rolle der Sozialen Arbeit in der Suchthilfe betrachtet.
- Migrationsspezifische Belastungsfaktoren und deren Einfluss auf die Suchtgefährdung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
- Strukturelle Benachteiligung von Migranten in Deutschland und deren Auswirkungen auf das Suchtverhalten
- Die Rolle der Familie und der Peer-Group im Kontext von Migration und Sucht
- Die Inanspruchnahme von Suchthilfeeinrichtungen durch Migranten und die Herausforderungen der interkulturellen Suchthilfe
- Das Konzept der integrativen Suchthilfe und praktische Beispiele für erfolgreiche Projekte
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Migrationssituation in Deutschland wird anhand von Daten zum Umfang und zur Zusammensetzung der Bevölkerung mit Migrationshintergrund dargestellt.
- Kapitel 2: Die Thematik Sucht wird in Ansätzen umrissen und die damit verbundenen Begrifflichkeiten geklärt.
- Kapitel 3: Es werden ausgewählte Studien zum Suchtmittelgebrauch von jugendlichen Migranten vorgestellt und analysiert.
- Kapitel 4: Es werden migrationsspezifische Belastungs- und Einflussfaktoren des Biographieereignisses Migration, die sich suchtfördernd auswirken können, näher beleuchtet.
- Kapitel 5: Die Inanspruchnahme von Angeboten der Suchthilfe durch Migranten wird dargestellt.
- Kapitel 6: Es werden praktische Schlussfolgerungen für die Suchthilfe gezogen und das Konzept der integrativen Suchthilfe anhand eines exemplarischen Projekts erläutert.
Schlüsselwörter
Migration, jugendliche Migranten, Sucht, Suchtmittelkonsum, Suchthilfe, interkulturelle Suchthilfe, Integration, Benachteiligung, Belastungsfaktoren, Peer-Group, Familie, Ethno-medizinisches Zentrum Hannover, Keypersons.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist das Thema Sucht bei jugendlichen Migranten von Bedeutung?
Lange Zeit wurden Migranten als spezifische Klientel in der Suchthilfe verkannt; die Arbeit beleuchtet nun gezielt deren besondere Belastungslagen.
Welche migrationsspezifischen Einflussfaktoren auf die Suchtgefährdung gibt es?
Dazu gehören psychische Belastungsmodelle durch die Migration, strukturelle Benachteiligung, Wertekonflikte in der Familie und der Einfluss der Peer-Group.
Wie ist die aktuelle Situation der Suchthilfe für Migranten in Deutschland?
Die Arbeit analysiert die derzeitige Inanspruchnahme von Angeboten und stellt fest, dass interkulturelle Konzepte oft noch fehlen oder ausgebaut werden müssen.
Was ist das "Ethno-medizinische Zentrum Hannover"?
Es dient in der Arbeit als exemplarisches Projekt für ein integratives Suchthilfekonzept, das erfolgreich mit sogenannten "Keypersons" arbeitet.
Gibt es verlässliche Statistiken zum Suchtmittelkonsum bei Migranten?
In der Literatur herrscht Uneinigkeit über die genauen Zahlen; die Arbeit stellt jedoch ausgewählte Studien vor und analysiert deren Schlussfolgerungen.
- Quote paper
- Jessica Wagner (Author), 2009, Jugendliche mit Migrationshintergrund und Sucht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168515