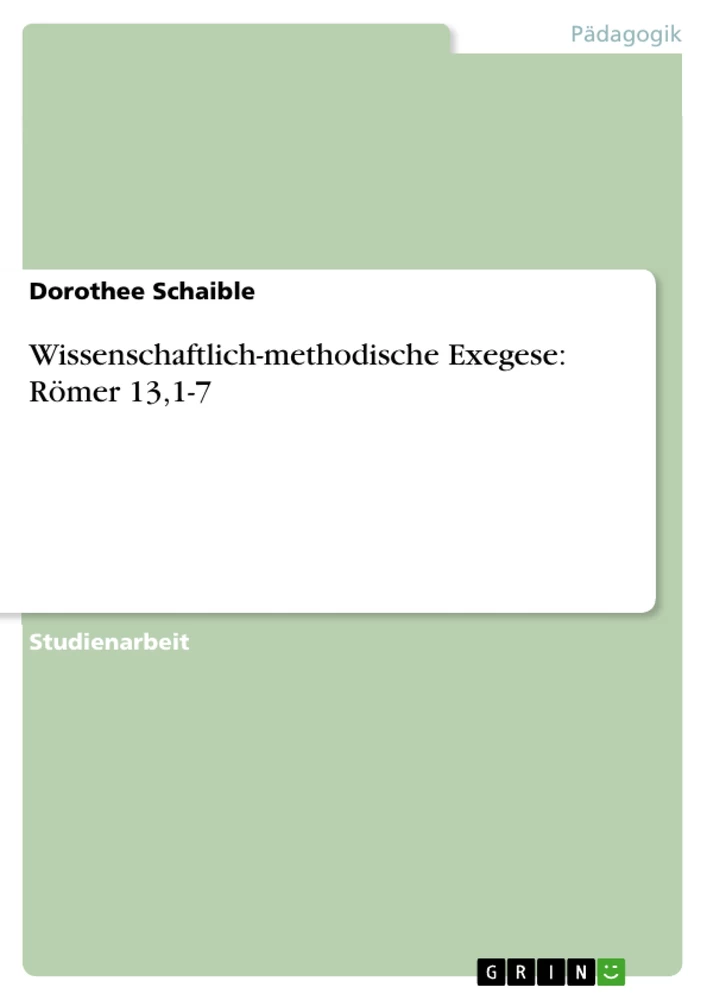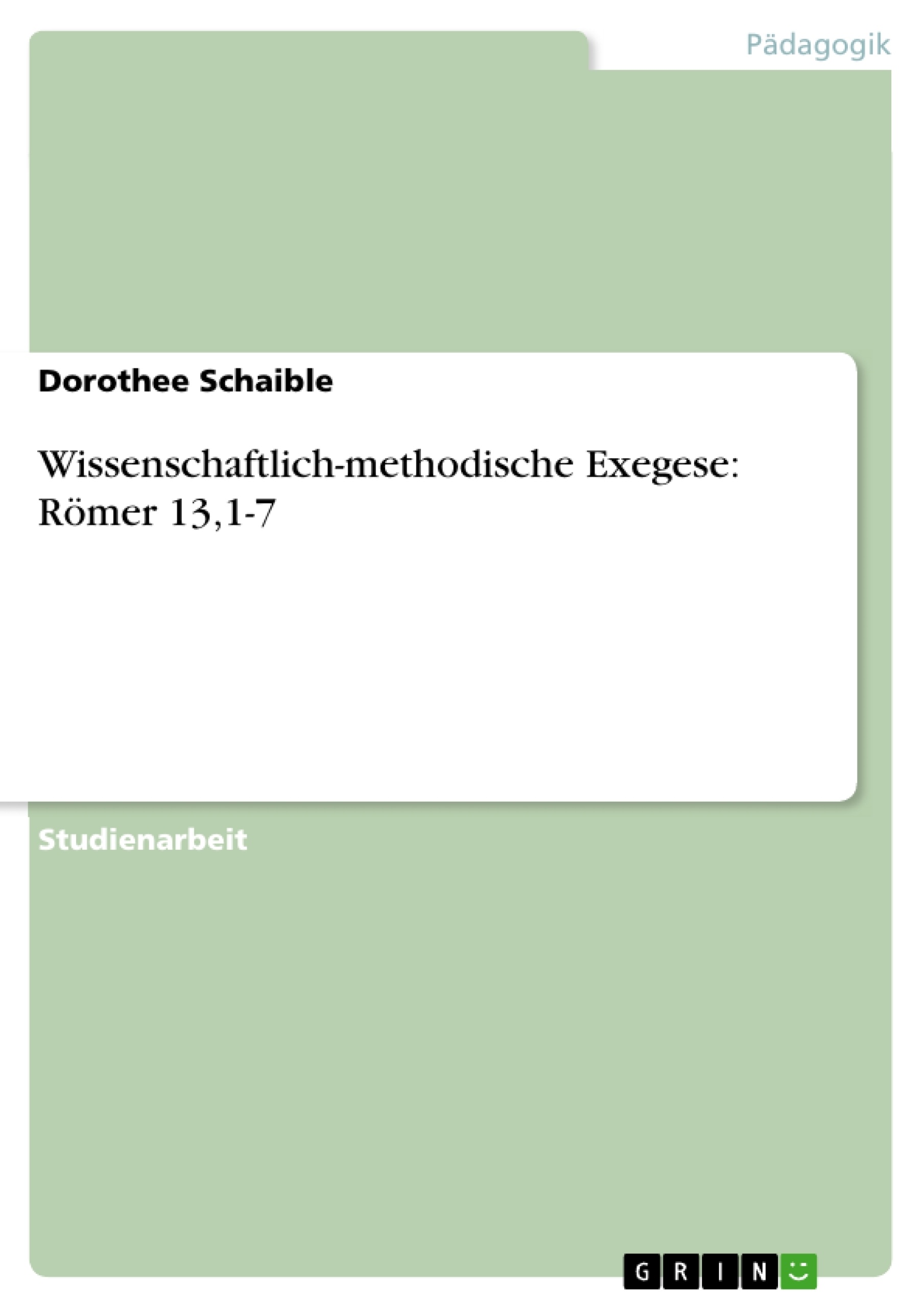Wohl kein anderer Text des Neuen Testaments erfuhr nach Wilckens so eine „zentrale Bedeutung nicht nur für das Verständnis des Staates, sondern überhaupt für das politische Verhalten.“ Röm. 13,1-7 wurde im Laufe der Kirchengeschichte unterschiedlich ausgelegt und interpretiert. In Anbetracht der oft leidvollen Auslegungsgeschichte soll es Ziel dieser Seminararbeit sein, mit Hilfe der wissenschaftlich-methodischen Exegese die ursprüngliche Intention des Paulus und die Bedeutung der Textstelle Röm. 13,1-7 für den heutigen Leser (an dieser Stelle soll außerdem zwischen der Auslegung des Textes in einem demokratischen Umfeld und einer Diktatur differenziert werden) zu ermitteln. Für eine möglichst sorgfältige Annäherung an den Text müssen verschiedene Textübersetzungen herangezogen werden. Ich verwendete die Bibelübersetzung der Zürcher Bibel von 2007, die Lutherübersetzung von 1987 und die Einheitsübersetzung von 1985. Im Anschluss an den Übersetzungsvergleich folgt die Literarkritik, in der ich die Textstelle Röm. 13,1-7 zu den umliegenden Textstellen in Beziehung brachte und ihre innere Struktur untersuchte. Nach diesem Schritt folgt die Gattungskritik, die die ursprüngliche Form und den Verwendungszweck der Textstelle behandelt. Parallelüberlieferungen aus dem religiös-kulturellen und sozialen Umfeld sind Teil der Religionsgeschichtlichen Fragestellung. Einzelne Motive sollen jedoch in der Einzelversexegese näher betrachtet werden. Eine Behandlung der gesamten Wirkungsgeschichte von der Antike bis hin ins 21. Jahrhundert würde den Rahmen dieser Seminararbeit sprengen. Ich beschränke mich deswegen auf die Skizzierung der Interpretation des Textes zur Zeit der ersten Christenverfolgungen, der Auslegung Luthers und der Interpretation dieser Textstelle zur Zeit des Nationalsozialismus. In der darauf folgenden sozial- und zeitgeschichtlichen Analyse sollen die Lebensumstände zur Zeit der Abfassung näher betrachtet werden. Ausgehend von den Sach- und Begriffserklärungen sowie der versweisen Auslegung des Textes in der Einzelexegese und den vorangehenden Überlegungen, soll die theologische Gesamtdeutung gewonnen werden. Anschließend wird die Frage nach der ursprünglichen Intention und der Hermeneutik/Vergegenwärtigung beantwortet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Persönliche Annäherung
- Wissenschaftlich-methodische Exegese
- Textkritik
- Literarkritik
- Äußere Abgrenzung
- Innerer Aufbau
- Form-und Gattungskritik
- Form-und Gattungsbestimmung
- Frage nach dem „,Sitz im Leben“
- Religionsgeschichtliche Fragestellung
- Wirkungsgeschichte /Rezeptionsgeschichte
- Sozial-und zeitgeschichtliche Analyse
- Einzelexegese
- Theologische Gesamtdeutung
- Intention des Paulus
- Hermeneutik/ Vergegenwärtigung
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Seminararbeit ist es, die ursprüngliche Intention des Paulus und die Bedeutung der Textstelle Röm. 13,1-7 für den heutigen Leser zu ermitteln. Hierbei soll insbesondere die Auslegung des Textes in einem demokratischen Umfeld und einer Diktatur differenziert werden. Die Arbeit soll eine möglichst sorgfältige Annäherung an den Text ermöglichen, indem verschiedene Textübersetzungen herangezogen und verschiedene methodische Ansätze der wissenschaftlich-methodischen Exegese angewandt werden.
- Die ursprüngliche Intention des Paulus in Röm. 13,1-7
- Die Bedeutung der Textstelle für den heutigen Leser
- Differenzierung der Auslegung in einem demokratischen Umfeld und einer Diktatur
- Anwendung der wissenschaftlich-methodischen Exegese
- Heranziehung verschiedener Textübersetzungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Relevanz der Textstelle Röm. 13,1-7 heraus. Im Kapitel „Persönliche Annäherung“ beschreibt die Autorin ihre eigene Auseinandersetzung mit dem Text und die Herausforderungen, die sie dabei empfand. Das Kapitel „Wissenschaftlich-methodische Exegese“ bildet den Kern der Arbeit und analysiert den Text mithilfe verschiedener methodischer Ansätze. Die Textkritik untersucht die verschiedenen Übersetzungen des Textes, um die ursprüngliche Lesart zu ermitteln. Die Literarkritik analysiert die Textstelle im Kontext der umliegenden Textstellen und untersucht ihre innere Struktur. Die Form-und Gattungskritik behandelt die ursprüngliche Form und den Verwendungszweck der Textstelle. Die Religionsgeschichtliche Fragestellung betrachtet parallele Überlieferungen aus dem religiös-kulturellen und sozialen Umfeld des Textes. Die Wirkungsgeschichte/ Rezeptionsgeschichte skizziert die Interpretation des Textes in verschiedenen Epochen. Die Sozial-und zeitgeschichtliche Analyse betrachtet die Lebensumstände zur Zeit der Abfassung des Textes. Die Einzelexegese analysiert einzelne Verse des Textes. Die Theologische Gesamtdeutung fasst die Ergebnisse der Exegese zusammen und behandelt die Intention des Paulus und die Hermeneutik/Vergegenwärtigung des Textes.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf den neutestamentlichen Text Röm. 13,1-7, insbesondere auf die Analyse der ursprünglichen Intention des Paulus und die Bedeutung der Textstelle für den heutigen Leser. Die Schlüsselbegriffe sind dabei: wissenschaftlich-methodische Exegese, Textkritik, Literarkritik, Form-und Gattungskritik, Religionsgeschichtliche Fragestellung, Wirkungsgeschichte/ Rezeptionsgeschichte, Sozial-und zeitgeschichtliche Analyse, Einzelexegese, Theologische Gesamtdeutung, Intention des Paulus, Hermeneutik/ Vergegenwärtigung, demokratisches Umfeld, Diktatur.
- Arbeit zitieren
- Dorothee Schaible (Autor:in), 2010, Wissenschaftlich-methodische Exegese: Römer 13,1-7, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168516