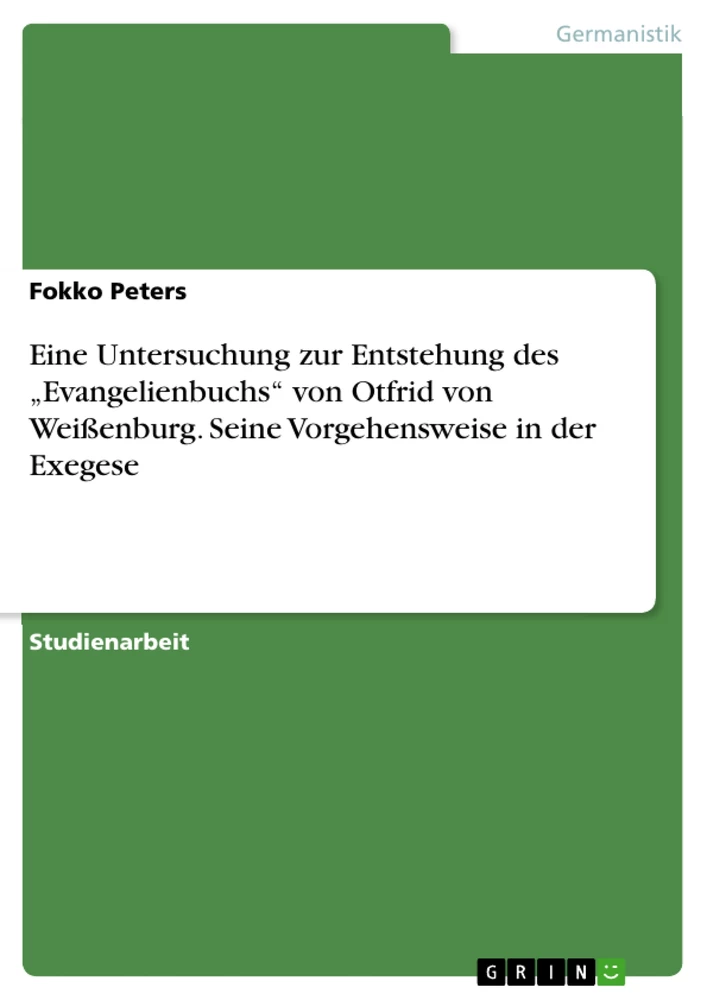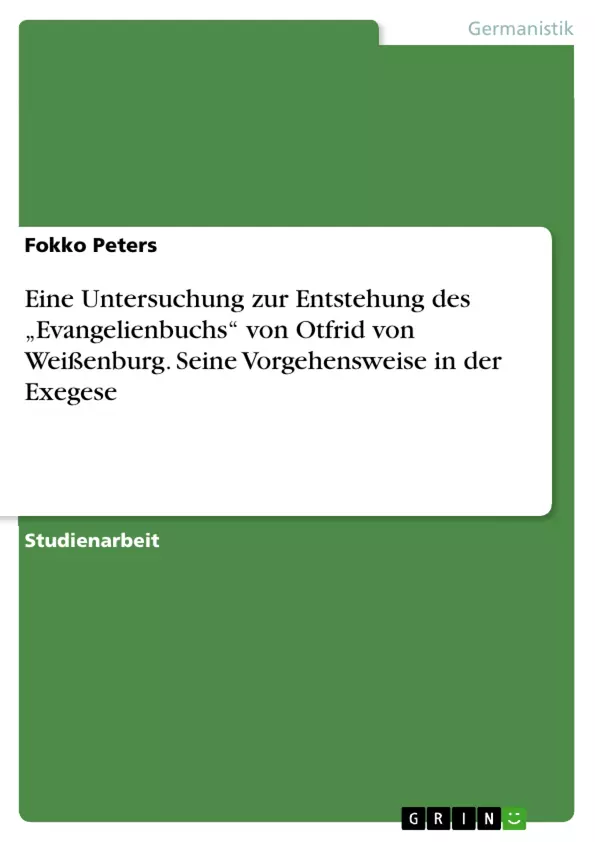Das „Evangelienbuch“ Otfrids von Weißenburg ist neben der altsächsischen „Heliand“-Dichtung, die ebenfalls im 9. Jahrhundert entstanden ist, die bedeutendste Bibeldichtung des Frühmittelalters. Jedenfalls sind uns aus dieser Zeit keine vergleichbaren Werke überliefert, sodass jeder der beiden vorgenannten Texte eine gewisse Einzigartigkeit mit sich bringt.
In dieser Arbeit soll es um die Entstehung und Konzeption der althochdeutschen Bibeldichtung des „Evangelienbuches“ gehen; dabei soll besonders das Umfeld des Dichters und die theologisch-exegetische Tradition, in der er stand, beleuchtet werden. Dazu ist es notwendig, die – zwar nur behelfsmäßig rekonstruierbaren – Lebensumstände Otfrids genauer zu betrachten, um so der Motivation und dem Zweck der Abfassung des „Evangelienbuches“ auf die Spur zu kommen. Wenn die Frage nach dem „Wozu?“ beantwortet werden konnte, ergibt sich daraus ein „Warum?“, das nach den Gründen für die konkrete Ausgestaltung fragt. Dementsprechend soll im zweiten Teil der Arbeit Otfrids exegetisches Vorgehen anhand eines ausgewählten Abschnitts (II,8-10) aus dem „Evangelienbuch“ beschrieben und erklärt werden.
Als ein allgemeines Ziel dieser Arbeit ließe sich also ein tieferes Verständnis des Otfrid’schen Schaffens nennen, das sich in seinem „Evangelienbuch“ widerspiegelt. Konkret soll die Frage nach exegetischen Mustern, die für diesen Weißenburger Mönch kennzeichnend sind, zumindest in Ansätzen beantwortet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlegendes zur frühmittelalterlichen Theologie
- Grundlegendes zum Verfasser des Evangelienbuches und zu seinem Umfeld
- Motivation für das Schreiben und Zweck des Evangelienbuches
- Die Zusammenstellung des Evangelienbuches
- Die Vorgehensweise Otfrids bei der Exegese (am Beispiel von II,8-10)
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entstehung und Konzeption des „Evangelienbuchs“ von Otfrid von Weißenburg. Im Zentrum steht die Analyse des Umfelds des Dichters und der theologisch-exegetischen Tradition, in der er stand. Die Arbeit untersucht die Lebensumstände Otfrids, um die Motivation und den Zweck der Abfassung des „Evangelienbuchs“ zu erforschen. Des Weiteren wird Otfrids exegetisches Vorgehen anhand eines ausgewählten Abschnitts (II,8-10) aus dem „Evangelienbuch“ beschrieben und erklärt. Ziel der Arbeit ist es, ein tieferes Verständnis des Otfrid'schen Schaffens zu vermitteln und exegetische Muster zu identifizieren, die für den Weißenburger Mönch kennzeichnend sind.
- Die Entstehung und Konzeption des „Evangelienbuchs“
- Das Umfeld des Dichters Otfrid von Weißenburg
- Die theologisch-exegetische Tradition des Frühmittelalters
- Die Motivation und der Zweck der Abfassung des „Evangelienbuchs“
- Otfrids exegetisches Vorgehen anhand eines ausgewählten Abschnitts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das „Evangelienbuch“ von Otfrid von Weißenburg als bedeutende Bibeldichtung des Frühmittelalters vor und skizziert den Fokus der Arbeit auf die Entstehung und Konzeption dieses Werkes. Das zweite Kapitel widmet sich der frühmittelalterlichen Theologie, wobei Otfrids Bezug auf frühe christliche Schreiber und die Bedeutung der Klosterbibliotheken im fränkischen Reich hervorgehoben werden. Im dritten Kapitel wird ein Einblick in das Leben und das Umfeld des Dichters Otfrid gegeben, einschließlich seiner Studienzeit in Fulda unter Hrabanus Maurus. Der vierte Abschnitt behandelt die Motivation für das Schreiben des „Evangelienbuchs“ und dessen Zweck, wobei Otfrids Absicht, einen umfassenden Bibelkommentar zu schaffen, betont wird.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Bibeldichtung des Frühmittelalters, Otfrid von Weißenburg, dem „Evangelienbuch“, frühmittelalterlicher Theologie, Klosterbibliotheken, exegetische Tradition, Kirchenväter, Hrabanus Maurus, Studienaufenthalt in Fulda, Motivation und Zweck der Abfassung des „Evangelienbuchs“, exegetisches Vorgehen.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Otfrid von Weißenburg?
Otfrid war ein Mönch des 9. Jahrhunderts aus dem Kloster Weißenburg, der unter Hrabanus Maurus in Fulda studierte und als Verfasser des ersten gereimten althochdeutschen Evangelienbuchs gilt.
Was ist das Besondere am „Evangelienbuch“?
Es ist eine der bedeutendsten Bibeldichtungen des Frühmittelalters und stellt einen umfassenden Bibelkommentar in althochdeutscher Sprache dar.
Welches Ziel verfolgte Otfrid mit seinem Werk?
Otfrid wollte die biblische Geschichte in der Volkssprache zugänglich machen und dabei die theologisch-exegetische Tradition der Kirchenväter bewahren.
Wie ging Otfrid bei der Exegese vor?
Seine Vorgehensweise wird in der Arbeit am Beispiel des Abschnitts II,8-10 analysiert, wobei er traditionelle exegetische Muster auf seine Dichtung übertrug.
In welcher Tradition stand Otfrid von Weißenburg?
Er stand in der theologischen Tradition des Frühmittelalters, die stark von den Kirchenvätern und der wissenschaftlichen Arbeit in Klosterbibliotheken geprägt war.
- Citation du texte
- Fokko Peters (Auteur), 2008, Eine Untersuchung zur Entstehung des „Evangelienbuchs“ von Otfrid von Weißenburg. Seine Vorgehensweise in der Exegese, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168550