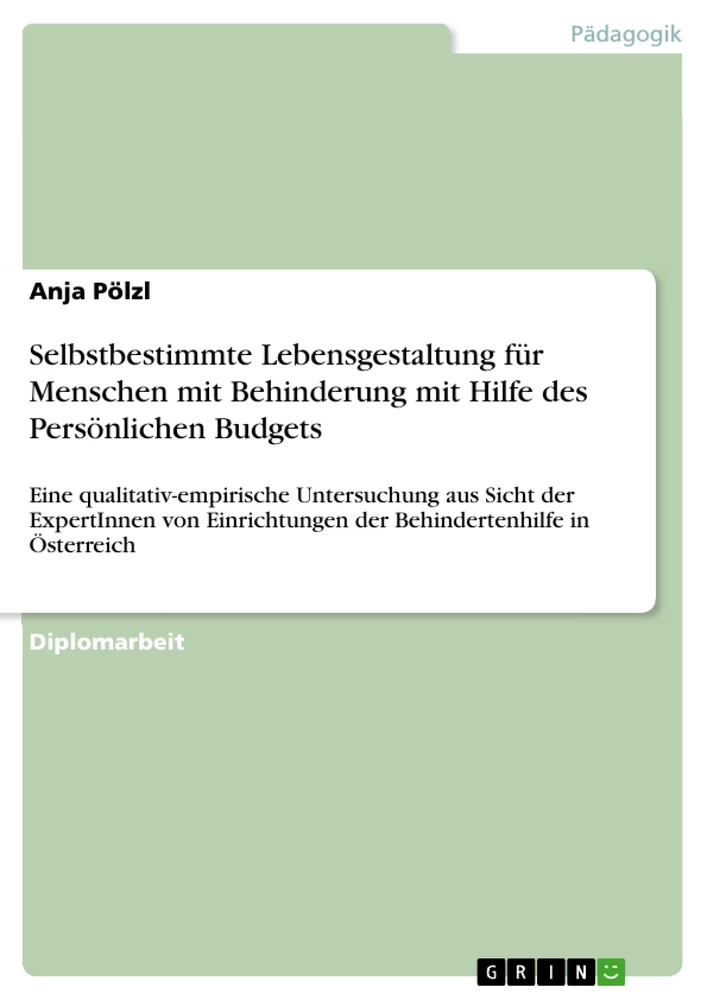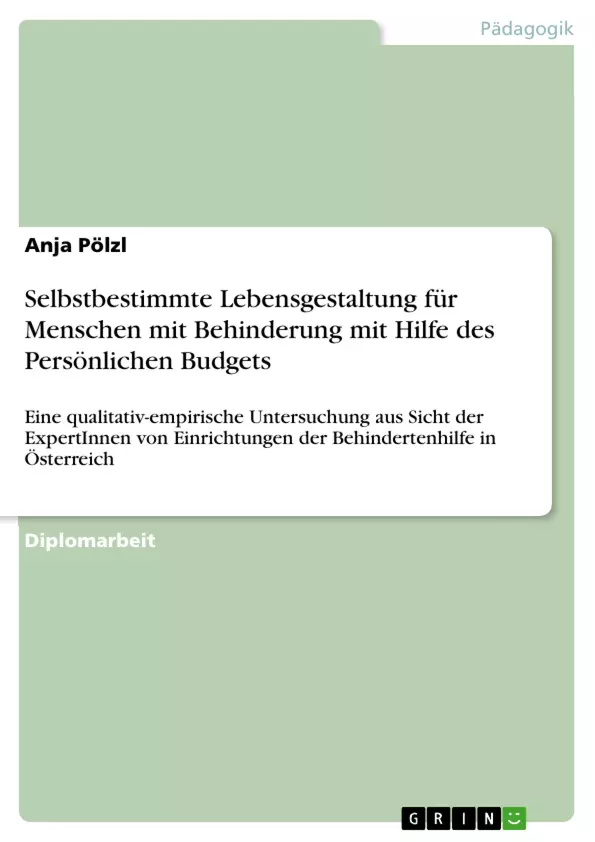Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Forschungsfrage, inwiefern das Persönliche Budget aus Sicht der ExpertInnen von Einrichtungen der Behindertenhilfe in Österreich Selbstbestimmung und Partizipation von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft ermöglicht.
Im theoretischen Teil wurden die für die Arbeit zentralen Begriffsbestimmungen und Grundlagen des Persönlichen Budgets erarbeitet und es wurde ermittelt, wie weit die Umsetzungen der Modelle des Persönlichen Budgets in Schweden, den Niederlanden, Großbritannien, Deutschland und Österreich vorangeschritten sind. Die vorgestellten internationalen Modelle zeigen positive Erfolge in der Realisierung von Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Partizipation im Alltagsleben der BudgetnehmerInnen durch das Persönliche Budget. Im deutschsprachigen Raum kommen jedoch die praktischen Erprobungen der Modelle nur sehr langsam voran. Ebenso steckt die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Themenbereich noch in den Kinderschuhen. Dies führte zu der Entwicklung eines qualitativen Forschungsdesigns, um die Umsetzung des Persönlichen Budgets in Österreich besser erfassen zu können. Infolgedessen wurden mit sechs ExpertInnen ausgewählter Einrichtungen der Behindertenhilfe aus Wien ExpertInneninterviews durchgeführt. Die Interviewauswertung erfolgte nach der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. Die Resultate in Bezug auf die Forschungsfrage haben gezeigt, dass nach Einschätzung aller interviewten Fachleute das Instrument des Persönlichen Budgets in sehr hohem Maße dazu geeignet ist, Selbstbestimmung und Partizipation für Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft zu ermöglichen. Das Persönliche Budget stellt nach Angabe der befragten ExpertInnen eine sinnvolle Leistung und eine sehr gut geeignete Möglichkeit für Menschen mit Beeinträchtigung dar, um eine selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebensgestaltung zu erreichen.
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITUNG
- 1.Ausgangslage und Problemsituation
- 2.Aktueller Forschungsstand
- 3.Zielsetzung und Forschungsfrage der Arbeit
- 4.Aufbau der Arbeit
- II.EINORDNUNG DER BEGRIFFLICHKEITEN
- 5.Das Persönliche Budget
- 6.Rehabilitation
- 7.Selbstbestimmung
- 8.Partizipation
- III.GRUNDLAGEN - ECKPUNKTE DES PERSÖNLICHEN BUDGETS
- 9.Das Persönliche Budget - eine neue Leistungsform
- 10.Sozialrechtliche Grundlagen
- 11.Zielsetzung und Zweck des Persönlichen Budgets
- 12.Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe
- 13.Konzeptionelle Grundlagen - von fremdbestimmter Fürsorge zur Selbstbestimmung
- 1.1.Die Stellung des Leistungsberechtigten beim Sachleistungsbezug
- 1.2.Die Stellung des Leistungsberechtigten beim Persönlichen Budget
- 14.Die Partizipationsbereiche: Bildung und Arbeit im Modell der Budgetbemessung
- 1.3.Bildung und Arbeit
- 1.4.Bildung
- 1.5.Arbeit
- 1.6.Modell zur Bemessung Persönlicher Budgets
- 1.7.Das Persönliche Budget im Kontext von Bildung und Arbeit
- 1.8.Das Persönliche Budget im Kontext der Bildung
- 1.9.Das Persönliche Budget im Kontext der Arbeit
- IV.KONZEPTION UND UMSETZUNG EUROPÄISCHER MODELLE
- 15.Internationale Modelle
- 1.1.Das Personengebundene Budget in den Niederlanden
- 1.2.Erfahrungen/ Stärken und Schwächen
- 1.3.Das Persönliche Budget in Schweden
- 1.4. Erfahrungen/ Stärken und Schwächen
- 1.5.Direct Payments in Großbritannien
- 1.6.Erfahrungen/Stärken und Schwächen
- 16.Deutsche Modelle
- 1.7.Das Persönliche Budget in Deutschland
- 1.8.Erfahrungen/Stärken und Schwächen
- 1.9.Die Pflegegeldergänzungsleistung für Persönliche Assistenz in Wien
- 1.10.Erfahrungen/ Stärken und Schwächen
- 17.Vergleich internationaler und deutscher Modelle
- V.EMPIRISCHER TEIL
- 18.Forschungsmethode
- 1.1.Datenerhebung mittels ExpertInneninterview
- 1.2.Entwicklung des Leitfadens
- 1.3.Datenauswertung mittels Qualitativer Inhaltsanalyse
- 1.4.Ablaufmodell der Inhaltsanalyse nach Mayring
- 1.5.Bestimmung des Ausgangsmaterials
- 1.6.Richtung der Analyse
- 1.7.Theoriegeleitete Fragestellung
- 1.9.Definition der Analyseeinheiten
- 1.8.Bestimmung der Analysetechnik und Festlegung des konkreten Materials
- 1.10.Analyseschritte mittels Kategoriensystem
- 1.11.Hauptkategorie 1 „Persönliches Budget“
- 1.12.Unterkategorie 1 „Definition“
- 1.13.Unterkategorie 2 „Kenntnisse“
- 1.14.Unterkategorie 3 „Schwierigkeiten und Herausforderungen“
- 1.15.Unterkategorie 4 „Einstellungen“
- 1.16.Unterkategorie 5 „Zukunftsperspektiven“
- 1.17.Hauptkategorie 2 „Pflegegeldergänzungsleistung für Persönliche Assistenz“
- 1.18.Unterkategorie 1 „Definition“
- 1.19.Unterkategorie 2 „Kenntnisse“
- 1.20.Unterkategorie 3 „Erfahrungen“
- 1.21.Hauptkategorie 3 „Internationale Modelle“
- 1.22.Hauptkategorie 4 „Selbstbestimmungs- und Partizipationsmöglichkeiten mittels des Persönlichen Budgets“
- 1.23.Hauptkategorie 5 „Auswirkungen des Persönlichen Budgets“
- 1.24.Unterkategorie 1 „Chancen“
- 1.25.Unterkategorie 2 „Risiken“
- 1.26.Unterkategorie 3 „Verbesserungsvorschläge“
- 1.27.Hauptkategorie 6 „Auswirkungen der Pflegegeldergänzungsleistung für Persönliche Assistenz“
- 1.28.Unterkategorie 1 „Chancen“
- 1.29.Unterkategorie 2 „Risiken“
- 1.30.Unterkategorie 3 „Verbesserungsvorschläge“
- 19.Darstellung der Untersuchungsergebnisse
- 20. Diskussionen und Interpretation der Ergebnisse
- 1.31.Hauptkategorie „Persönliches Budget“
- 1.32.Hauptkategorie „Pflegegeldergänzungsleistung für Persönliche Assistenz“
- 1.33.Hauptkategorie „Internationale Modelle“
- 1.34.Hauptkategorie „Selbstbestimmungs- und Partizipationsmöglichkeiten mittels des Persönlichen Budgets“
- 1.35.Hauptkategorie „Auswirkungen des Persönlichen Budgets“
- 1.36.Hauptkategorie „Auswirkungen der Pflegegeldergänzungsleistung für Persönliche Assistenz“
- 1.37.Abschließende Interpretation hinsichtlich der Forschungsfragen
- VI.Abschliessende Bemerkungen
- 21.Resümee
- 22.Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Möglichkeiten der selbstbestimmten Lebensgestaltung für Menschen mit Behinderung im Kontext des Persönlichen Budgets. Die Arbeit analysiert den aktuellen Forschungsstand und beleuchtet die konzeptionellen Grundlagen des Persönlichen Budgets im Vergleich zu internationalen Modellen. Die Untersuchung erfolgt aus der Perspektive von ExpertInnen aus Einrichtungen der Behindertenhilfe in Österreich.
- Das Persönliche Budget als Instrument zur Förderung der Selbstbestimmung und Partizipation von Menschen mit Behinderung
- Die sozialrechtlichen Grundlagen und die Zielsetzung des Persönlichen Budgets
- Der Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe: von fremdbestimmter Fürsorge zur Selbstbestimmung
- Die Bedeutung von Bildung und Arbeit im Kontext des Persönlichen Budgets
- Der Vergleich von internationalen Modellen des Persönlichen Budgets und ihre Erfahrungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemsituation und den aktuellen Forschungsstand zum Thema Persönliches Budget dar. Sie definiert die Zielsetzung und Forschungsfrage der Arbeit sowie den Aufbau der Arbeit. Kapitel II ordnet die zentralen Begrifflichkeiten wie Persönliches Budget, Rehabilitation, Selbstbestimmung und Partizipation ein. Kapitel III befasst sich mit den Grundlagen des Persönlichen Budgets, den sozialrechtlichen Grundlagen, der Zielsetzung und dem Zweck des Persönlichen Budgets sowie dem Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe. Kapitel IV beleuchtet die Konzeption und Umsetzung von europäischen Modellen des Persönlichen Budgets, wobei internationale Modelle wie das Personengebundene Budget in den Niederlanden, das Persönliche Budget in Schweden und Direct Payments in Großbritannien sowie deutsche Modelle wie das Persönliche Budget in Deutschland und die Pflegegeldergänzungsleistung für Persönliche Assistenz in Wien vorgestellt werden. Kapitel V beinhaltet den empirischen Teil der Arbeit, der die Forschungsmethode, die Datenerhebung und -auswertung sowie die Darstellung der Untersuchungsergebnisse umfasst. Schließlich werden die Ergebnisse diskutiert und interpretiert, wobei die Forschungsfragen beantwortet werden. Abschliessend werden die Ergebnisse zusammengefasst und ein Ausblick auf zukünftige Forschungsfelder gegeben.
Schlüsselwörter
Persönliches Budget, Selbstbestimmung, Partizipation, Behinderung, Behindertenhilfe, Rehabilitation, Sozialrecht, internationale Modelle, ExpertInneninterview, qualitative Inhaltsanalyse.
- Arbeit zitieren
- Anja Pölzl (Autor:in), 2010, Selbstbestimmte Lebensgestaltung für Menschen mit Behinderung mit Hilfe des Persönlichen Budgets, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168582