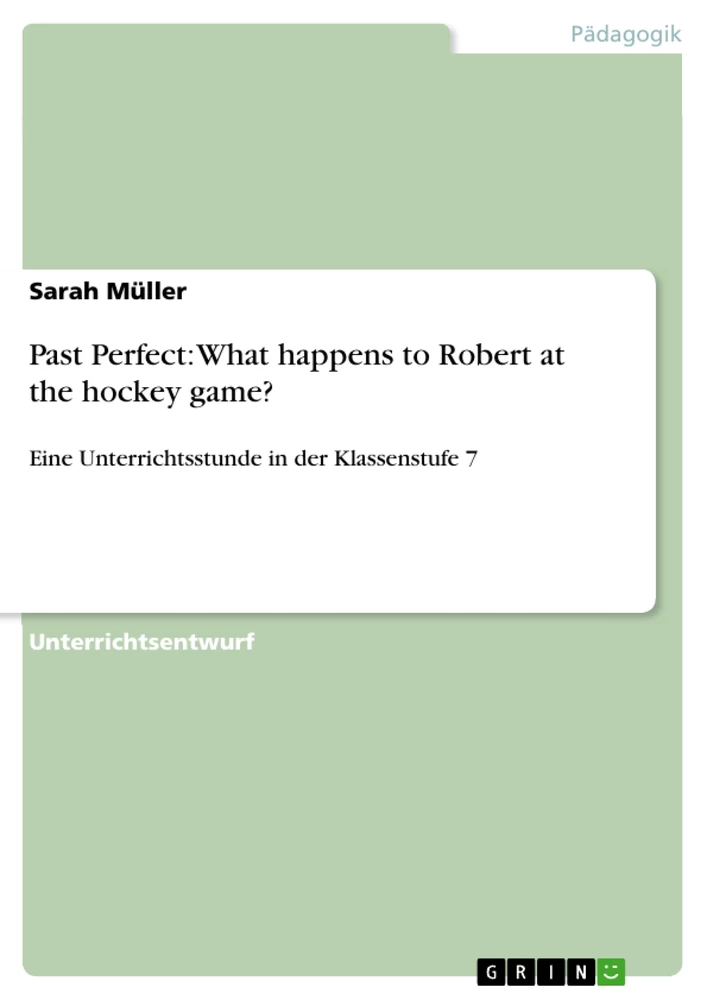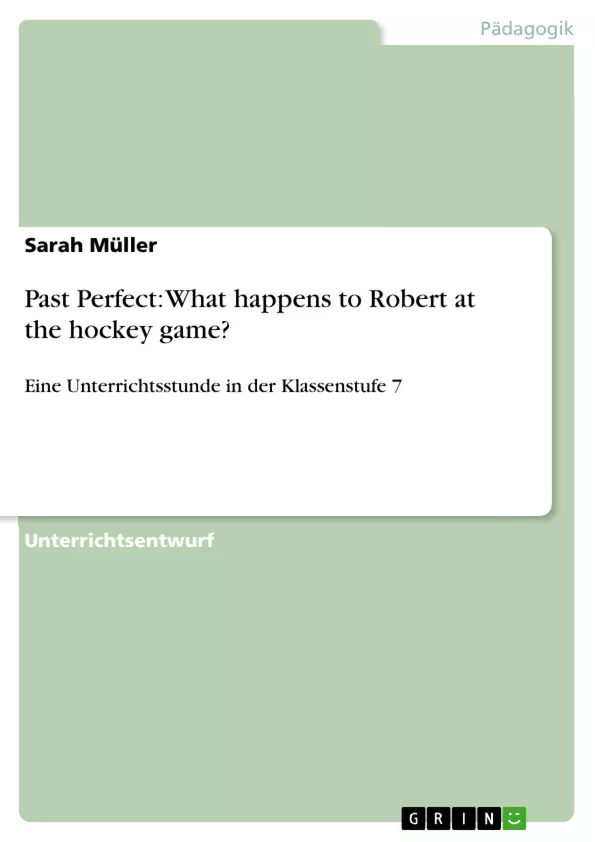Der Fokus der heutigen Stunde liegt auf der Einführung des Past Perfect. Ziel des Fremdsprachenunterrichts ist es, dass SuS kompetent kommunizieren können. Aus eben diesen Bemühungen, kommunikative Kompetenz zu erwerben, ergibt sich nach Haß „die Notwendigkeit zur Klärung grammatischer Probleme“ . Die Bildungsstandards fordern, dass die SuS am Ende der 8. Klasse den Ablauf eines persönlich erlebten Ereignisses beschreiben können . Um ein Ereignis in der Vergangenheit beschreiben zu können, das sich bereits vor einer anderen Begebenheit ereignet hat, benötigen die SuS die Struktur des Past Perfect.
In der heutigen Stunde wird das Past Perfect im Kontext eines Eishockeyspieles eingeführt. Dabei wird ein situativer Lernanlass geschaffen, der relevante Wortschatz wurde bereits in den vorangegangenen Stunden eingeführt. Das Past Perfect wird zwar auch in der oben genannten Unit des Lehrwerks (Unit 4 des von der Fachkonferenz als Leitmedium beschlossenen Lehrwerks English G21 A3) thematisiert, dort geschieht die Vermittlung jedoch eher im Sinne einer deduktiv ausgerichteten Grammatikunterweisung.
Inhaltsverzeichnis
- Lerngruppe
- Beschreibung der Lerngruppe
- Lernausgangslage – Lernausgangslage und Lernstand
- Didaktisch-methodische Überlegungen
- Didaktisches Zentrum der Stunde
- Literatur
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die heutige Stunde dient als 8. Stunde in der Einheit „Canada - people, culture, animals“ zur Einführung des Past Perfect. Das Hauptziel ist die Förderung der kommunikativen Kompetenz der Schüler, insbesondere die Fähigkeit, ein persönlich erlebtes Ereignis in der Vergangenheit zu beschreiben. Die Stunde soll den Schülern helfen, die Grammatik des Past Perfect in einem praxisnahen Kontext zu verstehen und anzuwenden.
- Einführung des Past Perfect im Kontext eines Eishockeyspieles
- Vermittlung des Past Perfect durch eine induktive Lernmethode
- Vertiefung des landeskundlichen Wissens über Kanada
- Förderung der interkulturellen Kompetenz der Schüler
- Integration des Past Perfect in natürliche Kommunikationssituationen
Zusammenfassung der Kapitel
Lerngruppe
Dieser Abschnitt beschreibt die Lerngruppe, ihre Zusammensetzung, die Lernvoraussetzungen und den Lernstand. Die Lerngruppe ist dem Fach Englisch gegenüber aufgeschlossen und zeigt eine positive Einstellung. Die mündliche Beteiligung der Schüler ist jedoch unterschiedlich, mit einem besonders leistungsstarken Schüler und einigen zurückhaltenden Schülern.
Didaktisch-methodische Überlegungen
Dieser Abschnitt erläutert die didaktischen und methodischen Überlegungen zur Unterrichtsstunde. Die Stunde wird als 8. Stunde in der Einheit „Canada - people, culture, animals“ durchgeführt und konzentriert sich auf die Einführung des Past Perfect. Der Fokus liegt auf einer erwerbsorientierten Methode, die die Grammatik in natürliche Kommunikationssituationen einbettet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen der Arbeit sind: Past Perfect, kommunikative Kompetenz, landeskundliches Lernen, Kanada, interkulturelle Kompetenz, induktive Lernmethode, Eishockey, situativer Lernanlass.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Englischstunde zum Past Perfect?
Ziel ist die Einführung der Zeitform Past Perfect, damit Schüler Ereignisse beschreiben können, die zeitlich vor anderen Ereignissen in der Vergangenheit liegen.
In welchem Kontext wird die Grammatik vermittelt?
Das Past Perfect wird praxisnah im Kontext eines Eishockeyspieles in Kanada eingeführt.
Was ist eine „induktive Lernmethode“?
Bei dieser Methode erschließen sich die Schüler die grammatikalischen Regeln selbst aus natürlichen Kommunikationssituationen, anstatt sie nur auswendig zu lernen.
Welche landeskundlichen Themen werden behandelt?
Die Stunde ist Teil der Einheit „Canada - people, culture, animals“ und fördert somit auch die interkulturelle Kompetenz der Schüler.
Warum wird das Past Perfect in der 8. Klasse eingeführt?
Laut Bildungsstandards sollen Schüler am Ende der 8. Klasse in der Lage sein, den Ablauf persönlich erlebter Ereignisse präzise zu beschreiben.
- Citation du texte
- Sarah Müller (Auteur), 2011, Past Perfect: What happens to Robert at the hockey game? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168588