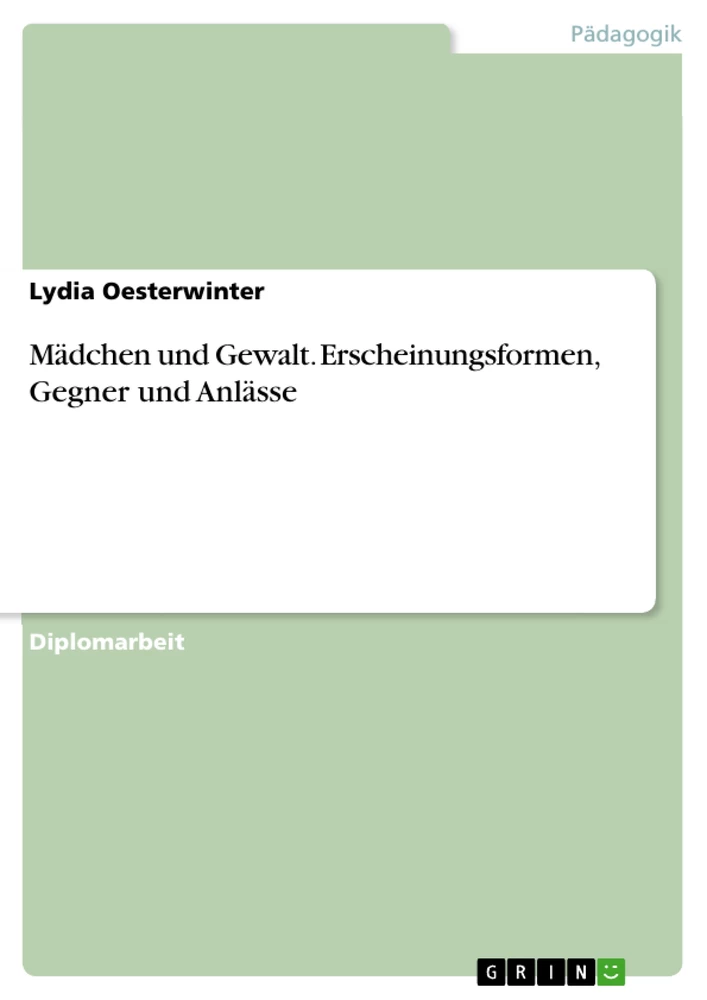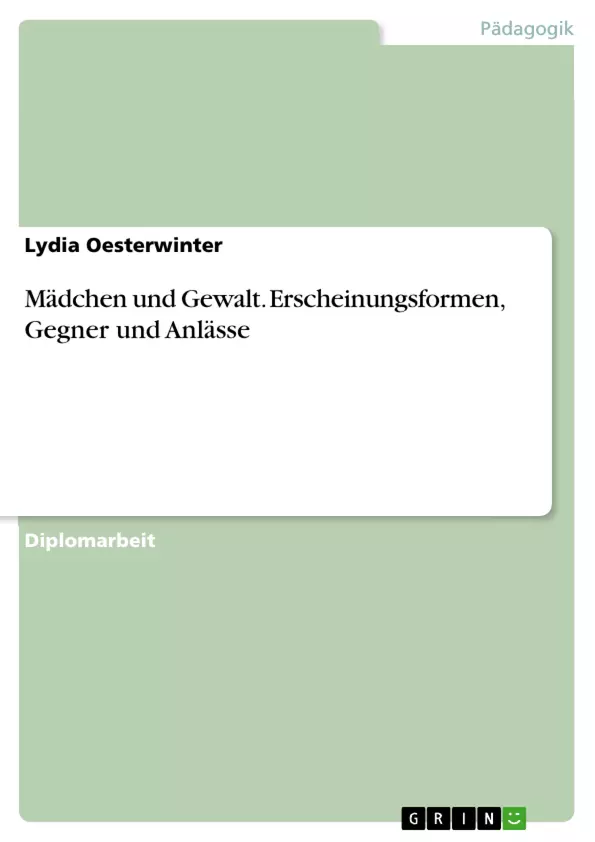Es gibt eine Vielzahl verschiedener Theorien, die sich der Erklärung aggressiven Verhaltens bei Jugendlichen widmen. Problematisch im Zusammenhang mit der Forschungsfrage dieser Arbeit ist jedoch, dass der Geschlechteraspekt in nahezu allen Theorien unbeachtet bleibt.
Aus diesem Grund werden innerhalb dieses Kapitels einzelne ausgewählte Theorien, die das Phänomen ursprünglich geschlechtsneutral behandeln, dahingehend untersucht, inwieweit diese einen Beitrag im Zusammenhang mit der zunehmenden weiblichen Gewalt leisten können.
Zunächst wird auf eine Auswahl pädagogisch-psychologischer Erklärungsansätze eingegangen. Dazu gehören zwei lerntheoretische Konzepte (Lernen am Modell und Lernen am Effekt), die auf Bandura (1979) zurückgehen sowie die Frustrations-Aggressions-Hypothese von Dolard et al (1939).
Im Anschluss daran wird der Fokus auf soziologische Theorien gerichtet. Der Individualisierungsansatz (Heitmeyer et al. 1995) sowie die „Power-Control“-Theorie (Hagan et al. 1979) werden herangezogen, um die zunehmende weibliche Gewalt zu erklären. Im Zusammenhang mit dem Individualisierungsansatz wird zudem auf die gesellschaftlichen Veränderungen („Risikogesellschaft“) und die Auswirkungen dieser Entwicklungen für insbesondere weibliche Jugendliche eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmungen
- Aggression
- Gewalt
- Zum Verhältnis von Aggression und Gewalt
- Mädchengewalt: Erscheinungsformen, Gegner und Anlässe
- Ausmaß und Entwicklung von Mädchengewalt in der Bundesrepublik Deutschland
- Das Ausmaß von Mädchengewalt im Spiegel der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS)
- Das Ausmaß von Mädchengewalt im Spiegel der Studie der Dunkelfeldstudie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) und des Bundesministeriums des Inneren (BMI)
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Theorien der Entstehung aggressiven Verhaltens
- Pädagogisch-psychologische Aggressionstheorien
- Lerntheoretische Erklärungsansätze nach Bandura (1979)
- Lernen am Modell
- Lernen am Effekt (Operantes Konditionieren)
- Die zunehmende Gewalt von Mädchen aus Sicht lerntheoretischer Konzepte
- Zusammenfassende Bewertung der lerntheoretischen Konzepte
- Die Frustrations-Aggressions-Theorie nach Dollard et al. (1939)
- Die zunehmende Gewalt von Mädchen aus Sicht der Frustrations-Aggressions-Theorie
- Zusammenfassende Bewertung der Frustrations-Aggressions-Theorie
- Zusammenfassende Bewertung der pädagogisch-psychologischen Theorien
- Lerntheoretische Erklärungsansätze nach Bandura (1979)
- Soziologische Aggressionstheorien
- Der Individualisierungsansatz nach Heitmeyer et al. (1995)
- Die „Risikogesellschaft“
- Die zunehmende Gewalt von Mädchen aus Sicht des Individualisierungsansatzes
- Zusammenfassende Bewertung des Individualisierungsansatzes
- Die „Power-Control“-Theorie nach Hagan et al. (1979)
- Die zunehmende Gewalt von Mädchen aus Sicht der „Power-Control“-Theorie
- Zusammenfassende Bewertung der „Power-Control“-Theorie
- Zusammenfassende Bewertung der soziologischen Ansätze
- Der Individualisierungsansatz nach Heitmeyer et al. (1995)
- Risiko- und Schutzfaktoren aggressiven Verhaltens
- Begriffsbestimmungen: Risiko- und Schutzfaktoren
- Allgemeine Anmerkungen bezüglich der Aussagekraft und Wirkung der Risiko- und Schutzfaktoren
- Zur Aussagekraft der Risiko- und Schutzfaktoren
- Das Zusammenwirken von Risiko- und Schutzfaktoren
- Individuelle und soziale Einflussfaktoren
- Individuelle Merkmale
- Familie
- Gleichaltrige
- Schule
- Medien
- Risiko- und Schutzfaktoren: männlich - weiblich?
- Zusammenfassung
- Prävention und Intervention
- Begriffsbestimmungen: Prävention und Intervention
- Formen der Prävention
- Strukturbezogene und personenbezogene Prävention
- Primäre, sekundäre und tertiäre Prävention
- Zum Präventions- und Interventionsverständnis dieser Arbeit
- Gewaltprävention mit Mädchen
- Die Notwendigkeit geschlechtsbezogener Prävention
- Inhalte und Prinzipien der Gewaltprävention mit Mädchen
- Inhalte und Ziele der Gewaltprävention mit Mädchen
- Prinzipien der Gewaltprävention mit Mädchen
- Das Anti-Aggressivitäts- (AAT) und Coolness-Training (CT) für Mädchen
- Die Grundidee des Anti-Aggressivitäts-Trainings (AAT)
- Rahmenbedingungen und Methoden
- Trainingsinhalte und Ziele
- Trainingsablauf
- Zusammenfassende Bewertung des Anti-Aggressivitäts- (AAT) und Coolness-Trainings (CT) für Mädchen
- Zusammenfassung
- Resümee und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Mädchengewalt und beleuchtet die Frage, wie die zunehmende Gewalt von Mädchen zu erklären ist. Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Phänomens im Kontext der gesellschaftlichen Geschlechterordnung und analysiert verschiedene Theorien, die die Entstehung aggressiven Verhaltens erklären. Darüber hinaus werden Risiko- und Schutzfaktoren aggressiven Verhaltens, insbesondere im Hinblick auf Geschlechterunterschiede, beleuchtet. Die Arbeit schließt mit einem Blick auf Präventions- und Interventionsmaßnahmen, die speziell auf Mädchen und deren Gewalttätigkeit zugeschnitten sind.
- Die Entstehung und Entwicklung von Mädchengewalt
- Theorien der Entstehung aggressiven Verhaltens
- Risiko- und Schutzfaktoren aggressiven Verhaltens
- Präventions- und Interventionsmaßnahmen im Kontext von Mädchengewalt
- Der Einfluss der gesellschaftlichen Geschlechterordnung auf die Entstehung von Mädchengewalt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Mädchengewalt ein und verdeutlicht die Bedeutung einer geschlechtsspezifischen Perspektive auf das Phänomen. Das zweite Kapitel definiert die Begriffe Aggression und Gewalt und untersucht das Verhältnis zwischen beiden. Das dritte Kapitel beleuchtet die Erscheinungsformen, Gegner und Anlässe von Mädchengewalt. Das vierte Kapitel analysiert das Ausmaß und die Entwicklung von Mädchengewalt in Deutschland anhand der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) und der Dunkelfeldstudie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) und des Bundesministeriums des Inneren (BMI). Kapitel fünf widmet sich verschiedenen Theorien, die die Entstehung aggressiven Verhaltens erklären, darunter pädagogisch-psychologische und soziologische Ansätze. Kapitel sechs untersucht Risiko- und Schutzfaktoren aggressiven Verhaltens, wobei die Rolle individueller und sozialer Einflussfaktoren sowie die Frage nach geschlechtsspezifischen Unterschieden beleuchtet werden. Kapitel sieben behandelt Präventions- und Interventionsmaßnahmen im Kontext von Mädchengewalt und diskutiert die Notwendigkeit geschlechtsbezogener Ansätze. Das Resümee fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsperspektiven.
Schlüsselwörter
Mädchengewalt, Aggression, Gewalt, Geschlechterordnung, pädagogisch-psychologische Theorien, soziologische Theorien, Risiko- und Schutzfaktoren, Prävention, Intervention, Dunkelfeldstudie, Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS), Anti-Aggressivitäts-Training (AAT), Coolness-Training (CT).
Häufig gestellte Fragen
Welche Theorien erklären aggressives Verhalten bei Mädchen?
Die Arbeit untersucht pädagogisch-psychologische Ansätze wie Banduras Lernen am Modell sowie soziologische Theorien wie den Individualisierungsansatz von Heitmeyer und die Power-Control-Theorie.
Was ist das Anti-Aggressivitäts-Training (AAT) für Mädchen?
Das AAT ist eine Interventionsmethode, die darauf abzielt, gewaltbereiten Jugendlichen ihre Verhaltensmuster bewusst zu machen und alternative, gewaltfreie Handlungsstrategien zu trainieren.
Wie hat sich die Mädchengewalt laut PKS entwickelt?
Die Arbeit analysiert Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) und stellt fest, dass die registrierte Gewaltkriminalität bei Mädchen zugenommen hat, wobei auch Dunkelfeldstudien zur Einordnung genutzt werden.
Welche Rolle spielt die „Risikogesellschaft“ bei Mädchengewalt?
Nach Heitmeyer führen gesellschaftliche Individualisierungsprozesse in der Risikogesellschaft zu Orientierungslosigkeit, die sich bei Jugendlichen in Form von Gewalt als Kompensationsversuch äußern kann.
Gibt es geschlechtsspezifische Risiko- und Schutzfaktoren?
Ja, die Arbeit untersucht, wie Faktoren in Familie, Schule und Medien bei Mädchen anders wirken als bei Jungen und welche Schutzmechanismen speziell für weibliche Jugendliche wichtig sind.
- Pädagogisch-psychologische Aggressionstheorien
- Citation du texte
- Lydia Oesterwinter (Auteur), 2010, Mädchen und Gewalt. Erscheinungsformen, Gegner und Anlässe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168709