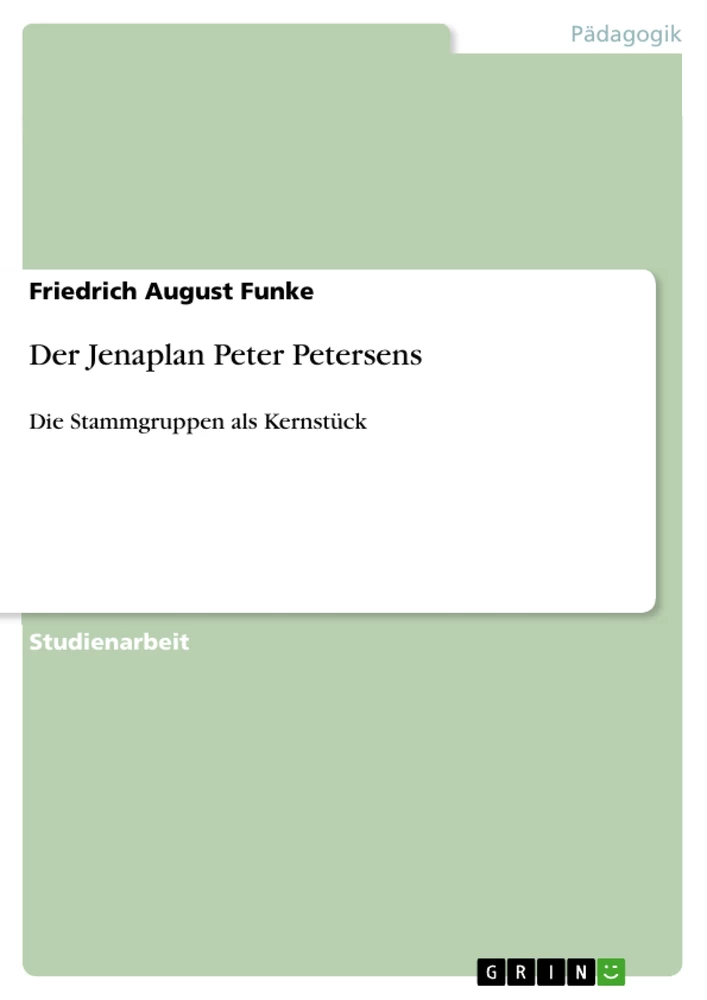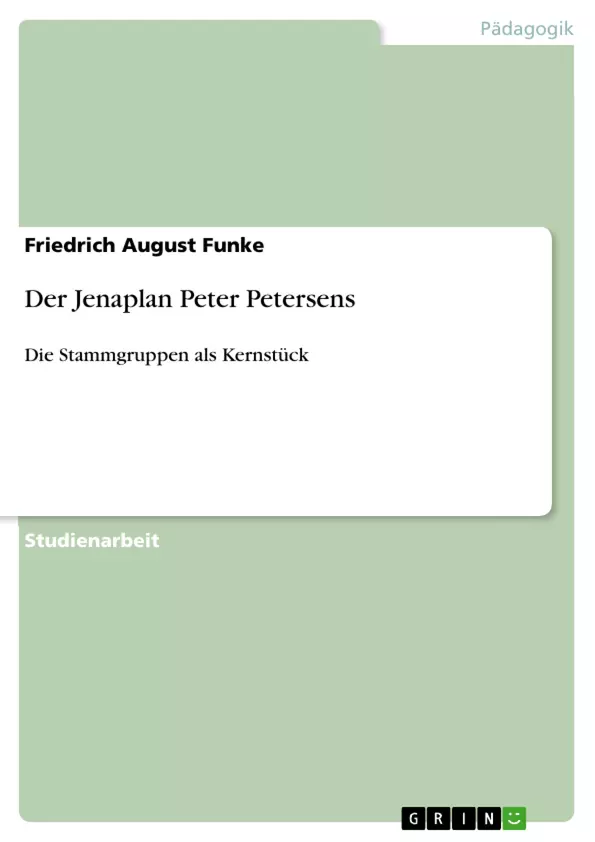Die Pädagogik Peter Petersens reiht sich in die internationale Reformpädagogik der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts ein und bietet sinnvolle und gut durchdachte Ansätze für das Schulleben, welches sich von der aktuellen Regelschule abhebt und ein Bildungsverständnis in den Vordergrund rückt, dass die Persönlichkeitsbildung betont.1 Peter Petersen wollte mit seinem Schulmodell und der parallel dazu durchgeführten Lehrerausbildung in Jena das Erziehungssystem reformieren. Trotz der Tatsache, dass der Jenaplan2 schon über 80 Jahre alt ist, ist diese Pädagogik nicht stehengeblieben, sondern hat sich stetig weiterentwickelt. Die Humanität und Solidarität, die Petersen mit seiner Bildung bei den Schülern erreichen wollte, ist zeitlos und aufgrund dessen ist der Jenaplan weiterhin aktuell und wird in verschiedenen Bereichen der Didaktik rezipiert. Es ist nicht verwunderlich, dass gewisse Elemente der pädagogisch-didaktischen Konzeption Petersens ebenso in staatlichen Regelschulen auftauchen, wobei diese sehr weit von der Arbeits- und Gemeinschaftsschule Petersens entfernt sind. Sie bilden weiterhin einen kompletten Gegensatz zu den Jenaplan-Schulen, von denen derzeit 49 allein in Deutschland vorhanden sind.3 Ich werde in dieser Seminararbeit auf den Jenaplan und seine wesentlichen Merkmale eingehen, allerdings soll der Fokus vielmehr auf das Kernstück von Petersen, den Stammgruppen, gerichtet sein. Peter Petersen nutzte dieses Modell zur Gliederung in der Schule, da er durch Beobachtungen des Gruppenverhaltens von spielenden Kindern analysiert hatte, dass sich nie ausschließlich Gleichaltrige zusammenfinden. Ähnliche Ergebnisse konnte er auch im Rahmen seiner Pädagogischen Tatsachenforschung in Jena feststellen und damit seine These untermauern.
Die Stammgruppe wird in der Regel als DAS zentrale Kennzeichen des von Peter Petersen entwickelten Schulkonzeptes angesehen und wahrgenommen. Somit werde ich neben einer kurzen biografischen Darstellung von Peter Petersen eingehend analysieren, inwieweit er im Jenaplan die Stammgruppen darstellt, welche Bedeutung diesem Element zukommt und wie seine Theorie in Jenaplan-Schulen der Gegenwart umgesetzt und angewendet wird.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Vorwort
- Der Jenaplan Peter Petersens
- Zur Person Peter Petersen
- Die Anfänge der Jenaplan-Pädagogik
- Wesentliche Merkmale des Jenaplans
- Die Stammgruppe
- Charakterisierung im Jena-Plan Petersens
- Vor-& Nachteile
- Bedeutung für das aktuelle Konzept an Jenaplan-Schulen
- Der Jenaplan in der Gegenwart
- Jenaplan-Schulen in Deutschland
- Ausblick in die Zukunft
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Jenaplan-Pädagogik Peter Petersens, einem reformpädagogischen Ansatz, der das Bildungssystem neu definieren wollte, indem er die Persönlichkeitsbildung in den Vordergrund stellte. Die Arbeit untersucht insbesondere die Stammgruppen, ein zentrales Element des Jenaplan-Konzepts, und analysiert ihre Bedeutung im Kontext von Petersens pädagogischer Theorie und ihrer Umsetzung in modernen Jenaplan-Schulen.
- Die Biografie und die pädagogischen Grundideen von Peter Petersen
- Die Bedeutung der Stammgruppen als zentrales Merkmal des Jenaplans
- Die Vor- und Nachteile der Stammgruppen im schulischen Kontext
- Die Aktualität und Relevanz der Jenaplan-Pädagogik im heutigen Bildungssystem
- Die Umsetzung der Stammgruppen an modernen Jenaplan-Schulen
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Das Vorwort stellt die Relevanz der Jenaplan-Pädagogik Peter Petersens im Kontext der Reformpädagogik des 20. Jahrhunderts dar und führt in das Thema der Seminararbeit ein.
- Der erste Abschnitt beleuchtet die Person Peter Petersens und seine Biografie, wobei besondere Aufmerksamkeit auf seine Motivation für die Entwicklung des Jenaplans gelegt wird.
- Der zweite Abschnitt befasst sich mit den Anfängen der Jenaplan-Pädagogik und erläutert die Entstehung des Konzepts im Kontext von Petersens pädagogischen Erfahrungen und wissenschaftlichen Studien.
- Der dritte Abschnitt widmet sich der Stammgruppe, einem zentralen Element des Jenaplan-Konzepts. Es werden die Charakteristika der Stammgruppen im Sinne Petersens beschrieben und ihre Bedeutung für das aktuelle Konzept an Jenaplan-Schulen erläutert.
- Der vierte Abschnitt behandelt die Jenaplan-Pädagogik in der Gegenwart und untersucht die Verbreitung von Jenaplan-Schulen in Deutschland. Außerdem wird ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung des Jenaplan-Konzepts gegeben.
Schlüsselwörter (Keywords)
Diese Seminararbeit behandelt die Kernaspekte des Jenaplans von Peter Petersen, insbesondere die Stammgruppen als zentrales Element des pädagogischen Konzepts. Die Arbeit beleuchtet Petersens Biografie, die Entstehung des Jenaplans, die wichtigsten Merkmale des Konzepts und die Umsetzung des Stammgruppen-Modells an modernen Jenaplan-Schulen. Die Analyse der Stammgruppen umfasst ihre Charakteristika, Vor- und Nachteile sowie ihre Bedeutung für die pädagogische Praxis.
- Quote paper
- Friedrich August Funke (Author), 2010, Der Jenaplan Peter Petersens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168742