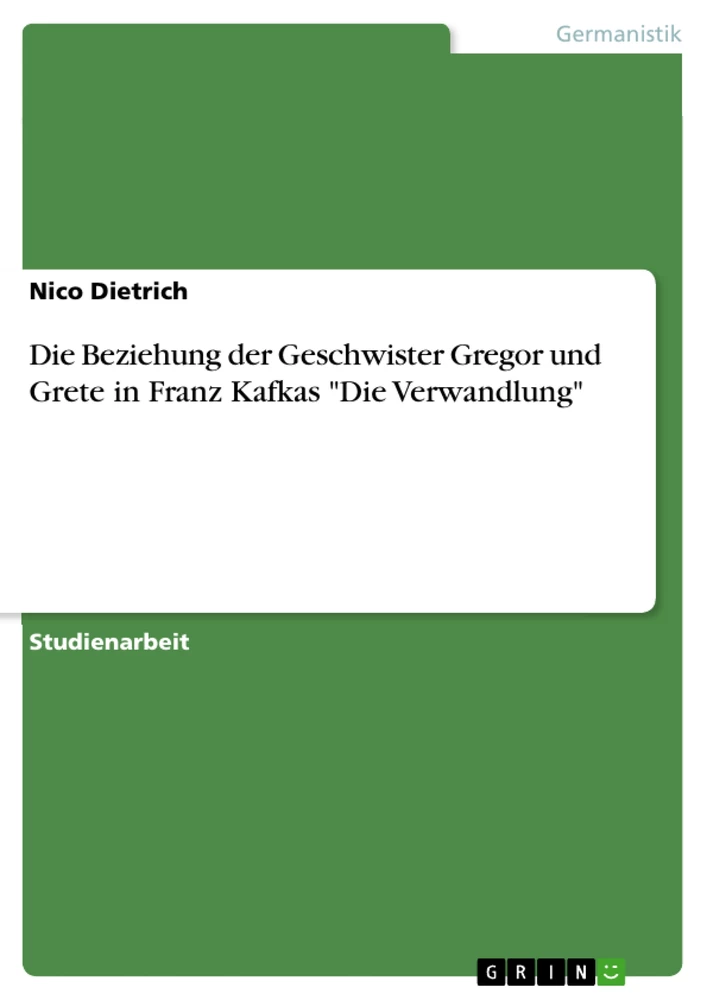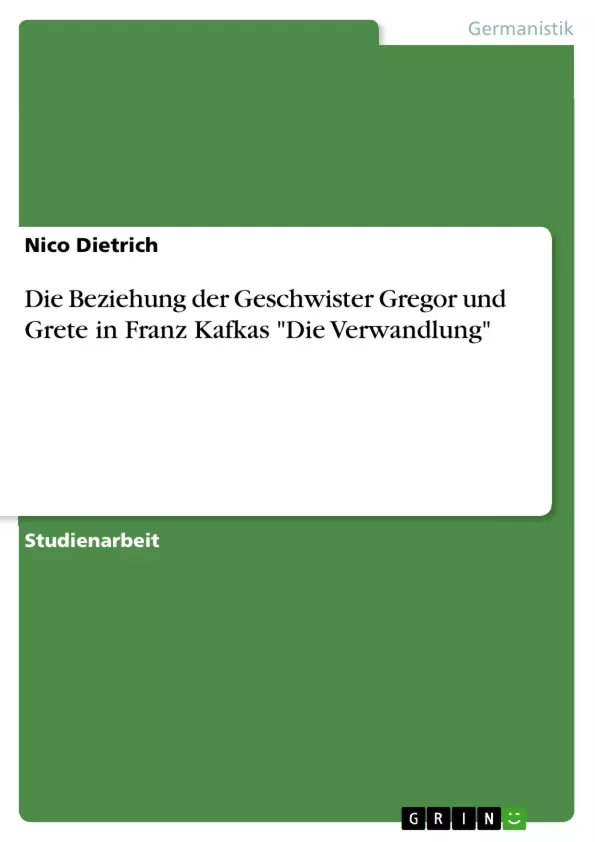"Sie wird mich also doch verkommen lassen." (Kafka:Briefe, 2005, S.299) schreibt Franz Kafka im Frühling 1917 an seine Schwester Otilie, genannt Ottla, nachdem diese die gemeinsame Heimatstadt Prag verlassen hatte. "Verkommen" wird auch Gregor Samsa in Franz Kafkas 1915 erschienener Erzählung "Die Verwandlung" mit der sich diese Arbeit befasst. Die in "Die Weißen Blätter" von René Schickele erstmals veröffentlichte Verwandlungsgeschichte bietet eine Fülle von Interpretationsmöglichkeiten an. Dabei lassen sich verschiedenste Vorgehensweisen, wie etwa die theologische Interpretation von Kurt Weinberg (vgl. Weinberg, 1963) oder die psychoanalytische von Hellmuth Kaiser (vgl. Kaiser, 1973), unterscheiden. Bereits der Titel "Die Verwandlung" bildet den Rahmen für ein breites Spektrum von Interpretationen, welche von der metabolischen Verwandlung über den Rollentausch zwischen Mutter und Tochter bis zur Wandelung der Vater-Sohn-Beziehung Eingang in der Sekundärliteratur gefunden haben. Um diesen "klassischen" Themen zu entrinnen, soll es im Folgenden um die Beziehungen der Geschwister Grete und Gregor Samsa zueinander gehen. Im Speziellen wird untersucht, ob und wenn ja, inwieweit sich die Verwandlung des Sohnes reziprok auf die Tochter übertragen lässt. Diesen Aspekt der Verwandlung innerhalb der Familienmitglieder beziehen nur wenige der unzähligen Interpretationen in ihre Darstellung ein. Wesentlich häufiger werden Vergleiche zwischen Vater und Sohn bzw. zwischen Mutter und Schwester literarisch umgesetzt.
Notwendigerweise setzt dieser spezielle Themenbereich eine Analyse der Familienzustände in der Zeit vor der Verwandlung voraus, um die Entwicklung über den Tod der Hauptfigur hinaus aufzeigen zu können. Weiterhin soll die Fragestellung durch genaue Analyse ausgewählter Passagen des Werkes validiert oder ggf. auch falsifiziert werden. Bisherige Forschungsmeinungen werden an entsprechenden Stellen ebenfalls dargstellt.
Eine vollständige Untersuchung des kompletten Textes bezüglich des Themas verbietet sich schon deshalb, da sie den Rahmen dieser Arbeit bei weitem übersteigen würde. Auf Aussagen Kafkas zu seinem Werk, Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte sowie auf die Darstellung biografischer Auffälligkeiten muss daher verzichtet werden.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Die Beziehung der Geschwister Gregor und Grete
- 2.1. Die jungen Samsas – Individuen und Geschwister
- 2.2. Die reziproke Verwandlung
- 2.3. Absolute Entfremdung
- 3. Fazit
- 4. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit untersucht die Beziehung der Geschwister Gregor und Grete in Franz Kafkas „Die Verwandlung“, insbesondere die Frage, ob und inwieweit die Verwandlung des Bruders sich auf die Schwester auswirkt.
- Analyse der Familiendynamik vor Gregors Verwandlung
- Untersuchung der reziproken Verwandlung zwischen Gregor und Grete
- Bewertung der Auswirkungen von Gregors Verwandlung auf Gretes Entwicklung
- Betrachtung der Entfremdung zwischen den Geschwistern
- Interpretation der Symbolkraft der Verwandlung im Kontext der Geschwisterbeziehung
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung beleuchtet die Thematik der Verwandlung in Kafkas Werk und führt die Fokussierung auf die Beziehung der Geschwister ein. Kapitel 2.1 schildert die Persönlichkeit und die Beziehung der Geschwister vor Gregors Verwandlung, wobei Gregor als verantwortungsbewusster Sohn und Grete als eher unbeschwertes Mädchen dargestellt werden.
Kapitel 2.2 setzt sich mit der Frage auseinander, ob sich Gregors Verwandlung auf Grete übertragen lässt und wie sich die Beziehung zwischen den Geschwistern in dieser neuen Situation verändert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Verwandlung, Geschwisterbeziehung, Familiendynamik, Entfremdung und Symbolismus in Franz Kafkas „Die Verwandlung“. Besondere Bedeutung kommt dabei den Figuren Gregor und Grete Samsa sowie deren individueller Entwicklung und Interaktion innerhalb der familiären Konstellation zu.
Häufig gestellte Fragen
Wie ist die Beziehung zwischen Gregor und Grete Samsa zu Beginn?
Vor der Verwandlung ist die Beziehung eng; Gregor übernimmt die Verantwortung für die Familie und möchte Grete sogar den Besuch des Konservatoriums ermöglichen.
Was versteht man unter der "reziproken Verwandlung" in der Arbeit?
Die Arbeit untersucht, ob Grete eine eigene Wandlung durchläuft (vom Mädchen zur Frau, von der Abhängigkeit zur Dominanz), die durch Gregors physische Verwandlung ausgelöst wird.
Warum entfremden sich die Geschwister im Laufe der Erzählung?
Die anfängliche Fürsorge Gretes schlägt in Ekel und Überforderung um. Gregors Unfähigkeit zu kommunizieren führt zu einer absoluten Entfremdung, bis Grete schließlich seinen Tod fordert.
Welche Rolle spielt die Familiendynamik in Kafkas Werk?
Die Verwandlung legt die brüchigen Machtverhältnisse und Abhängigkeiten innerhalb der Familie Samsa offen, wobei der Fokus oft auf der Vater-Sohn-Beziehung liegt, hier jedoch auf den Geschwistern.
Wie wird Grete am Ende der Erzählung dargestellt?
Nach Gregors Tod blüht Grete auf und wird von den Eltern als heiratsfähige junge Frau wahrgenommen, was ihre vollständige "Verwandlung" und Loslösung vom Bruder besiegelt.
- Arbeit zitieren
- Nico Dietrich (Autor:in), 2008, Die Beziehung der Geschwister Gregor und Grete in Franz Kafkas "Die Verwandlung", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168748