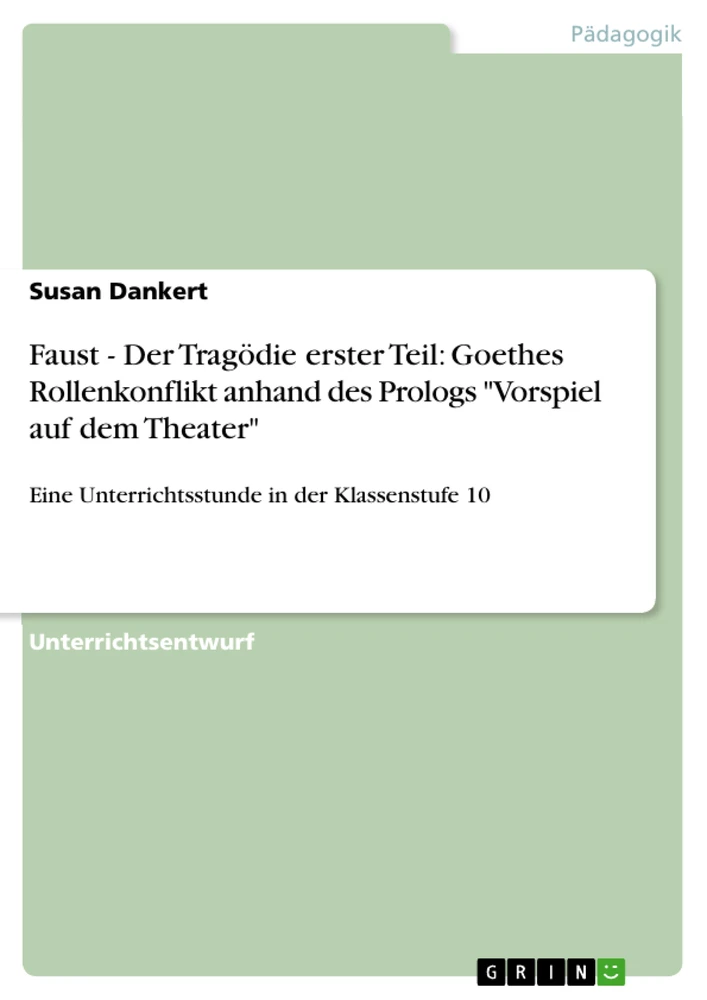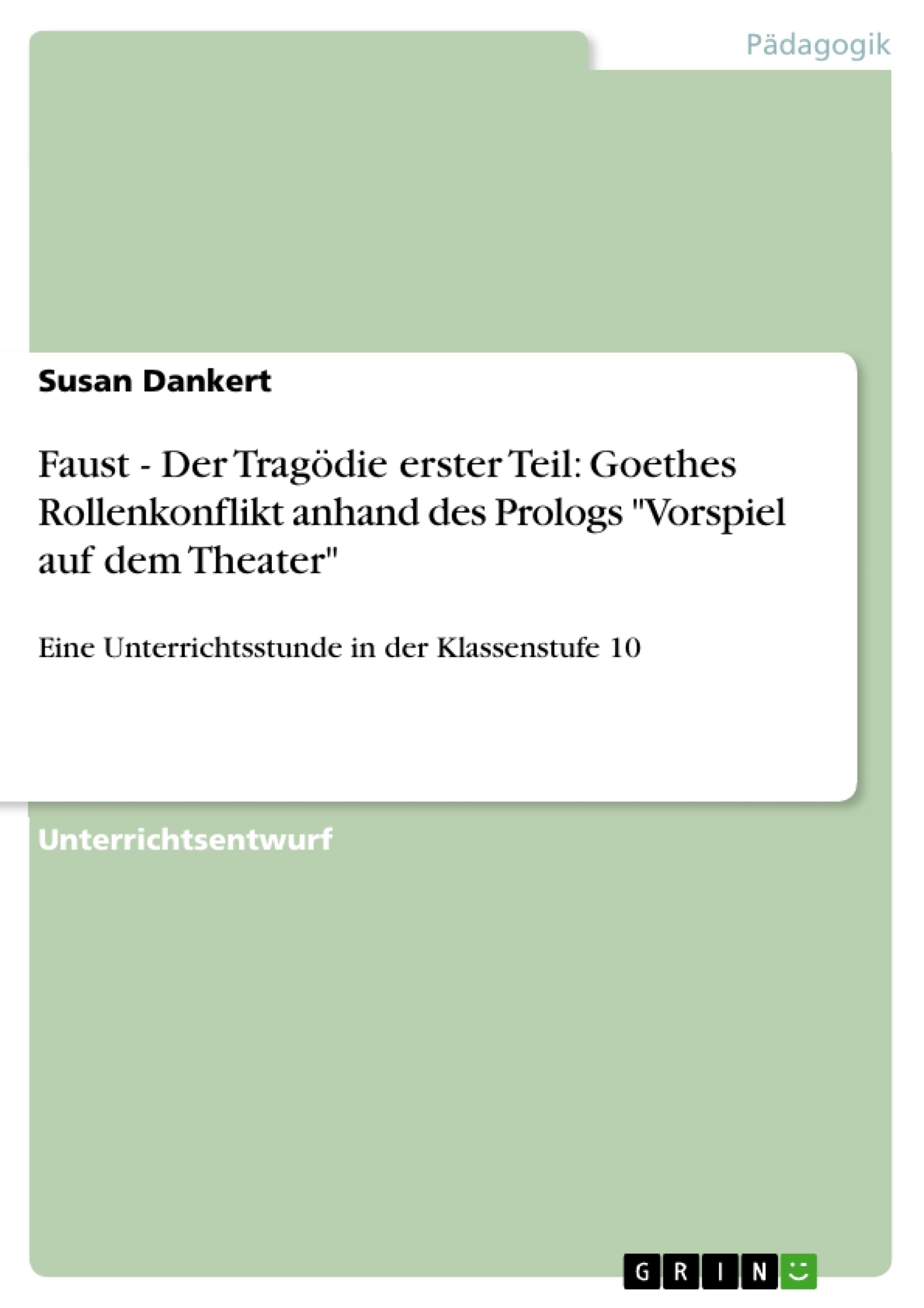In der vorliegenden, 22 Unterrichtsstunden umfassenden Unterrichtseinheit setzen sich die SuS auf verschiedenen Wegen mit dem Werk Faust – der Tragödie erster Teil auseinander. Im Rahmen dessen werden die Fertigkeiten im Bereich „Umgang mit Texten“ und konkret im „Verstehen, Analysieren und Interpretieren von literarischen Texten – vertiefende Rezeption“29 geschult. Auf eine allgemeine Einführung zum Werk und dessen kulturellen Bedeutung anhand geflügelter Worte aus dem Werk folgte eine Auseinandersetzung mit der Entwicklung des Fauststoffes und somit mit zentralen Motiven und Themen des Werkes. Darüber hinaus wurde in der biographische, historische und literaturhistorische Hintergrund (Weimarer Klassik) in einer Übersicht erarbeitet. Der erste rolog zum Werk - „Zueignung“ - sowie die Erarbeitung der unterschiedlichen Positionen im „Vorspiel auf dem Theater“ fand in jener vor der Prüfungsstunde gelegenen Lernzeit statt. Im Anschluss an die Prüfungsstunde zum „Vorspiel auf dem Theater“ erfolgt eine detaillierte Analyse und Interpretation der Szenen „Prolog im Himmel“ und „Nacht“. Daraufhin wird die Verfilmung der Faust-Inszenierung des Hamburger Schauspielhauses aus dem Jahr 1960 gezeigt, in der Gustaf Gründgens als Mephisto brilliert, und den SuS somit ein Überblick über den weiteren Handlungsverlauf gegeben. Auf diese Weise erhalten die SuS eine Orientierung für die Gestaltung von Mini-Projekten, die im Anschluss stattfinden sollen. Im projektorientierten Lernen wählen die SuS gruppenweise eine Szene aus dem Werk aus und bereiten diese auf unterschiedlichste Weise für eine Präsentation auf (Hörspiel, Video-Clip, Szenische Interpretation, Schattenspiel, Puppenspiel, Rollensplitting o.ä.). Diese werden sie dann im Rahmen des Kurses durchführen und deren Gestaltung entsprechend durch die Literaturvorlage begründen, d.h. eine Szeneninterpretation mit einem entsprechenden Schwerpunkt (Figurencharakterisierung, Sprachliche Gestaltung, Figurenkonstellation etc.) wird zugrunde gelegt. Abgeschlossen wird die Einheit schließlich durch eine Evaluation der Unterrichtseinheit sowie durch das Aufgreifen jener, in den Anfangsstunden erarbeiteten Thesen und deren Verifikation bzw. Negation in Form einer Diskussion.
Inhaltsverzeichnis
- Unterrichtliche Vorbedingungen
- Die Lerngruppe
- Die Referendarin
- Schulspezifische Voraussetzungen
- Didaktische Analyse
- Sachanalyse
- Stellung der Stunde in der Unterrichtseinheit
- Didaktische Überlegungen
- Ziele
- Methodische Analyse
- Tabellarischer Entwurf
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Lehrprobenentwurf im Fach Deutsch befasst sich mit Goethes „Faust - Der Tragödie erster Teil“. Die Stunde analysiert den Prolog „Vorspiel auf dem Theater“ und untersucht den Rollenkonflikt, dem Faust im Stück begegnet. Die Stunde zielt darauf ab, den SuS das Verständnis für Fausts innere Zerrissenheit zu vermitteln.
- Fausts Streben nach Wissen und Macht
- Der Konflikt zwischen Mensch und Gott
- Die Rolle des Theaters im Stück
- Die Bedeutung der Figuren des Himmels und der Erde
- Die Rolle der Sprache im Stück
Zusammenfassung der Kapitel
Unterrichtliche Vorbedingungen
Dieser Abschnitt bietet eine detaillierte Beschreibung der Lerngruppe, der Referendarin und der schulspezifischen Voraussetzungen. Die Lerngruppe ist heterogen und besteht aus 15 SuS, darunter vier Mädchen und elf Jungen. Die Referendarin beschreibt ihre Erfahrungen mit der Klasse und die Herausforderungen, die sich aus der ambivalenten Beziehung zu den SuS ergeben. Außerdem werden die Besonderheiten der Schule, ihrer Philosophie und des Schullebens dargestellt.
Didaktische Analyse
Dieser Abschnitt analysiert die Inhalte und Ziele der Unterrichtseinheit und stellt die didaktischen Überlegungen dar. Die Stunde wird in den Kontext der gesamten Unterrichtseinheit eingeordnet und es wird erläutert, wie sie zu den Lernzielen der Einheit beiträgt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter sind „Faust“, „Goethe“, „Rollenkonflikt“, „Prolog“, „Vorspiel auf dem Theater“, „Streben nach Wissen“, „Mensch und Gott“, „Theater“, „Himmel und Erde“, „Sprache“.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hat das "Vorspiel auf dem Theater" in Goethes Faust?
Es thematisiert unterschiedliche Positionen zum Theater und zur Kunst und bereitet auf den Rollenkonflikt und die Zerrissenheit der Hauptfigur vor.
Was charakterisiert Fausts Rollenkonflikt?
Faust steht im Spannungsfeld zwischen seinem extremen Streben nach Wissen und Macht sowie seiner menschlichen Begrenztheit.
Wie wird das Werk im Unterricht vermittelt?
Die Unterrichtseinheit nutzt Methoden wie Szenische Interpretation, Video-Clips und Hörspiele, um den SuS den Zugang zum klassischen Stoff zu erleichtern.
Welche Rolle spielt die Weimarer Klassik?
Sie bildet den literaturhistorischen Hintergrund, vor dem Goethes Werk und dessen Motive wie der Konflikt zwischen Mensch und Gott analysiert werden.
Warum wird die Verfilmung von Gustaf Gründgens gezeigt?
Die Inszenierung von 1960 gilt als Referenzwerk, das den Schülern einen Überblick über den Handlungsverlauf und die Charakterisierung von Mephisto bietet.
- Quote paper
- Susan Dankert (Author), 2011, Faust - Der Tragödie erster Teil: Goethes Rollenkonflikt anhand des Prologs "Vorspiel auf dem Theater" , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168889