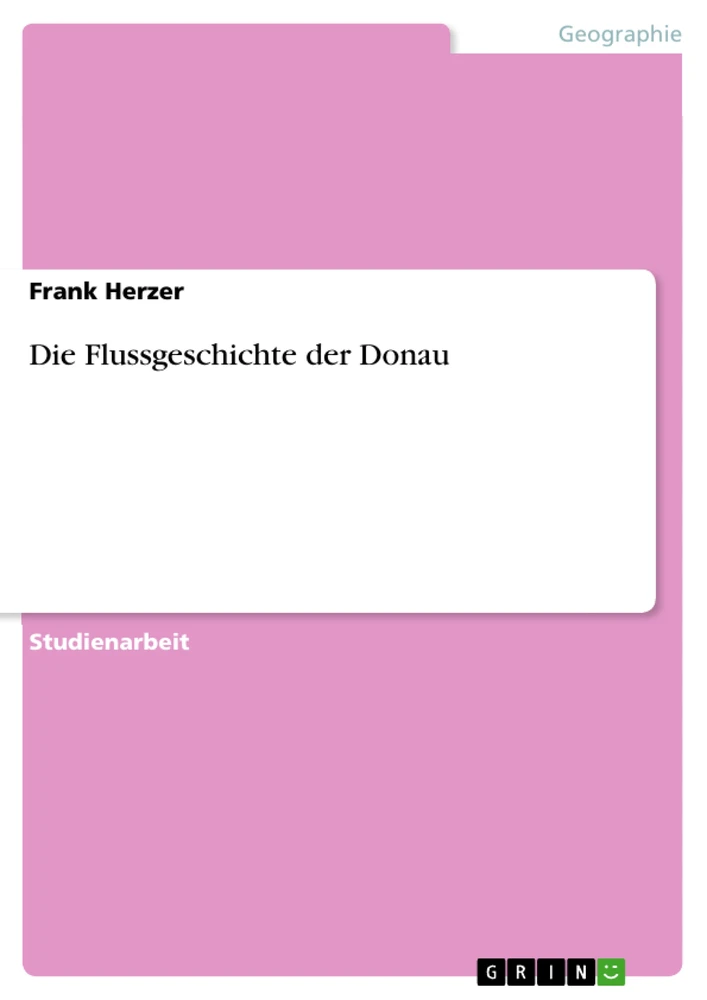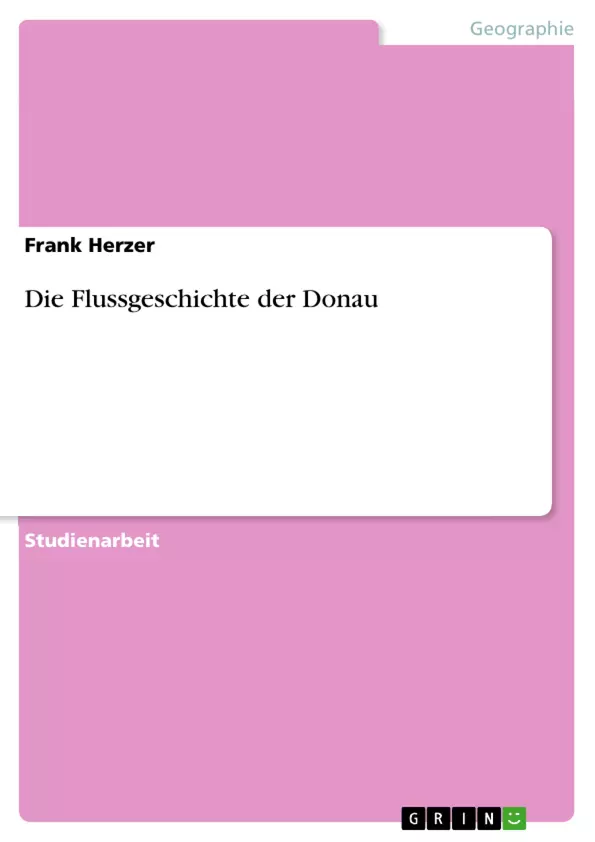Die Donau ist einer der längsten und wasserreichsten Flüsse Europas. Sie hat ein riesiges Einzugsgebiet und entwässert große Teile des südlichen Mitteleuropas und Südosteuropas. An vielen Stellen ist deutlich sichtbar, dass die Donau nicht immer ihr heutiges Flussbett durchfloss, sondern eine ereignisreiche Vergangenheit hat, die ihren Lauf häufig und einschneidend verändert hat.
„Von wann ab können wir in der Erdgeschichte einen Flusslauf nachweisen, welcher im allgemeinen demjenigen entspricht, den wir jetzt Donau nennen?“ (Zenetti, 1919, S. 7) Wie sah dieser aus? Wie hat sich die Donau weiter entwickelt und welche Umstände führten zu den Laufverlegungen? Ich möchte mich in der vorliegenden Arbeit diesen Fragestellungen widmen und dabei den heutigen Erkenntnisstand zum Thema darlegen. Der Schwerpunkt meiner Betrachtung soll auf dem oberen Teil der Donau liegen. In diesem Bereich, der sich hauptsächlich im Alpenvorland Süddeutschlands befindet, fanden die wichtigsten Prozesse und Veränderungen statt, welche die Entstehung der Donau in ihrer heutigen Form geprägt haben.
Nach einigen kurzen Erläuterungen zu Flusslaufentwicklungen im Allgemeinen werde ich, ausgehend vom gegenwärtigen Verlauf, die Flussgeschichte seit dem oberen Miozän darstellen. Ich gebe einen kurzen Überblick zum heutigen Forschungsstand, bevor ich auf die Entstehung und das Gewässersystem der Urdonau eingehe. Danach betrachte ich speziell die Geschichte des oberen und kurz die Geschichte des mittleren und unteren Flussabschnitts. Abschließend werde ich kurz den Einfluss des Menschen auf den Flusslauf aufzeigen und meine Ausführungen in den Schlussbemerkungen noch einmal zusammenfassen.
Die Flussgeschichte der Donau fand in einem ausgedehnten Zeitraum statt. Zum Zwecke der Verdeutlichung befindet sich im Anhang eine Zeittafel. Dort sind die wichtigsten Abschnitte der Entwicklung noch einmal geordnet dargestellt. Mit dieser Hilfe kann man die im Text verwendeten Angaben zeitlich besser einordnen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Flusslaufentwicklung im Überblick
- 2.1 Flussterrassen
- 3 Heutiger Flussverlauf
- 4 Flusslaufentwicklung der oberen Donau
- 4.1 Entstehung der Urdonau
- 4.2 Gewässersystem der Urdonau
- 4.3 Flusslaufverlegungen
- 4.3.1 Aaredonau
- 4.3.2 Alpenrhein
- 4.3.4 Flussanzapfung durch die Wutach
- 4.3.5 Ausblick
- 5 Entwicklung des mittleren und unterem Flusslaufes
- 6 Einfluss des Menschen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Flussgeschichte der Donau, insbesondere ihres Oberlaufs im süddeutschen Alpenvorland. Ziel ist die Darstellung des heutigen Erkenntnisstands zur Entwicklung des Flusses vom Obermiozän bis zur Gegenwart, unter Berücksichtigung der wichtigsten Prozesse und Veränderungen, die seine heutige Form geprägt haben.
- Entstehung und Entwicklung der Urdonau
- Wichtige Flusslaufverlegungen und deren Ursachen (tektonische und klimatische Faktoren)
- Veränderungen im Einzugsgebiet der Donau
- Der Einfluss von Vergletscherungen auf den Flusslauf
- Der Einfluss des Menschen auf den Flusslauf
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Arbeit befasst sich mit der Flussgeschichte der Donau, konzentriert sich auf den Oberlauf im süddeutschen Alpenvorland und beleuchtet die Entwicklung des Flusslaufs seit dem Obermiozän. Die Arbeit untersucht die Fragestellungen nach dem Zeitpunkt des Auftretens eines dem heutigen ähnlichen Flusslaufs, dessen Aussehen und die Ursachen für Laufverlegungen.
2 Flusslaufentwicklung im Überblick: Dieses Kapitel beschreibt allgemeine Methoden zur Rekonstruktion der Flussgeschichte anhand von Groß- und Kleinformen, wobei Flussterrassen als besonders aussagekräftige Indikatoren hervorgehoben werden. Die Entstehung von Flussterrassen wird durch Wechselwirkungen von Erosion und Akkumulation, beeinflusst von tektonischen und klimatischen Faktoren, erklärt. Die Vergletscherung im Pleistozän wird als weitere wichtige Ursache für die Terrassenbildung identifiziert.
3 Heutiger Flussverlauf: Das Kapitel beschreibt den heutigen Verlauf der Donau, ihre Länge, Wasserführung und Einzugsgebiet. Es werden die wichtigsten Zuflüsse und Städte entlang des Flusslaufs genannt, wobei die Besonderheit der von der Mündung zur Quelle gerichteten Kilometerzählung und die von Westen nach Osten verlaufende Fließrichtung hervorgehoben werden.
4 Flusslaufentwicklung der oberen Donau: Dieses Kapitel stellt die Entwicklung der oberen Donau dar, beginnend mit der Entstehung der Urdonau im Obermiozän vor etwa 5-10 Millionen Jahren. Es beschreibt das damalige Relief und die tektonischen Bewegungen, die zur Ausbildung eines ostwärts gerichteten Abflusssystems führten. Die Urdonau und ihr Gewässersystem werden detailliert beschrieben, inklusive der Rolle von Zuflüssen wie der Aaredonau und dem Alpenrhein. Die verschiedenen Phasen der Flusslaufverlegungen werden im Detail analysiert, und die Gründe für diese Veränderungen, vor allem tektonische Hebungen und klimatische Einflüsse (Vergletscherungen), werden beleuchtet. Die Anzapfung der Feldbergdonau durch die Wutach wird ebenfalls detailliert beschrieben. Schließlich wird ein Ausblick auf mögliche zukünftige Veränderungen des Flusslaufs gegeben.
5 Entwicklung des mittleren und unterem Flusslaufes: Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die Entwicklung des mittleren und unteren Donaulaufs, basierend auf den Ausführungen von Handtke (1993). Es beschreibt die Rückwanderung des Schwarzen Meeres im Miozän und die damit verbundene Verlagerung der Donaufließrichtung nach Osten. Die Kaltzeiten und die damit verbundene Schuttfracht aus den Karpaten werden als Faktoren für die Gestaltung des Unterlaufs genannt.
6 Einfluss des Menschen: Der Einfluss des Menschen auf den Flusslauf, unter anderem durch Regulierungen, Korrekturen und den Bau von Kanälen, wird beleuchtet. Der Main-Donau-Kanal und der Donau-Schwarzmeer-Kanal werden als Beispiele genannt. Die Arbeit weist darauf hin, dass die menschlichen Eingriffe, obwohl sie Vorteile gebracht haben, auch negative Auswirkungen wie Hochwasser und Überschwemmungen nach sich ziehen können.
Schlüsselwörter
Donau, Flussgeschichte, Urdonau, Flusslaufverlegung, Alpenvorland, Tektonik, Klima, Vergletscherung, Aaredonau, Alpenrhein, Flussterrassen, Einzugsgebiet, Rhein, Menschlicher Einfluss, Hochwasser.
Häufig gestellte Fragen zur Donau-Flussgeschichte
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Flussgeschichte der Donau, insbesondere ihres Oberlaufs im süddeutschen Alpenvorland. Sie beleuchtet die Entwicklung des Flusses vom Obermiozän bis zur Gegenwart und die wichtigsten Prozesse und Veränderungen, die seine heutige Form geprägt haben. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entstehung und Entwicklung der Urdonau, wichtigen Flusslaufverlegungen und deren Ursachen (tektonische und klimatische Faktoren), Veränderungen im Einzugsgebiet, dem Einfluss von Vergletscherungen und dem Einfluss des Menschen.
Welche Methoden werden zur Rekonstruktion der Flussgeschichte verwendet?
Die Arbeit beschreibt allgemeine Methoden zur Rekonstruktion der Flussgeschichte anhand von Groß- und Kleinformen. Flussterrassen werden als besonders aussagekräftige Indikatoren hervorgehoben, deren Entstehung durch Wechselwirkungen von Erosion und Akkumulation, beeinflusst von tektonischen und klimatischen Faktoren, erklärt wird. Die Vergletscherung im Pleistozän wird als weitere wichtige Ursache für die Terrassenbildung identifiziert.
Wie wird der heutige Flussverlauf der Donau beschrieben?
Das Kapitel zum heutigen Flussverlauf beschreibt die Länge, Wasserführung und das Einzugsgebiet der Donau. Es werden die wichtigsten Zuflüsse und Städte entlang des Flusslaufs genannt, wobei die Besonderheit der von der Mündung zur Quelle gerichteten Kilometerzählung und die von Westen nach Osten verlaufende Fließrichtung hervorgehoben werden.
Wie wird die Entwicklung der oberen Donau dargestellt?
Die Entwicklung der oberen Donau wird von der Entstehung der Urdonau im Obermiozän (vor etwa 5-10 Millionen Jahren) dargestellt. Es werden das damalige Relief, tektonische Bewegungen, das Urdonau-Gewässersystem (inklusive Aaredonau und Alpenrhein), Phasen der Flusslaufverlegungen und deren Ursachen (tektonische Hebungen und klimatische Einflüsse, Vergletscherungen) detailliert analysiert. Die Anzapfung der Feldbergdonau durch die Wutach wird ebenfalls beschrieben. Ein Ausblick auf zukünftige Veränderungen schließt das Kapitel ab.
Wie wird die Entwicklung des mittleren und unteren Donaulaufs behandelt?
Die Entwicklung des mittleren und unteren Donaulaufs wird kurz anhand der Ausführungen von Handtke (1993) zusammengefasst. Die Rückwanderung des Schwarzen Meeres im Miozän und die damit verbundene Verlagerung der Donaufließrichtung nach Osten sowie die Kaltzeiten und die Schuttfracht aus den Karpaten werden als prägende Faktoren genannt.
Welchen Einfluss hat der Mensch auf den Flusslauf?
Der Einfluss des Menschen auf den Flusslauf wird durch Regulierungen, Korrekturen und den Bau von Kanälen (z.B. Main-Donau-Kanal und Donau-Schwarzmeer-Kanal) beleuchtet. Die Arbeit weist auf positive und negative Auswirkungen (Hochwasser, Überschwemmungen) hin.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter charakterisiert: Donau, Flussgeschichte, Urdonau, Flusslaufverlegung, Alpenvorland, Tektonik, Klima, Vergletscherung, Aaredonau, Alpenrhein, Flussterrassen, Einzugsgebiet, Rhein, Menschlicher Einfluss, Hochwasser.
- Arbeit zitieren
- Frank Herzer (Autor:in), 2010, Die Flussgeschichte der Donau, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168895