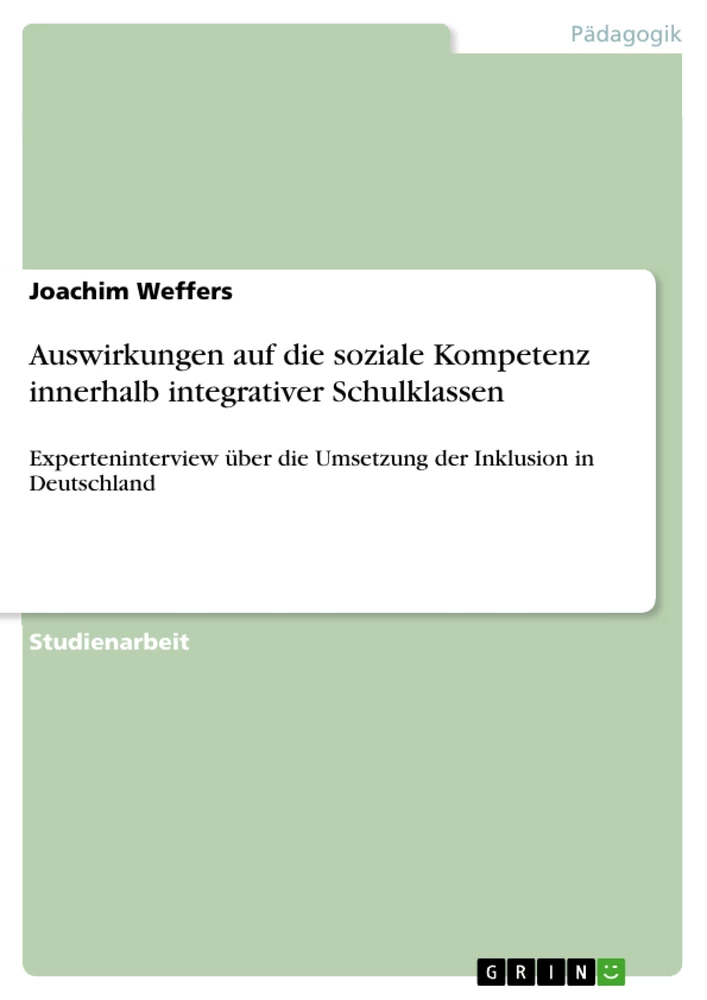Theorieumfeld und Forschungsgrundlage
Die UN–Generalversammlung hat am 13. Dezember 2006 eine Konvention zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen beschlossen. Diese Konvention wurde zum 26. März 2009 durch Ratifizierung unter Zustimmung des Bundesrates und Bundestages zu geltendem Recht. Im Zusammenhang mit dem Artikel 24 ist eine inklusive Schulform in Deutschland einzurichten. (Schumann, 2009, S.1). Bereits jetzt sind vielerorts integrative Schulklassen eingerichtet, welche zwar nicht dem Anspruch einer inklusiven Schule gerecht werden, jedoch neben der sachlichen Aussage einer Einbeziehung lernbenachteiligter Kinder in den regulären Schulprozess auch die bei der Umsetzung des Artikels 24 vielfach vorhandenen Vorbehalte aus zwischenmenschlicher Sichtweise widerspiegeln. Bereits seit Jahrzehnten gibt es Bestrebungen zur Integration behinderter Kinder in allgemeinbildende Schulen. So haben nach Müller Elterninitiativen in Hamburg seit 1981 verstärkt darauf gedrungen neue Formen gemeinsamen Lebens und Lernens behinderter und nichtbehinderter Kinder in der Schule zu entwickeln um Nachteile einer gesonderten pädagogischen Betreuung wo immer möglich zu vermeiden. Denn wie dort weiter festgestellt wird geht es darum, „auch im behinderten Kind nicht die „Behinderung“, sondern den ganzen Menschen zu sehen“ (Müller, 1988, S.26-27). Ist jedoch dieses Bedürfnis nach gemeinsamer schulischer Bildung in der Gesellschaft wirklich anerkannt und wird es gerade von den Eltern nichtbehinderter Kinder ebenfalls als sinnvoll oder sogar notwendig angesehen oder verweigern Eltern eine gemeinsame Beschulung aufgrund von Vorurteilen?
Innerhalb dieser Hausarbeit wird die Methode des Experteninterviews innerhalb der qualitativen Forschung angewendet um einen Überblick über die mögliche Steigerung der sozialen Kompetenz der Kinder zu erhalten, welche sich bereits in integrativen Schulklassen befinden. Besonderer Augenmerk ist auf die Darlegung der Interviewmethode gelegt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Theorieumfeld und Forschungsgrundlage
- 2.1. Herleitung und Darstellung der Forschungsfrage
- 2.2. Herleitung und Darstellung der Hypothesen
- 3. Betrachtung der qualitativen Methoden und Methodenauswahl
- 3.1. Überblick über qualitative Forschungsmethoden.
- 3.2. Methodenauswahl: Experteninterview…………
- 3.3. Besonderheiten dieser Interviewmethode
- 3.3.1. Leitfadenorientiertes Interview
- 3.3.2. Kennzeichen eines Experten und eines Interviewers ...
- 4. Datenerhebung und Umfeldbeschreibung ..
- 4.1. Durchführung des Interviews
- 4.2. Besonderheiten und Verbesserungsmöglichkeiten
- 4.3. Transkription …………
- 5. Datenauswertung mit Theoriebezug
- 5.1. Besonderheiten der Datenauswertung eines Experteninterviews . .
- 5.2. Paraphrase
- 5.3. Kodierung und Erstellung von Überschriften.
- 5.4. Thematischer Vergleich
- 5.5. Soziologische Konzeptualisierung
- 5.6. Theoretische Generalisierung
- 6. Fazit und Meta-Betrachtung des Forschungsergebnisses
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit untersucht die Auswirkungen integrativer Schulklassen auf die soziale Kompetenz von Schülern. Sie verfolgt das Ziel, die Entwicklung und Bedeutung von sozialer Kompetenz in diesem Kontext zu beleuchten, indem sie qualitative Forschungsmethoden, insbesondere Experteninterviews, einsetzt.
- Definition und Bedeutung sozialer Kompetenz
- Entwicklung sozialer Kompetenz in integrativen Schulklassen
- Herausforderungen und Chancen der Inklusion für die soziale Kompetenz
- Bedeutung der Elternrolle bei der Förderung sozialer Kompetenz
- Zusammenhang zwischen sozialer Kompetenz und Kooperation
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel bietet eine Einleitung in die Forschungsfrage und den Hintergrund der Arbeit. Es stellt die Relevanz von sozialer Kompetenz in heutigen Bildungssystemen dar und beleuchtet die spezifischen Anforderungen an soziale Kompetenzen in integrativen Schulklassen.
Kapitel 2 befasst sich mit dem theoretischen Umfeld und der Forschungsgrundlage der Arbeit. Es definiert den Begriff der sozialen Kompetenz aus verschiedenen Perspektiven und untersucht die Bedeutung von Inklusion im Kontext der UN-Konvention zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen.
Kapitel 3 beschreibt die qualitative Forschungsmethode des Experteninterviews. Es beleuchtet die Besonderheiten dieser Interviewmethode, den Leitfaden des Interviews und die Charakteristika eines Experten sowie eines Interviewers.
Kapitel 4 fokussiert auf die Datenerhebung und die Beschreibung des Umfelds. Es erläutert die Durchführung des Interviews, die Besonderheiten der Situation und die Verbesserungsmöglichkeiten für zukünftige Studien.
Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Datenauswertung unter Verwendung von Theoriebezug. Es beschreibt die Besonderheiten der Datenauswertung eines Experteninterviews, die Paraphrasierung der Interviewdaten, die Kodierung und Erstellung von Überschriften, den thematischen Vergleich, die soziologische Konzeptualisierung und die theoretische Generalisierung.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der sozialen Kompetenz, Inklusion, integrativen Schulklassen, Experteninterviews, qualitativen Forschungsmethoden, Elternbeteiligung, Kooperation und der Entwicklung von Kompetenzen in einem multikulturellen Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hat Inklusion auf die soziale Kompetenz von Schülern?
In integrativen Klassen lernen Kinder, nicht nur die „Behinderung“, sondern den ganzen Menschen zu sehen. Dies fördert Empathie, Kooperationsfähigkeit und den Abbau von Vorurteilen gegenüber Vielfalt.
Was ist die rechtliche Grundlage für inklusive Schulen in Deutschland?
Die Basis ist die UN-Behindertenrechtskonvention von 2006, die in Deutschland seit 2009 geltendes Recht ist. Artikel 24 verpflichtet die Vertragsstaaten zur Einrichtung eines inklusiven Bildungssystems.
Warum werden Experteninterviews in dieser Forschung eingesetzt?
Experteninterviews ermöglichen einen tiefen Einblick in die Praxis. Fachkräfte können fundierte Einschätzungen zur Entwicklung der sozialen Kompetenz und zu den täglichen Herausforderungen im integrativen Unterricht geben.
Welche Rolle spielen Vorurteile der Eltern bei der Inklusion?
Die Arbeit untersucht, ob Eltern nichtbehinderter Kinder die gemeinsame Beschulung als sinnvoll ansehen oder ob Vorbehalte die Umsetzung der Inklusion aus zwischenmenschlicher Sicht erschweren.
Wie wird die qualitative Datenauswertung durchgeführt?
Die Auswertung erfolgt über Transkription, Paraphrasierung, Kodierung und einen thematischen Vergleich, um schließlich zu einer theoretischen Generalisierung der Ergebnisse zu gelangen.
- Quote paper
- Joachim Weffers (Author), 2010, Auswirkungen auf die soziale Kompetenz innerhalb integrativer Schulklassen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168910