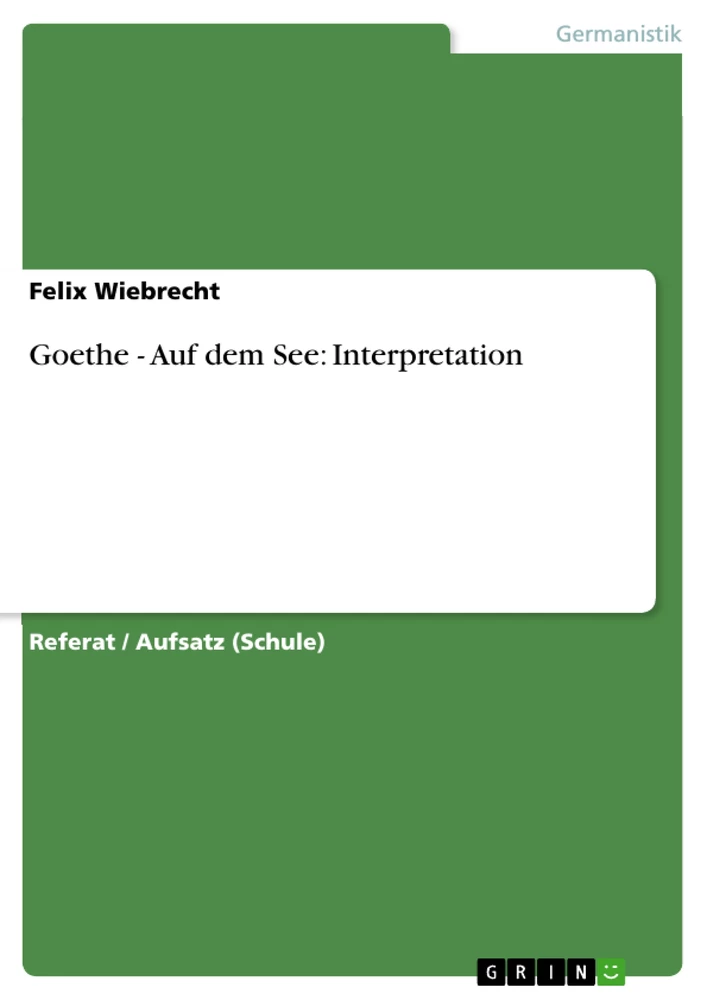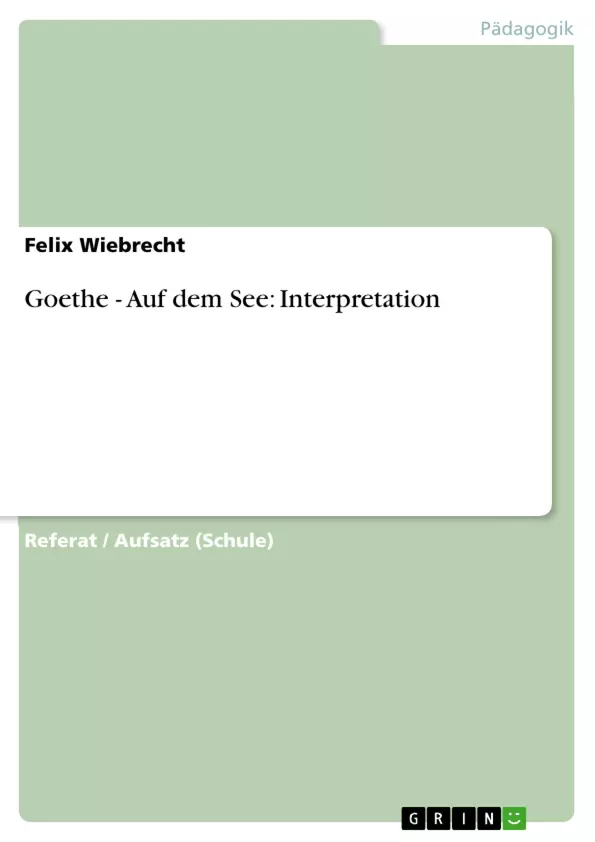In dieser Arbeit liegt eine Interpretion von Goethes "Auf dem See" aus dem Jahr 1775 vor.
Es gibt für viele Menschen besondere Orte. Plätze, an denen sie ihren stressbehafteten Alltag vergessen können. Orte, an denen sie an die schönen Dinge des Lebens denken können. Diese sind meist in der Natur gelegen, ruhig, versteckt und ohne menschliche Einwirkung. In seinem Gedicht „Auf dem See“ aus dem Jahr 1775 beschreibt Johann Wolfgang Goethe die Naturverbundenheit des lyrischen Ichs, das aus dieser neue Lebenskraft schafft, während einer Bootsfahrt.
In dem Gedicht unternimmt das lyrische Ich eine Bootsfahrt. Es lässt sich darauf schließen, dass es noch früh am Morgen ist. Durch die Natur, die immer wieder gelobt wird, schöpft es neue Kraft.
Zwischenzeitlich verfällt das lyrische Ich in Träume, aus denen es jedoch schnell wieder entkommen kann. In der dritten Strophe geht das lyrische Ich wieder zur Beschreibung der Natur über, diesmal allerdings konkreter als in der ersten Strophe.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Inhaltsangabe
- Beschreibung der äußeren Form
- systematische Darlegung der Analyseergebnisse unter Berücksichtigung der Inhalt-Form-Beziehung
- Darlegung der Intention
- historischer Bezug
- biographischer Bezug
- gesellschaftlicher Bezug
- persönliche Auseinandersetzung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Das Gedicht „Auf dem See“ von Johann Wolfgang Goethe aus dem Jahr 1775 beschäftigt sich mit der Naturverbundenheit des lyrischen Ichs. Es beschreibt die Kraft, die das lyrische Ich aus der Natur schöpft, während einer Bootsfahrt.
- Naturverbundenheit und ihre Kraft
- Flucht aus dem Alltag und Suche nach Ruhe
- Kontrast zwischen Vergangenheit und Gegenwart
- Kritik an der Gesellschaft und ihren Normen
- Der Mensch als Teil der Natur
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
In der ersten Strophe beschreibt das lyrische Ich die Schönheit der Natur und die Kraft, die es daraus schöpft. In der zweiten Strophe verfällt es in Träume, die es jedoch schnell wieder ablehnt. In der dritten Strophe kehrt das lyrische Ich zur Beschreibung der Natur zurück, wobei es nun eine noch tiefere Verbindung zu ihr empfindet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Natur, Kraft, Ruhe, Flucht, Alltag, Gesellschaft, Vergangenheit, Gegenwart, Liebe, Traum, Metapher, Symbol, Sturm und Drang, Weimarer Klassik, Gesellschaftskritik, Selbstverwirklichung.
- Arbeit zitieren
- Felix Wiebrecht (Autor:in), 2010, Goethe - Auf dem See: Interpretation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/168955